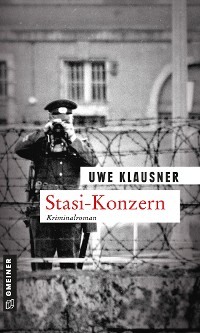Kitabı oku: «Stasi-Konzern», sayfa 2
2
RIAS-Reportage über den Fluchttunnel │05. 10. 1964
RIAS: Wie haben sich die letzten … Minuten abgespielt, die ja die entscheidenden sind?
Fluchthelfer: Es ist gut gelaufen, bis eben am fraglichen Abend – in der fraglichen Nacht – als Flüchtlinge getarnt zwei Männer erschienen, die vorgaben, noch einen anderen Mann holen zu wollen oder holen zu müssen. Wir waren aber nicht sicher, ob es nun Flüchtlinge waren oder keine Flüchtlinge. Wir hatten eben das Ultimatum gestellt, innerhalb von fünf Minuten zurückzukommen mit diesen neuen Flüchtlingen. Nach fünf Minuten kamen diese Männer mit dem dritten angekündigten Mann zurück. Diese drei Leute traten dann in den Hof und forderten uns mit entsicherter Maschinenpistole auf mitzukommen. In der darauf folgenden Schrecksekunde blieben wir natürlich starr stehen, dann rannten wir über den Hof. Die Vopos eröffneten sofort – ohne jede Warnung – und ohne jeglichen Aufruf das Feuer. Ich schätze, dass etwa 100, 150 oder – ich weiß nicht, wie viel – Schüsse auf uns abgegeben worden sind in einem Hof, der nicht größer ist als vielleicht sechs Meter auf drei Meter.
RIAS: Das war aber auch der Schlussstrich unter die ganze Aktion. Wahrscheinlich hätten Sie noch weitermachen können, nicht?
Fluchthelfer: Wir hätten noch weitermachen können, wir hätten es zumindest versucht, aber das war, wie gesagt, der Schlussstrich, und wir mussten daraufhin natürlich sofort die ganze Aktion abblasen.
(Quelle: www.chronik-der-mauer.de)
MYTHOS UND WAHRHEIT
›Der Unteroffizier war von Zobels Kugel im Oberkörper getroffen und an der Lunge verletzt worden. Tödlich aber waren die Kugeln von Volker M., die den verwundeten Egon Schultz trafen, als er sich gerade wieder aufrichtete.‹
(DIE WELT, 30. 11. 2011)
*
›Am 5. Oktober 1964, gegen 0.15 Uhr, wurde Unteroffizier Egon Schultz bei der Ausübung seines Dienstes an der Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen Republik zum NATO-Stützpunkt Westberlin von Westberliner Agenten durch gezielte Schüsse meuchlings ermordet. Die Mörder drangen durch einen von Westberlin vorgetriebenen Agententunnel, der mit Billigung und aktiver Unterstützung der Westberliner Polizei angelegt wurde, im Abschnitt Strelitzer Straße in das Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik ein, um im Auftrag Westberliner Spionageorganisationen Personen illegal, unter Verletzung der Staatsgrenze zu schleusen.‹
(Neues Deutschland, 6. 10. 1964)
POST MORTEM (I)
IN DIESEM HAUSFLUR
WURDE AM 5. OKTOBER 1963
UNTEROFFIZIER
EGON SCHULTZ
GEBOREN AM 4. JANUAR 1943
BEI DER AUSÜBUNG
SEINES DIENSTES ZUM SCHUTZ
DER STAATSGRENZE DER
DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN
REPUBLIK
DURCH WESTBERLINER AGENTEN
MEUCHLINGS ERMORDET
*
Im Hof dieses Hauses endete ein von
West-Berlin aus gegrabener 145 Meter langer Tunnel,
durch den 57 Männern, Frauen und Kindern
in den Nächten des 3. und 4. Oktober 1964
die Flucht in den Westen gelang. Nach Verrat
der Fluchtaktion an das Ministerium für
Staatssicherheit der DDR kam es auf dem Hof
zu einem Schusswechsel zwischen Grenzsoldaten und Fluchthelfern. Dabei kam der
Unteroffizier der Grenztruppen der
Nationalen Volksarmee
*
Egon Schultz
*4. Januar 1943 in Groß-Jestin (Kreis Kolberg)
am 5. Oktober ums Leben. Egon Schultz
wurde in der DDR als Held idealisiert, die
Fluchthelfer galten als Agenten und Mörder.
Erst nach dem Fall der Mauer stellte sich heraus,
dass die tödlichen Schüsse aus der Waffe
eines Kameraden abgegeben wurden. Dieser
Sachverhalt war den DDR-Verantwortlichen
von Anfang an bekannt.
(Gedenktafeln am Haus Strelitzer Straße 55 in Berlin-Mitte)
ERSTES KAPITEL
(Berlin, Freitag, 9. Oktober 1964)

3
Ost-Berlin (Stadtbezirk Mitte), Institut für Rechtsmedizin der Humboldt-Universität in der Hannoverschen Straße 6 │07:30 h
»Der Obduktionsbefund?«, entrüstete sich die Endvierzigerin, bebrillt, kurz angebunden und mit einer Turmfrisur, bei der jedes Haar an der richtigen Stelle saß. »Da muss ich aber erst den Herrn Professor fragen!«
Ihr Gesprächspartner reagierte mit einem müden Lächeln. »Bei aller Freundschaft –«, antwortete er in dem für ihn typischen, teils spöttischen, zuweilen aber auch harschen Ton, wobei er das letzte der drei Wörter besonders betonte, »das wird, denke ich, nicht nötig sein.«
Die Sekretärin, die dem Klischee der altjüngerferlichen Vorzimmerdame perfekt entsprach, gab sich unbeeindruckt. »Was hier nötig ist und was nicht, junger Mann, entscheide immer noch ich.«
»Besten Dank für den jungen Mann«, antwortete der unverhoffte Besucher, zog ein silbernes Etui aus der Innentasche seines Sakkos, an dessen Revers das Parteiabzeichen der SED steckte, und fand offenbar nichts dabei, eine Zigarette Marke Herzegowina Flor anzuzünden. »Damit Sie Bescheid wissen: Ein Anruf von mir, und Sie kriegen den Wind von vorn. Wenn ich Sie wäre, würde ich mich entscheiden, was mir weniger behagt: Ärger mit meinem Chef oder …«
»Oder?«, trotzte die Sekretärin, die außer dem Institutsleiter keine anderen Götter neben sich duldete. »Wollen Sie mir etwa drohen?«
Czerny antwortete mit einem gequälten Schnauben. »Ich fürchte, Sie verkennen die Situation, junge Dame«, antwortete der 43-jährige Major, sog an seinem Glimmstängel und blies seinem Gegenüber, das ihn mit verkniffener Miene beäugte, den Rauch ins Gesicht. »Wenn hier jemand am längeren Hebel sitzt, dann bin ich es. So viel Erfahrung, will heißen: Kenntnis der Gepflogenheiten in unserem Arbeiter- und Bauernstaat, müssten Sie eigentlich haben. Ergo: Sie werden mir jetzt den Befund in Sachen Egon Schultz, Unteroffizier der Grenztruppen der Nationalen Volksarmee, aushändigen. Und zwar umgehend. Ich hoffe, das war deutlich genug.« Die Zigarette in der Linken, griff Gerd Czerny, von Geburt Deutscher, dank eines russischen Stiefvaters jedoch auch Sowjetbürger, nach seinem Dienstausweis, der die Aufschrift ›Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik – Ministerium für Staatssicherheit‹ trug. »Noch Fragen?«
»So einfach, wie Sie sich das vorstellen, ist die Sache nicht.«
»Doch, ist sie.« Ohne sich um seine Gesprächspartnerin zu kümmern, durchmaß der hoch gewachsene MfS-Major das Büro, nahm einen Aschenbecher aus dem Regal und drückte die Zigarette aus. Danach wandte er sich wieder der Sektionssekretärin zu. »Hier, junge Dame – das Aktenzeichen. Damit es schneller geht.«
Aus dem Konzept gebracht, wanderte der Blick der Endvierzigerin zwischen ihrem Besucher und dem Zettel, den er auf den Schreibtisch fallen ließ, hin und her. Natürlich wusste sie, wie der Hase lief, aber das war es nicht, was sie irritierte. Es war etwas anderes, hatte mit dem Mann zu tun, der vor fünf Minuten ohne Voranmeldung aufgetaucht war.
Anneliese Petzold, rechte Hand ihres Chefs und heimliche Herrscherin im Institut für Rechtsmedizin, warf dem Offizier, der vor ihrem Schreibtisch Position bezogen hatte, einen prüfenden Seitenblick zu. Wie erwartet hatte sich der ungebetene Gast zwar ausweisen, sie trotz Imponiergehabe jedoch nicht an der Nase herumführen können. Dazu war Anneliese Petzold, geborene Matuschek, selbst viel zu lange im Polizeipräsidium in der Keibelstraße beschäftigt gewesen. Wie manch anderes hatte sie als Schreibkraft bei der Kripo nämlich eins gelernt: die wirklichen von den vermeintlichen Schurken zu unterscheiden. Was das betraf, machte ihr niemand etwas vor. Und da dem so war, beschlich sie das Gefühl, dass mit dem schlanken, gut gekleideten und zu allem Überfluss auch noch gut aussehenden Stasi-Offizier etwas nicht stimmte. Randlose Brille, hohe Stirn, dunkle Augen, weiches Kinn, volles, grau meliertes und in langen Strähnen nach hinten gekämmtes Haar, gepflegte Erscheinung, dunkler Teint – sie konnte sich nicht helfen, aber irgendetwas stimmte mit dem Besucher aus der Normannenstraße nicht.
Irgendetwas war an der Sache faul, und sie hätte zu gerne gewusst, was.
Dies herauszufinden war jedoch nicht ihr Problem. Damit sollten sich die hohen Herrn herumschlagen, allen voran ihr Chef, die in Ost und West gleichermaßen anerkannte Koryphäe. »Sie werden es nicht glauben, junger Mann – ich habe sie im Kopf.«
»Und ich, falls Sie mir die Bemerkung gestatten, habe Sie durchschaut!«, antwortete der MfS-Offizier, der dem Bild, das man sich von einem Angestellten der Firma machte, in keiner Weise entsprach. Mit einem Wort: Er war anders, laut Fazit von Anneliese Petzold, die sich dazu durchrang, einen Schlüssel aus der Schreibtischschublade hervorzuholen, mit Sicherheit ein hohes Tier. Mit dem Bild, dem man sich von einem Stasi-Agenten machte, stimmte er jedenfalls nicht überein, auch wenn er alles daransetzte, so zu erscheinen. »Soll ich mich umdrehen?«
»Ich bitte, darum, Herr …«
»Sie verlangen doch wohl nicht, dass ich meinen Namen nenne?«
»Nein, nicht wirklich«, gab die Sekretärin zurück, klug genug, sich nicht mehr Ärger als nötig einzuhandeln. Vor der Stasi, hinter vorgehaltener Hand VEB Horch, Guck und Greif, hatte selbst sie großen Bammel, und das wollte in der Tat etwas heißen. »Trotzdem bitte ich Sie, draußen zu warten.«
»Machen Sie es uns beiden doch nicht so schwer, Frau Petzold«, erwiderte Czerny und weidete sich am Erstaunen, welches sich auf dem Gesicht der Vorzimmerdame abzeichnete. »Vorschlag zur Güte: Ich drehe mich jetzt um, vertreibe mir die Zeit, indem ich das Porträt des Genossen Ulbricht an der gegenüberliegenden Wand betrachte und übe mich in Geduld. Das heißt, zumindest bis Sie den Safe hinter Ihrem Schreibtisch geöffnet, den Obduktionsbefund zutage gefördert und ihn mir übergeben haben, damit ich ihn mitnehmen und an seinen Bestimmungsort bringen kann.«
»›Mitnehmen‹? Das ist doch nicht Ihr …«
»Und ob es mein Ernst ist, Frau Petzold.« Urplötzlich, von einem Moment auf den anderen, war Anneliese Petzold mit einem anderen Mann konfrontiert. Jetzt kehrte ihr Gegenüber den Stasi-Mann heraus, schlug einen ungehaltenen, um nicht zu sagen barschen Tonfall an. »Meinetwegen machen Sie eine Notiz im Sektionsbuch. Wie Sie wissen, wurde dort am 5. Oktober, also vor vier Tagen, schon einmal ein Vermerk in oben genannter Angelegenheit hinterlassen. Er besagt, dass zwei – in Worten: zwei! – Protokolle bei Ihrem Chef verblieben und per Kurier jeweils ein Exemplar an den Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokratischen Republik und an das Ministerium des Inneren übersandt worden sind. So, und jetzt wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir die Unterlagen aushändigen würden.«
»Und was haben Sie damit vor?«
»Das, liebe Verwaltungssekretärin zur Anstellung, lassen Sie lieber meine Sorge sein. Offen gesagt: Meine Geduld ist allmählich erschöpft. Wenn Sie schlau sind, tun Sie bitte genau, was ich sage. Oder ich sehe mich gezwungen, andere Mittel der Überredungskunst anwenden. Soweit alles klar, Frau Petzold?«
Ja, damit war alles gesagt.
Ohne den Major anzuschauen, stand Anneliese Petzold auf, straffte ihr malvenfarbenes Kostüm, öffnete den Safe, der sich an der Rückwand des Büros befand, und holte eine dort neben einer Reihe anderer Dokumente verwahrte Kladde hervor.
»Nicht nur eine, Gnädigste, sondern beide.«
Die Sektionssekretärin gehorchte, legte die Kladden auf den Schreibtisch und schloss den Safe wieder ab. Dann, für ihre Verhältnisse recht spät, ging jedoch ein Ruck durch ihren Körper und sie drehte sich auf dem Absatz um. »Jetzt fällt’s mir wieder ein!«, stieß sie in der Aufregung, die sie plötzlich gepackt hatte, hervor. »Sie waren dabei, stimmt’s? Sie waren dabei, als der Professor und Doktor Meyer den Genossen obduziert haben, der am Montag ermordet worden ist. Ich hab Sie zwar nur im Vorbeigehen gesehen, aber … aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie und ein Kollege von der …«
Auch ohne den Blick, welchen ihr der Unbekannte zuwarf, wurde der Sekretärin im selben Moment klar, dass sie einen Fehler begangen hatte. Und dass es ratsam war, den Mund zu halten.
Endgültig.
»›Ermordet ist gut‹!«, sagte Czerny nach einer längeren Pause, so als habe er sich die Ereignisse, über die er sich vor Ort ein Bild gemacht hatte, nochmals ins Gedächtnis rufen müssen. »Fragt sich nur, von wem!«
Dann ließ er sich die Kladden aushändigen, machte kehrt und verließ wortlos das Büro.
4
Berlin-Schöneberg, Sydows Wohnung in der Grunewaldstraße │07:40 h
Genau hier, an dieser Stelle, war es passiert. Hier hatte seine Mutter die eigene Tochter, Sydows Schwester Agnes, erschossen. Vor seinen Augen. Mit seiner Dienstwaffe. Ohne zu zögern.
Und er? Was war mit ihm?
Er, Tom Sydow, zum Tatzeitpunkt 49 und Kriminalhauptkommissar a. D., hatte zugesehen.
Falsch. Er hatte zusehen müssen. Tatenlos, schreckensstarr, vor Entsetzen, das ihn in eine Art Schockstarre versetzte, wie gelähmt.
Oder war es am Ende seine Schuld gewesen? War es nicht fahrlässig, um nicht zu sagen verantwortungslos, die Waffe in seinem unverschlossenen Schreibtisch aufzubewahren? Und es seiner Mutter, die bei ihm zu Besuch war, zu erzählen?
Und vor allem: War es richtig gewesen, die Mörderin zu decken?
Richtig oder nicht – außer Lea, seiner Frau, hatte kein Mensch davon erfahren. Mutter, gebürtige Britin, war am darauf folgenden Tag, einem Freitag, in aller Herrgottsfrüh von Tempelhof nach Frankfurt und von dort aus nach London-Heathrow geflogen. Aber auch sonst war der 1. Juni 1962 ein denkwürdiger Tag gewesen. Kurz nach Mitternacht war im israelischen Ramla ein gewisser Adolf Eichmann aufgeknüpft worden, SS-Obersturmführer, Organisator der sogenannten ›Endlösung‹, verantwortlich für den Tod von sechs Millionen Juden – und, für Sydow das Schlimmste, Ex-Geliebter seiner Schwester. Um das Maß vollzumachen, war drei Tage später ein weiblicher Leichnam an das Ufer des Großen Wannsees gespült worden. Sydow, der den Artikel nicht zu Ende gelesen hatte, war sofort im Bilde gewesen. Und hatte geschwiegen, aus Angst, der Beihilfe zum Mord bezichtigt zu werden.
All das war mittlerweile zwei Jahre, fünf Monate und neun Tage her. Anders als erhofft hatte die Zeit seine Wunden jedoch nicht geheilt, sondern sie mit jedem Tag, der verstrich, noch vertieft. Rein äußerlich hatte sich Sydow nichts anmerken lassen, aber wie es in seinem Inneren aussah, darüber wusste nur seine Frau Lea Bescheid. Hätte sie ihn nicht getröstet, wäre er die glatte Wand hochgegangen, und sein Leben, um das ihn manch einer beneidete, nicht mehr zu ertragen gewesen.
Schwierig, oder besser gesagt ungewohnt, war es allemal. Dank einer Erbschaft, einem unerwarteten Lichtblick, war er zwar aus dem Gröbsten raus, aber das bedeutete nicht, dass sein Dasein in geordneten Bahnen verlief. Damit er auf andere Gedanken kam, waren Lea und Sydow vor Kurzem umgezogen, ein erster Schritt, aber auch nicht mehr. Wie oft er in Gedanken in das Haus am Wannsee zurückgekehrt war, konnte Sydow nicht sagen, er wusste nur, dass ihn die Ereignisse immer noch verfolgten, dass er, Tom Sydow, längst noch nicht der Alte war.
Aber immerhin, redete er sich ein, war er auf dem besten Weg dazu. Der Umzug nach Schöneberg war jedenfalls leichter vonstattengegangen als gedacht, unter anderem, weil Lea dort Verwandte und er mehrere Bekannte aus der Zeit vor seiner Flucht nach England hatte. Damals, anno 1942, war er der Gestapo nur um Haaresbreite entwischt, hatte er mehr Glück als Verstand gehabt. Es war ihm treu geblieben, auch nach dem Krieg, als er wieder zur Kripo gegangen war. Mehr als einmal war sein Schicksal auf Messers Schneide gestanden, und er konnte von Glück sagen, dass er noch lebte. Ein Privileg, das seiner Schwester, die den Preis für ihre Liaison mit einem Verbrecher gezahlt hatte, nicht zuteil geworden war.
Wie so oft, wenn ihn die Vergangenheit eingeholt hatte, riss sich Sydow nur mit Mühe von ihr los, stieß einen gedämpften Seufzer aus und hängte das Bild, auf dem der Bootssteg und sein Anwesen am Wannsee zu sehen war, wieder an die Wand neben der Tür. Dann nahm er die Zeitung, die er aus dem Briefkasten geholt hatte, und trottete in die Küche, um das Frühstück zuzubereiten. Ohne Kaffee, am besten schwarz, war er nicht zu gebrauchen, und wäre Lea nicht gewesen, der er zu stark war, hätte er die Dosierung längst erhöht.
Die ›Berliner Morgenpost‹ unter dem Arm, drehte sich Sydow vor der Küchentür um. Eigentlich war alles so, wie er es sich gewünscht hatte, auch und vor allem sein neues Domizil. Da er sich nicht vorstellen konnte, in einem der Betonbunker zu wohnen, die wie Pilze aus dem Boden schossen, hatte er sich für das vierstöckige Haus in der Grunewaldstraße entschieden. Es stammte noch aus der Kaiserzeit, das heißt, es war ein Wunder, dass es überhaupt noch stand. In den Bombennächten, die er zum Glück nicht miterlebt hatte, war fast ganz Berlin in Schutt und Asche versunken und es grenzte an Hexerei, dass es Häuser gab, die den Krieg überdauert hatten.
Er hatte es sich so gewünscht, so und nicht anders. Und er war froh, dass es Häuser wie dieses überhaupt noch gab. Wohnungen, in denen die Dielenbretter knarrten, die holzgetäfelte Wände, Decken aus Stuck, dazu reichlich Platz und einen Balkon samt Ausblick auf einen Berliner Hinterhof hatten. In Gegenwart von Lea, die lieber gebaut hätte, durfte er das zwar nicht so laut sagen, aber da es von hier aus nicht weit bis zum RIAS war, wo sie als Redakteurin arbeitete, hatte sie sich damit abgefunden.
Das hieß aber nicht, dass alles in Butter war. Einen abermaligen Seufzer auf den Lippen, betrat Sydow die Küche und begann, den Tisch zu decken. Es gab Zeiten, wo ihm die Decke auf den Kopf zu fallen drohte, und das nicht erst seit heute. Lea, die in ihrem Beruf aufging, hatte es wesentlich besser als er. Sie hatte alle Hände voll zu tun, während er nicht wusste, was er den lieben langen Tag anfangen sollte. Seit er bei der Kripo den Bettel hingeschmissen hatte, war er nicht mehr in die Gänge gekommen, für ihn, Prototyp eines Preußen, nur schwer zu ertragen. Er war ein Mensch der Tat, zum Herumsitzen, und sei es mit einem Buch in der Hand, nicht geschaffen. Na ja, zumindest nicht unbedingt. Er musste unter die Leute, musste sich mit anderen messen, etwas tun, das ihn voll und ganz in Anspruch nahm. Gewiss, da gab es natürlich die Geschichte derer von Sydow, die er erforscht, Bücher, die er gewälzt, Urkunden, die er reihenweise studiert hatte. Zufriedener war er dadurch nicht geworden, sondern das ziemliche Gegenteil. Kurzum: Aus Tom Sydow, Polizist mit Leib und Seele, war ein Stubenhocker geworden, und er musste zusehen, dass er bald die Kurve kriegte.
Die Frage war nur, wie.
Und auf welche Weise.
Nicht geschaffen, um über Gott und die Welt nachzugrübeln, nahm der 51-jährige, hochgewachsene und zum Leidwesen seiner Frau zumeist nachlässig gekleidete Ex-Kriminalhauptkommissar die Kaffeedose aus dem Schrank, öffnete sie und schüttete fünf gehäufte Löffel in den Filter. Das Minimum, um auf Touren zu kommen, das Maximum, um wegen der drei Tassen, die er kochte, mit Lea nicht aneinanderzugeraten. Er war von Natur aus konfliktscheu, wenngleich dies nur auf Lea und weniger auf die Ganoven zutraf, mit denen er im Dienst von Vater Staat zu tun gehabt hatte.
Die dampfende Henkeltasse in der Hand, ließ sich Sydow am Tisch nieder und blätterte die Morgenpost durch. Im Gegensatz zum Wochenbeginn, wo Berlin wieder einmal Schlagzeilen gemacht hatte, gab es wenig Neues, und so knöpfte er sich die vorangegangen Ausgaben vor. Das Thema Nummer eins, und zwar nicht nur im Westen, waren wieder einmal die Fluchthelfer gewesen, die ihre Stollen unter der Mauer hindurch Richtung Westen getrieben hatten. Was das anging, wich Sydows Meinung von derjenigen der übrigen Berliner nicht ab, die besagte, dass jedes Mittel recht war, um Ost-Berlinern die Flucht zu ermöglichen. Leider ging dies nicht immer reibungslos vonstatten, und während Sydows Blick auf die Schlagzeilen vom vergangenen Dienstag fiel, legten sich Sorgenfalten über sein Gesicht. ›Wilde Schießerei nach Massenflucht durch einen Tunnel‹ war in der Morgenpost zu lesen, wobei nicht klar war, wer zuerst und auf wen geschossen hatte. Eines stand jedoch fest, nämlich dass ein Grepo dabei ums Leben gekommen war. Die Zeitungen in der Ostzone, wie Sydow die DDR immer noch nannte, hatten Gift und Galle gespuckt, allen voran das Neue Deutschland, das ein Riesentamtam veranstaltet und die Gelegenheit beim Schopf gepackt hatte, um das Regime als Opfer westlicher Attacken zu präsentieren. Dass es das nicht war, wusste jeder Idiot, gäbe es die Mauer nicht, hätte der Spitzbart, wie Ulbricht nicht nur im Westen genannt wurde, schon lange einpacken können.
Um nicht in Rage zu geraten, faltete Sydow die Morgenpost zusammen, trank einen Schluck Kaffee und schmierte sich eine Butterstulle. Auf andere Gedanken kam er trotzdem nicht. Wie die meisten Berliner hatte er für Ulbricht & Co. nichts übrig, und das war, wie er offen zugab, noch harmlos formuliert. An den 17. August vor zwei Jahren, wo ein 18-Jähriger im Todesstreifen verblutet war, konnte er sich noch gut erinnern, ebenso wie an die Proteste, die auf den Tod des Maurergesellen Peter Fechter gefolgt waren. Bis zum Abtransport des Sterbenden hatte es knapp 50 Minuten gedauert, ein Umstand, der nicht nur Sydow in Wut versetzt hatte. Das Bild, auf dem ein Vopo mit dem schmächtigen Mann aus Weißensee auf dem Arm abgelichtet war, hatte für weltweite Schlagzeilen gesorgt, und wieder einmal war Berlin in den Brennpunkt des Interesses geraten. An der Situation der Insulaner, als die sich seine Mitbürger gern bezeichneten, hatte sich jedoch wenig geändert, trotz Hupkonzerten am 13. August, Demonstrationen, Sprengstoffanschlägen auf die Mauer und dem Bau von Fluchttunneln, der vor vier Tagen ein weiteres Opfer gefordert hatte. Sydow war sich sicher, dass es nicht das letzte war, und er fragte sich, wie lange der Belagerungszustand noch andauern würde.
Woanders leben wollte er trotzdem nicht, anders als all jene, die in den Westen abgewandert waren. »Na, mein Schatz – so früh schon wach?«
›Was heißt hier früh!‹, wollte Sydow grummeln, doch wie so häufig, wenn seine Laune nicht die beste war, möbelte ihn ein Kuss seiner Frau Lea wieder auf. »Klar doch!«, beeilte er sich folglich zu erwidern und schenkte seiner Jugendliebe, die er mit 40 geheiratet hatte, eine Tasse Kaffee ein. »Oder denkst du, ich lasse dich allein frühstücken? Kommt gar nicht in die Tüte, schöne Frau!«
»Du bist ein Schatz, Brummbär, weißt du das?«
Sydow wurde regelrecht warm ums Herz, aber da er sich mit Emotionsbekundungen schwertat, flüchtete er sich in Humor. »Brummbär und Schatz – wie passt das denn zusammen?«
»Sehr gut«, antwortete Lea, schälte ihr Frühstücksei und lächelte Sydow an, als sei dies ihr erstes gemeinsames Rendezvous. Sydow geriet ins Träumen. Blondes, auf die schmalen Schultern herabfallendes Haar, azurblau schimmernde Augen, helles Kleid, Sommersprossen und die Figur eines Teenagers. So hatte sie ausgesehen, als sie zum ersten Mal miteinander Tanzen gegangen waren. Und so sah sie, 49 Lebensjahren zum Hohn, immer noch aus. Obendrein hatte Lea das Glück, stets jünger geschätzt zu werden, ein Vorzug, der Sydow nicht zuteilwurde. Er war zwar über 1,90 Meter groß; bis auf das volle rotblonde Haar war das aber auch schon alles, was imposant an ihm war.
Er war kein einfacher Typ, und das sah man Thomas Randolph von Sydow, Sohn eines Spitzenbeamten und einer Engländerin, auch an. Die Nase, scharf geschnitten und ein Erbteil seiner Mutter, war eine Idee zu spitz, und das Gleiche galt für die hohen Wangenknochen, denjenigen seines Vaters zum Verwechseln ähnlich. Aber auch so hatte Sydow viel von ihm geerbt, wenngleich er in die Luft ging, wenn er mit dem Ministerialdirigenten im Reichsaußenministerium verglichen wurde. Sydow war reserviert, reizbar und zuweilen barsch, und das, im Verein mit der unterkühlten Art, war sein alter Herr auch gewesen. Darüber hinaus besaß er einen ausgesprochenen Hang zur Ironie, womit er sich bei der Kripo nicht nur Freunde gemacht hatte. Bei so viel Ähnlichkeit fielen die blauen Augen, die zumeist rissigen Lippen und der ebenfalls rotblonde Oberlippenbart nicht mehr groß auf. Der Apfel fiel nicht weit vom Stamm, wie Lea zu betonen nicht müde wurde, und das traf, seinem Unwillen von Trotz, auch auf die eine oder andere von Sydows Charaktereigenschaften zu. »Wie heißt es doch so schön: raue Schale, weicher Kern.«
»Was anderes: Wie lange musst du heute arbeiten?«
»Gute Frage. Wieso fragst du?«
»Nur so.«
Ohne aufzublicken, fuhr Lea von Sydow mit dem Schälen des Eis fort, schnitt es in Scheiben und verteilte sie auf ihrem Brot. »Glaub nur nicht, dass mir das Spaß macht, Tom!«, antwortete sie geraume Zeit später, als Sydow, der an seiner Stulle herumkaute, schon nicht mehr mit einer Antwort rechnete. »Momentan habe ich wirklich nichts zu lachen.«
»Kein Wunder – bei dem Ehemann.«
»Du sollst nicht immer alles ins Lächerliche ziehen, Tom. Ich meinte meinen Beruf.«
Nicht gerade erpicht auf einen Disput, riss sich der Kriminalhauptkommissar außer Dienst am Riemen. »Wieso – wo brennt’s denn?«
»Live-Interview mit einem Fluchthelfer. Punkt zehn. Thema: ›Tod eines DDR-Grenzpolizisten.‹ Noch Fragen?«
»Das heißt nicht DDR, das heißt …«
»Ostsektor von Berlin, ich weiß!«, fiel Lea Sydow ihrem Mann ins Wort. »Wie auch immer – keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll.«
»Na, wie denn wohl! Indem du ihn fragst, wie sich alles abgespielt hat.«
»Genau das ist der Punkt, Tom.« Die Ellbogen auf der Tischkante, verschränkte Sydows Frau die Hände und ließ das Kinn auf den Daumenkuppen ruhen. »Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber … aber irgendwie behagt mir die Angelegenheit nicht. Versteh mich nicht falsch: An sich finde ich es in Ordnung, dass man Leuten, die es drüben nicht mehr aushalten, unter die Arme greifen muss. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste mein Leben hinter Mauer und Stacheldraht … Nein, Tom, was das betrifft, versagt meine Fantasie. Ich glaube, ich würde die glatte Wand hochgehen.«
»Ich auch, das kannst du mir glauben.« Nicht sicher, worauf Lea hinauswollte, schob Sydow den Teller beiseite, täuschte Gelassenheit vor und fragte: »Und wo liegt dann das Problem?«
»Das Problem, mein lieber Tom, liegt darin, dass bei der Schießerei ein Mensch ums Leben gekommen ist. So etwas darf nicht passieren. Mord bleibt nun einmal Mord, egal, ob es einen Grepo oder einen deiner Kollegen trifft.«
»Ex-Kollegen.«
»Na schön, dann eben Ex-Kollegen.« Sydows Frau stieß einen gequälten Seufzer aus. »Du verstehst, was ich damit sagen will?«
Sydow deutete ein Nicken an. »Das heißt aber nicht, dass ich einer Meinung mit dir bin.«
»Hätte mich auch gewundert. Und wieso nicht?«
»Die Jungs haben ihr Leben riskiert, Lea. Sie haben sich abgerackert, um anderen zu helfen. Ich war zwar nicht dabei, aber wer sagt dir, dass der Betreffende nicht in Notwehr gehandelt hat?« Die Hände verschränkt, lehnte sich Sydow zurück. »Siehst du, jetzt kommst du ins Grübeln.«
»Mord bleibt Mord, Tom. Davon lasse ich mich nicht abbringen.«
»Falls es dich beruhigt: Ich auch nicht. Aber es ist nun einmal so, dass der Bau eines Fluchttunnels kein Zuckerschlecken ist. Wer mitmacht, weiß, dass er ein großes Risiko eingeht. Und wer, frage ich dich, hat denn schon Lust, den Rest des Lebens im Gelben Elend zu verbringen? Wer immer den Grepo auf dem Gewissen hat: Versetz dich doch mal in seine Lage. Da schuftest du wie ein Sklave, ackerst wie verrückt und verlangst keine müde Mark dafür. Und riskierst, dass dich die Stasi hopsnimmt und nach allen Regeln der Kunst durch die Mangel dreht. Würde dir das gefallen? Nein? Ob du es nun hören willst oder nicht, Lea: Bei einem Unternehmen wie dem Tunnel 57 musst du mit allem rechnen. Vor allen Dingen, dass dir jemand in die Quere kommt. Da kann verdammt noch mal eine Menge schiefgehen. Versteh mich nicht falsch, Lea: Mir tut der Grepo, der dran glauben musste, genauso leid wie dir. Aber was nicht zu ändern ist, ist nun mal nicht zu ändern. Und noch was: Der Fluchthelfer, der auf den NVAler geschossen hat, hat es nicht aus Jux und Dollerei getan. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wer sagt dir, dass es einer von den Fluchthelfern war? Schon mal was von Querschlägern gehört? Oder von dem, was die Amis ›friendly fire‹ nennen?«
»Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass …«
»Ich glaube überhaupt nichts, Lea. Außerdem war ich nicht dabei.«
»Aber?«
»Aber ich weiß, wozu die da drüben fähig sind. Denen traue ich alles zu. Allen voran der Stasi. «
»Weißt du eigentlich, wie du dich gerade anhörst? Wie der fleischgewordene kalte Krieger. Hier die Guten, dort drüben die Schlechten. Um ihnen eins auszuwischen, ist jedes Mittel recht.« Bevor sie fortfuhr, holte Sydows Frau tief Luft. »Was macht es schon, wenn einer von denen draufgeht. Kommt in den besten Familien vor, oder? Wo gehobelt wird, fallen nun mal Späne. Hauptsache, der Coup gelingt. Und was den Getöteten betrifft: War doch eh nur einer von der NVA, oder?«
»Das habe ich nicht gesagt.«
»Aber gedacht.«
»Wenn du meinst – du musst es ja wissen.«
»Du bist doch nicht etwa eingeschnappt, oder?«
»Eingeschnappt – ich? Wo denkst du hin!« Natürlich war er eingeschnappt. Und wie. Aber das würde er nicht zugeben. »Lass sehen – was haben wir denn da! Es geht doch nichts über Ingwerkuchen made by Lea, findest du nicht auch?«
»Lenk nicht ab, Tom.« Da auch sie einem Krach aus dem Weg gehen wollte, trank Lea Sydow noch einen Schluck Kaffee, erhob sich und umrundete den Tisch. Dann fuhr sie ihrem Mann durchs Haar. »Und sitz nicht den ganzen Tag hier rum. Bis ich wieder hier bin, kann es dauern.«
»Wie lange denn?«