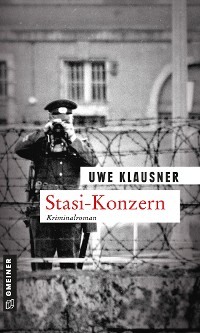Kitabı oku: «Stasi-Konzern», sayfa 3
»Keine Ahnung.« Sydows Frau nahm seinen Kopf zwischen die Hände und drückte ihm einen Kuss auf die Stirn. »Wie wär’s, wenn du mal einen Dauerlauf machst? Das bringt dich auf andere Gedanken.«
Dauerlauf. Das fehlte noch. Wenn Churchill in einem Punkt recht gehabt hatte, dann darin, dass Sport dem Wohlbefinden eines Gentleman abträglich war. Zwar rauchte er äußerst selten und genehmigte sich nur hin und wieder ein Bier, aber diesbezüglich war er mit seinem Landsmann einer Meinung.
Dauerlauf? Nicht mit ihm.
Dann schon lieber eine FdH-Kur.
»Was guckst du denn so? Hab ich etwas Falsches gesagt?«
»I wo. Wo denkst du hin.«
»Sei doch nicht immer gleich be…«
»Ich bin nicht beleidigt, Lea. Ich weiß selbst, dass ich zu viel Speck auf den Rippen habe.«
»Speck oder nicht – ich muss jetzt los!«, erwiderte Lea Sydow, strich ihrem Mann über die Wange und hastete von dannen. »Mach’s gut, Brummbär – bis heute Nachmittag!«
Du hast gut reden!, dachte Sydow bei sich, verzehrte die Reste seiner Stulle und konnte der Versuchung, ihr eine Portion Rührei folgen zu lassen, nicht widerstehen. Ein opulentes Frühstück war nicht zu verachten, besonders wenn man Kap Hoorn nur knapp umschifft hatte.
Dachte er wenigstens.
Und ahnte nicht, was ihm noch bevorstehen würde.
Doch dann, kaum dass seine Frau zum Aufbruch gerüstet hatte, geschah es. Telefon, zu allem Unglück Dauerläuten. Das bedeutete nichts Gutes.
Sydow angelte sich einen Speckstreifen, erhob sich, eilte mit vollem Mund an den Apparat und nahm ab.
Kurz darauf, nach Beendigung des Gespräches, ließ er den Hörer auf die Gabel sinken.
Freitag, der 9. Oktober 1964, versprach ein besonderer Tag zu werden.
Ein Tag, an den er noch lange denken würde.
5
Ost-Berlin (Stadtbezirk Lichtenberg), Haus 1 des Ministeriums für Staatsicherheit in der Ruschestraße 103 │08:40 h
Er war der Mann, mit dem es sich nicht einmal Ulbricht verderben wollte, und es gab nicht wenige, die ihn als heimlichen Herrscher der DDR bezeichneten. Er selbst, Tschekist aus Überzeugung, hörte es mit Vergnügen, reagierte jedoch ungehalten, wenn er darauf angesprochen wurde. Dass dies der Wahrheit entsprach, wusste er jedoch nur zu gut, doch war er klug genug, sich in Zurückhaltung zu üben. Dies galt vor allem für sein Auftreten gegenüber Spitzenkadern, wo er darauf bedacht war, den aufopferungsvollen Parteisoldaten zu mimen.
Insgeheim jedoch, vor allem im Umgang mit Untergebenen, legte der Minister für Staatssicherheit ein ausgesprochen rüdes, um nicht zu sagen vulgäres Benehmen an den Tag. Erich Mielke, 56 Jahre und zweites von vier Kindern eines KPD-Aktivisten aus dem Wedding, betrachtete dies jedoch nicht als Makel. Um die Körpergröße von 1,63 Metern zu überspielen, hatte er früh gelernt, auf sich aufmerksam zu machen. Eine Angewohnheit, die er auch dann beibehielt, als er die Leitung des MfS übernahm. Umgangsformen, gepaart mit Zurückhaltung, waren seine Sache nicht, die Wutausbrüche, auch solche im kleinen Kreis, allseits gefürchtet. Mielke, seit 1957 Stasi-Chef, war kein Freund langatmiger Diskussionen. Durchgreifen, handeln, nicht lange fackeln – das, verbunden mit einem klaren Feindbild, war seine Devise. Der Arbeitersohn, den die Aura eines Bullterriers umgab, war nicht nur impulsiv, sondern auch verschlagen, trotz wachen Verstandes nicht übermäßig gebildet und jederzeit bereit, seine Gegner, auch solche in den eigenen Reihen, aus dem Weg zu räumen. An ihnen herrschte gewiss kein Mangel, doch wagte niemand, sich mit ihm anzulegen. Erich Mielke war und blieb der meist gefürchtete Mann der DDR, und nichts deutete darauf hin, dass sich dies ändern würde.
»Eins weiß ich genau: Wenn wir die Ratten, die den Tunnel gebuddelt haben, in die Finger kriegen, werde ich sie eigenhändig liquidieren.« Mielke redete nicht bloß daher, er meinte es auch so. Für ihn, Absolvent der Moskauer Lenin-Schule und Stalinist, gab es nur zwei Sorten von Menschen: überzeugte Kommunisten und solche, die man zu ihrem Glück zwingen musste. Was Letztere betraf, war jedes Mittel recht, um sie mundtot zu machen, wenn es sein musste, auch unter Anwendung von Gewalt. Wer nicht für ihn war, wurde liquidiert, nur eine der Lehren, die er aus seinem Aufenthalt in der Sowjetunion gezogen hatte. »Als Tschekist bin ich das unserem Arbeiter-und-Bauern-Staat schuldig.«
Mielke, der hochrangigste der drei Männer im abgedunkelten Dienstzimmer der Ost-Berliner Geheimdienstzentrale, erntete keinen Widerspruch. Dazu war das Thema, um das es sich bei der Diavorführung drehte, viel zu ernst. »Kann mir mal einer sagen, warum kein Schwein etwas davon mitgekriegt hat?«
»Bei allem gebotenen Respekt, Genosse Minister –«, tönte es aus dem hinteren Teil des Raumes, der zum Geheimsten zählte, was die DDR zu bieten hatte, »das frage ich mich auch.« Geheim vor allem deshalb, weil sich unmittelbar hinter Mielkes Schreibtisch der Panzerschrank des VEB-Stahlschrankwerkes ›Feuerfest‹ befand, in dem Mielke Unterlagen aufbewahrte, die nicht in fremde Hände gelangen durften. In diese Rubrik fiel natürlich nicht nur der Klassenfeind und mit ihm ein ganzes Heer von ›Fronstadt-Agenten‹, Diversanten und Saboteuren, sondern in erster Linie auch die eigenen Genossen, an ihrer Spitze Ulbricht und Honecker. Es gab niemanden, dem der Herr der Spitzel vertraute, und schon gar niemand, der von sich behaupten konnte ihn zu kennen. Mielke hütete seine Geheimnisse wie einen Schatz, um sie bei passender Gelegenheit aus dem Ärmel zu ziehen. Darin, im Abpassen des richtigen Moments, lag seine Stärke, und man konnte nie sicher sein, wen er als Nächstes ins Visier nehmen würde.
»Wie dem auch sei, Kamerowski«, erwiderte der Stasi-Chef, den Ellbogen auf der Lehne seines Sessels, und trommelte mit der Linken auf dem blankpolierten Schreibtisch aus volkseigener Produktion herum. »Noch so eine Panne, und ich kann meinen Hut nehmen.«
»Panne?«, echote Mielkes Sekretariatsleiter, vom Schreibtisch aus kaum zu erkennen. »Dagegen sind wir doch wohl …«
»Machtlos?«, vollendete der Stasi-Chef, kurz davor, aus der Haut zu fahren. »Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst, Kamerowski!«
Um nicht anzuecken, verkniff sich der 53-jährige Generalmajor eine Erwiderung und wechselte rasch das Thema. »Bitte um Erlaubnis, meinen Vortrag fortsetzen zu können, Genosse Minister!«, schnarrte er, nach eigenem Empfinden reichlich übertrieben. Bei Mielke, dem Lektor für militärpolitische Fragen an der Moskauer Lenin-Schule und Veteran des Spanischen Bürgerkrieges, kam so etwas jedoch gut an. Umso mehr, weil er Widerspruch auf den Tod nicht ausstehen konnte. »Sie gestatten?«
Mielke machte sich nicht einmal die Mühe zu nicken, sondern stieß einen unwirschen Grunzlaut hervor.
»Wo waren wir stehen geblieben – genau!« Kamerowski betätigte die Fernbedienung, um das nächste Schwarz-Weiß-Dia zu erläutern. Es zeigte ein Treppenhaus, von dessen Wänden der Putz abblätterte, das Geländer und eine Flügeltür. »Der Hinterausgang«, erläuterte der Sekretariatsleiter und betätigte den Schalter in der rechten Hand erneut. »Dort hat es den armen Teufel erwischt.«
Mielke reagierte nicht darauf.
Kamerowski nahm dies als Aufforderung zur Eile, womit er zweifelsohne richtig lag. »Und hier die gleiche Stelle von außen, also vom Hof«, tat er mit Blick auf die Backsteinfassade und die offen stehende Flügeltür kund. »Dort hat …«
»Dort hat es den armen Teufel erwischt, ich weiß.«
Dies war zwar nicht das, was Kamerowski hatte sagen wollen, aber es genügte, um ihn aus dem Konzept zu bringen. »Und … und hier, Genosse Minister –«, unternahm der 53-Jährige einen weiteren Versuch, seinen Herrn gnädig zu stimmen, indem er einen Zeigestock zur Hand nahm und auf die betreffende Stelle deutete, »kam es zu der folgenschweren Schießerei.«
»Schießerei?«
»Wie Sie wissen, hat das Gutachten unserer Ballistik-Abteilung ergeben, dass die Waffe von Unteroffizier Schultz nicht zum Einsatz gekommen ist.« Kamerowski gab ein Verlegenheitsräuspern von sich. »Er hat keinen Schuss abgegeben. Keinen einzigen.«
»Und die Frontstadt-Saboteure?«
»Mindestens ein halbes Dutzend.«
»Wie? Nicht mehr?«
»Soweit ich informiert bin, hat die Spurensicherung insgesamt sieben Patronenhülsen gefunden, die aus der Waffe des Fluchthelfers …«
»Das heißt nicht ›Fluchthelfer‹, Kamerowski, sondern ›faschistischer Provokateur‹!«, brüllte Mielke und hieb mit der flachen Hand auf den Tisch. »Und das von einem meiner engsten Mitarbeiter – nicht zu fassen! Ich will Ihnen mal was sagen, Genosse: Mir ist scheißegal, wer hier auf wen geballert oder welcher Trottel aus den eigenen Reihen diesen Schultz auf dem Gewissen hat. Sei’s drum – ändern lässt sich daran sowieso nichts mehr. Wichtig ist, dass wir den größtmöglichen Nutzen aus dem Schlamassel ziehen. Und dass sich so eine Pleite nicht wiederholt. Alles, was recht ist, Kamerowski: Langsam frage ich mich, weshalb wir jedes Jahr eine halbe Milliarde zum Fenster rauswerfen und über 30.000 Kostgänger durchfüttern, wenn sie zu dämlich sind, dem Abschaum aus dem Westen das Handwerk zu legen. Knapp 10 Prozent des Polizei- und Armeeetats – und wofür? Für nichts, Herr Generalmajor, für nichts und wieder nichts! Ich will Erfolge sehen, Kamerowski – kapiert? Dafür werden Sie und die übrigen Genossen bezahlt.« Der Stasi-Chef holte tief Luft. »Ein Tunnel nach dem andern, so viele, dass man mit dem Zählen nicht mehr hinterherkommt – Sie werden zugeben, dass es so nicht weitergehen kann.« Krebsrot im Gesicht, lockerte Mielke seine Krawatte. »145 Meter lang, und keiner will etwas bemerkt haben. Wissen Sie was, Genosse: Das können diese Jammerlappen von Grenzern ihrer Großmutter erzählen. Aber nicht mit mir, Freunde, nicht mit mir! Wenn dieser Unglücksrabe unter der Erde ist, könnt ihr euch auf was gefasst machen! Da werden Köpfe rollen, glauben Sie mir.«
»Erlauben Sie mir eine Bemerkung, Genosse Minister?«
»Aber nur eine. Je mehr gequatscht wird, desto weniger kommt dabei raus.«
Kamerowski schluckte. »Ich bin überzeugt, die zuständigen Stellen werden alles tun, um die Umstände, die zum Tod von Unteroffizier Schultz geführt haben, restlos aufzuklären.«
»Zu Ihrer Information, Kamerowski: Laut Gutachten sind insgesamt zehn Schüsse auf ihn abgefeuert worden, davon zwei aus der Waffe eines faschistischen Banditen.«
»Höchste Zeit, dass diesen Flucht… dass den faschistischen Provokateuren das Handwerk gelegt wird«, erwiderte der Sekretariatsleiter und schaute derart arglos drein, dass Mielke beschloss, den Versprecher zu ignorieren. »Sonst machen wir uns zum Gespött.«
Der MfS-Chef ging jedoch nicht darauf ein. »Und sein Kamerad, dieser …«
»Maier. Soldat Volker Maier. Was ist mit ihm?«
»Haben Sie dafür gesorgt, dass er zum Schweigen verdonnert wird?« Die Stirn in Falten, ließ sich Mielke in seinen Sessel sinken. »Nicht auszudenken, wenn etwas durchsickern würde – am Ende vielleicht noch nach drüben! Wenn das passiert, Genosse, können wir einpacken.« Der Mann, um den selbst Spitzenkader einen Bogen machten, schürzte die farblosen Lippen. »Dann möchte ich nicht in Ihrer Haut stecken, Kamerowski!«
Der Angesprochene tat so, als habe er den drohenden Unterton nicht bemerkt. »Die Tür zum Hof«, fuhr er stattdessen mit Blick auf das nächste Dia fort, den Zeigestock, den er wie ein Gewehr präsentierte, in der rechten Hand. »Der linke Flügel offen, der rechte zum Tatzeitpunkt geschlossen. Man beachte die Blutflecken, in erster Linie auf dem Treppenabsatz.«
»Ich habe Augen im Kopf, Genosse. Weiter.«
Klick. Ein Geräusch, das sich wie Entsichern einer Waffe anhörte. Fotos von Einschusslöchern in der Backsteinwand, von Blutflecken auf dem Hofpflaster, herumliegenden Patronenhülsen, Mülltonnen und drei Stufen, die zum nur wenige Schritte von der Hintertür entfernt gelegenen Toilettenhäuschen führen.
Klick.
Das Innere des Toilettenhäuschens. Knopfdruck. Der Einstieg in den Tunnel 57. Ein Klicken. Abermals der Einstieg, diesmal aus der Vertikalen. Ein Knacken, untermalt vom Rauschen des Projektors. Und dann, um die Niederlage perfekt zu machen, die Skizze eines Schachtes, der in schnurgerader Linie Richtung West-Berlin führt.
Nach Wedding, wo Mielke aufgewachsen war.
»Wenn ich könnte, würde ich die Bastarde der Reihe nach liquidieren. Persönlich.«
»Ich finde, das ist der falsche Weg.«
Es gab nur wenige, die den Mut besaßen, Mielke zu widersprechen, unter ihnen der Agent, der den Decknamen ›Radek‹ trug. Außer dem Minister, der die Wahrung seiner Identität zur Chefsache erklärt hatte, war sein Name niemandem bekannt. Gemunkelt wurde natürlich viel, auch darüber, dass es eine Sondereinheit gab, an deren Spitze besagter Radek stand. Da Geheimhaltung jedoch oberstes Prinzip war, wagte niemand, den kursierenden Gerüchten auf den Grund zu gehen.
»Es sei denn, so etwas kommt noch öfter vor.« Dem Mann, der mit verschränkten Armen am Türbalken lehnte, war es recht so. Anders als bei Kamerowski, der Mielke verblüffend ähnlich sah, handelte es sich bei ihm um einen gänzlich anderen Typ. Kamerowski war untersetzt, stiernackig und der geborene Speichellecker, Radek das genaue Gegenteil. Vom Aussehen her viel älter, in Wahrheit jedoch knapp zehn Jahre jünger als der Büroleiter, wies er keinerlei besondere Merkmale auf, weder was sein Allerweltgesicht, das stets angefeuchtete Haar, die Geheimratsecken und schiefergrauen Augen noch was den Rollkragenpullover, die dunklen Hosen und das cremefarbene Jackett betraf. Radek war es recht so, denn er wollte – und durfte – auf keinen Preis auffallen. Als Leiter der ›Sektion Omega‹, deren Aufgabe darin bestand, Maulwürfe, Überläufer und Verräter aufzuspüren, war dies oberstes Gebot. Und die halbe Miete, um zu überleben. »Dann, wie ich wohl nicht eigens betonen muss, müssen wir natürlich einschreiten.«
»Soll das heißen, Sie sind dafür, die Angelegenheit auf sich beruhen zu …«
»Damit wir uns nicht falsch verstehen, Genosse Kamerowski: Wenn der Genosse Minister den Befehl erteilt, die Schuldigen zu liquidieren, wird er selbstverständlich ausgeführt. Was mich betrifft, bin ich der Meinung, dass es derzeit Wichtigeres zu tun gibt, als einen Rachefeldzug gegen westliche Saboteure zu führen.«
»So? Und was denn?«, erwiderte der Sekretariatsleiter, zog die Vorhänge zurück und schaltete den Projektor wieder aus. »Ich dachte, es sei alles gesagt.«
»Wenn Sie sich da mal nicht irren, Genosse Generalmajor«, gab Radek zurück, die Augenlider, die von eisgrauen Brauen überwölbt wurden, fast vollständig geschlossen. »Ich habe lediglich gesagt, dass es ratsam wäre, wenn wir uns auf andere Dinge …«
»Und auf welche?«, blaffte Mielke, dem die Art, wie Radek um den heißen Brei herumredete, an den Nerven zehrte. Ein Blick auf seinen Vertrauten, und der Grund hierfür wurde ihm jedoch auf Anhieb klar. »Soll das heißen, es gibt schlechte Nachrichten? Und was Sie betrifft, Kamerowski – tun Sie mir den Gefallen und lassen uns allein. Ich möchte mit Radek unter vier Augen reden.«
»Wie Sie wünschen, Genosse Minister.«
»So, Radek, den wären wir los!«, richtete Mielke das Wort an den 43-jährigen Dresdener, nachdem dieser unaufgefordert Platz genommen und es sich auf dem Sessel vor Mielkes Schreibtisch bequem gemacht hatte. »Und jetzt raus mit der Sprache – was ist passiert?«
Die Rechte über den Augen, mit der er sie gegen das hereinflutende Tageslicht abschirmte, ließ sich Radek mit seiner Antwort Zeit. »Etwas, woran wir möglicherweise zu kauen haben werden«, begann er nach reiflicher Überlegung, der Blick auf den Fingerkuppen und dem darüber streichenden Daumen. »Aber noch ist bekanntlich nicht aller Tage Abend.«
Das Läuten des Telefons, Teil einer links von Mielke befindlichen Apparatur, durch die er führende Funktionäre per Direktleitung erreichen konnte, sorgte dafür, dass Radek seine Ausführungen unterbrach.
»In Ordnung – stellen Sie durch.« Mielkes Miene sprach Bände, und man musste nicht Radek heißen, um zu erkennen, dass ihm der Schreck in sämtliche Glieder gefahren war. »›Verdächtig‹?«, rief er stirnrunzelnd aus, den Hörer am rechten Ohr. »Inwiefern, Herr Professor? Ach was, wer kommt denn auf so eine Idee! Wie? Unsinn! Major Czerny genießt mein vollstes Vertrauen. Er hat auf meinen ausdrücklichen Befehl gehandelt. Wieso? Das lassen Sie mal lieber meine Sorge sein. Ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig. Wenn Sie wollen, wenden Sie sich an den Generalstaatsanwalt. Oder an das Ministerium des Inneren. Auf Anfrage wird es sicherlich bereit sein, Ihnen eine Kopie … ›Ohne mich zu informieren‹ – was, bitte schön, soll das heißen? Damit Sie Bescheid wissen, Herr Professor Prokop: Um das Obduktionsprotokoll ausgehändigt zu bekommen, muss ich niemanden um Erlaubnis fragen. Am allerwenigsten Sie. ›Ein ungeheurer Vorgang‹? Überlegen Sie sich genau, was Sie sagen. Sie haben es hier nicht mit einem Ihrer Assistenzärzte zu tun. Aber natürlich können Sie Beschwerde einlegen. Ich frage mich nur, bei wem. Unter uns, Herr Professor: Wenn ich Sie wäre, würde ich die Angelegenheit auf sich beruhen lassen. Es sei denn, Sie ziehen es vor, Scherereien zu bekommen. Kein Bedarf? Na also, warum nicht gleich! Was Sie jetzt tun sollen, fragen Sie? Na, was wohl – den Mund halten! Zu niemandem ein Wort, kapiert? Nichts für ungut – und danke für den Anruf. Wiederhören!«
»Schwierigkeiten?«
»Nicht, dass ich wüsste!«, erwiderte Mielke und warf Radek, der ihn mit hochgezogenen Brauen musterte, einen unwirschen Seitenblick zu. Dann erhob er sich, durchquerte den Raum und riss die Tür zum Vorzimmer auf, wo er auf einen erstaunt dreinblickenden Kamerowski traf. »Czerny soll kommen!«, bellte er, eine Vorahnung, die sich alsbald bestätigte, im angespannt wirkenden Gesicht. »Aber dalli!«
Kamerowski, nicht minder ahnungsvoll, senkte den Blick. »Bedaure, das wird nicht gehen.«
»Und wieso nicht?«
»Hier, Genosse Minister«, antwortete der Generalmajor, einen Umschlag, der an Mielke adressiert war, in der ausgestreckten Hand. »Er hat Ihnen eine Nachricht …«
Mielke wartete die Antwort nicht ab, gebot Kamerowski zu schweigen und öffnete das Couvert. Dann überflog er den darin befindlichen Brief.
Ein Brief, der es wahrhaftig in sich hatte.
Wie lange er dagesessen, vor sich hin gestarrt und sämtliche Racheszenarien, die ihm in den Sinn kamen, durchgespielt hatte, war dem Stasi-Chef hinterher nicht bewusst. »Schlechte Nachrichten?«, fragte der Leiter der Sektion Omega, ein rätselhaftes Lächeln im Gesicht. Und ergänzte: »Czerny, hab ich recht?«
Mielke nickte, in Gedanken immer noch bei dem Mann, dem er wie keinem Zweiten vertraut hatte. Dann, nach einem Kopfschütteln, das seine ganze Ratlosigkeit ausdrückte, reichte er den Brief über die rechte Schulter.
Die Reaktion fiel jedoch anders aus als erwartet. »Kopf hoch, Genosse Minister«, tönte es hinter seinem Rücken, optimistischer als erwartet. »Ich weiß, wo der Verräter steckt!«
6
Berlin-Schöneberg, Sydows Wohnung in der Grunewaldstraße │09:10 h
»Kann es sein, dass du ein bisschen zugelegt hast, Tom?«, fragte Sydows Schwiegersohn in spe und biss in die Käsestulle, die der Stiefvater seiner Angebeteten geschmiert hatte. »Tut mir leid – war nicht so gemeint!«
Sydow nahm es mit Humor. Auf ein paar Kilo mehr oder weniger kam es schließlich nicht an, Hauptsache, man fühlte sich wohl.
Und das war bei ihm ja wohl der Fall, oder?
»Freut mich, wenn es dir schmeckt, Hajo«, warf der Hausherr ein und beschloss, dem Frühstück mit Lea ein zweites in Form einer Käsestulle mit Zwiebeln, seinem erklärten Leibgericht, folgen zu lassen. Auf einem Bein konnte man nicht stehen, und anderen beim Essen zuzusehen war nun wirklich nicht das Wahre. »Greif zu!«
»Wenn ich ehrlich bin, ist mir der Appetit vergangen«, bekannte Hans-Joachim Marquard, 23, Student an der Kirchlichen Hochschule in Zehlendorf und Verlobter von Leas Tochter aus erster Ehe, und legte die angebissene Stulle auf den Teller. »Warum, kannst du dir wahrscheinlich denken.«
Sydow verneinte. »Probleme an der Uni?«
»I wo! Alles bestens.«
»Na dann!« Um nicht unhöflich zu erscheinen, unterbrach Sydow sein zweites Frühstück, verschränkte die Hände und sah den Freund seiner Stieftochter Veronika, auch sie Studentin, mit erwartungsvoller Miene an. »Irgendwas nicht in Ordnung?«
»Das kannst du aber laut sagen.«
Sydow stutzte. Ein Blick auf den blonden, ein wenig blass und anders als sonst auch ein wenig fahrig wirkenden Studenten der Theologie aus Lichterfelde, und der Gedanke an einen geruhsamen Vormittag begann sich in Luft aufzulösen. »Rück raus damit, Hajo – was ist los?«
»Es ist wegen Vroni, Tom. Wir haben uns in die Wolle gekriegt.«
»In die Wolle gekriegt?« Das hatte ihm gerade noch gefehlt. Erst der Disput mit Lea, und jetzt, im denkbar ungünstigsten Moment, sein zukünftiger Schwiegersohn, der wie ein Häuflein Elend am Küchentisch saß und seinem Ersatz-Vater das Herz ausschütten wollte. »Weshalb denn? Ich dachte, mit euch beiden ist alles in …«
»Das war es auch, Tom. Bis vor vier Tagen.«
Böses ahnend schob Sydow seinen Teller auf die Seite, legte die Ellbogen auf die Tischplatte und hoffte, dass sich die Vermutung, die in ihm aufkeimte, nicht bewahrheiten würde. Hajo, seit dem Krieg Halbwaise und infolge des Krebstodes seiner Mutter auf sich allein gestellt, war nicht nur ein zukünftiger Verwandter, sondern mittlerweile fast so etwas wie ein Sohn für ihn geworden. Die Sympathie, die er für ihn hegte, beruhte auf Gegenseitigkeit, und es gab nichts, was ihm der schlaksige und so gut wie nie ohne Schlips und weißes Hemd in Erscheinung tretende junge Mann mit dem Kurzhaarschnitt nicht anvertraut hätte. Lea, verwundert über so viel Vertrautheit, zog ihn zwar wegen seines Beschützerinstinktes auf, aber das war, wie so vieles, nicht wirklich ernst gemeint. »Kopf hoch, Hajo, das kommt in den besten Familien vor.«
»Ich weiß. Aber zugesetzt hat es mir trotzdem.« Marquard stierte bedrückt vor sich hin. »Mal ehrlich, Tom: Würdest du dich freuen, wenn Lea dich als Kriminellen bezeichnet hätte?«
Obwohl ihm nicht danach war, konnte sich Sydow ein Lächeln nicht verkneifen. »Hast du eine Ahnung, was Lea mir schon alles an den Kopf geworfen hat!«, übte er sich in Humor, was, wie er sehr wohl wusste, der Situation nicht angemessen war. Und ruderte prompt zurück: »Ich weiß, so was ist nicht zum Lachen. Tut mir leid, Hajo. Zumal ich mir sicher bin, dass du ein grundanständiger Zeitgenosse bist.«
»Freut mich zu hören, Tom«, entgegnete Marquard, die Andeutung eines Lächelns im glatt rasierten Gesicht. »Die Genossen und etliche meiner Kommilitonen sehen das leider anders.«
»Die Genossen?«, rief Sydow aus, bestürzt, dass sich seine Vorahnung zu bewahrheiten schien. »Sag, dass du nichts damit zu tun hast!«
»Falls du den Hickhack wegen der Tunnelbuddelei meinst – doch.«
Sydow stieg die Zornesröte ins Gesicht. »Damit wir uns richtig verstehen, Hajo – «, rang er nach Worten, obwohl ihm klar war, worauf der sichtlich geknickte Theologiestudent hinauswollte, »du behauptest, beim Bau des Tunnels, der von Wedding aus in die Ost…«
»Ich behaupte es nicht nur, Tom – ich war dabei.« Hans-Joachim Marquard lächelte gequält. »Hättest du mir nicht zugetraut, was?«
Sichtlich geschockt, war Sydow die Lust am Witzereißen vergangen. »Heißt das, du warst mit von der Partie, als der DDR-Grenzer erschossen worden bist?«
»Das heißt nicht ›DDR‹, sondern ›Ostzone‹. Originalton Sydow.«
»Lenk nicht ab, Hajo. Du weißt genau, wie ernst die Sache ist.«
»War, Tom, war.« Marquard hob den Kopf und sagte: »Wie dem auch sei – sie hat sich gelohnt.«
»So, meinst du.« Obwohl er seit einem halben Jahr nicht mehr rauchte, begann sich in Sydow das dringende Bedürfnis nach einem Glimmstängel zu regen. Eine Verlockung, der er nur mit Mühe widerstand. »Und was genau hast du zum Gelingen beigetragen?«
»Ich bin Schmiere gestanden.« Marquard, der die Rolle des bußfertigen Pennälers perfekt beherrschte, kratzte sich hinterm Ohr. »Auf der Weddinger Seite.«
»Ausguck auf dem Dachboden, hab ich recht?«
»Ich sehe, du kennst dich aus.« Heilfroh, das Schlimmste überstanden zu haben, trank Marquard einen Schluck Kaffee. »Wie du dir vorstellen kannst, ist es kein Pappenstiel, so ein Ding über die Bühne zu bringen«, fuhr er fort, längst nicht mehr so zurückhaltend wie zuvor. »Hat schließlich gedauert, bis wir fertig
waren.«
»Wir?«
»Du verlangst doch nicht, dass ich dir eine Antwort gebe, oder?«
»Nicht wirklich.« Sydow ließ die angestaute Atemluft entweichen. »Dann stimmt es also, was die Genossen behaupten. So kann man sich irren!«
Marquards Miene verfinsterte sich. »Das glaubst du doch selbst nicht, oder?«
Sydows Antwort ließ auf sich warten. Der Polizist in ihm war nicht totzukriegen, und er genoss es, den künftigen Schwiegersohn an der Nase herumzuführen. »Wenn ich ehrlich bin, Hajo«, tat er mit erheblicher Verzögerung kund, »wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht, wem ich glauben soll.«
»Mir, wem denn sonst!«
»Du hast gut reden, Hajo«, sprach Sydow mit Bedacht, erhob sich und trat ans Fenster, von wo aus man einen Blick auf den Hof und das angrenzende Hinterhaus werfen konnte. Im Gegensatz zur Vorwoche ließ das Wetter zu wünschen übrig, und am Himmel, wovon nur ein winziger Ausschnitt zu sehen war, zogen Regenwolken auf. »Im Ernst: Woher soll ausgerechnet ich wissen, wer lügt und wer die Wahrheit sagt? Du warst dabei – ich nicht.«
»Na schön: Er hat auf den Grepo geschossen.«
»Wer hat auf ihn geschossen?«
»Christian.«
»Hat dieser Christian auch einen Namen?«
»Er heißt Zobel, Christian Zobel!«
»Warum denn so missmutig? Mehr wollte ich gar nicht wissen.« Sydow legte eine Kunstpause ein. Dann fragte er: »Und woher stammt die Waffe?«
»Ob du’s glaubst oder nicht, Herr Kriminalhauptkommissar: aus Polizeibeständen.«
Sydow gab ein nachdenkliches Nicken von sich. Um nachzuvollziehen, wie der Tunnelbau überhaupt möglich war, musste man nicht viel Fantasie besitzen. Ohne die – gelinde gesagt – stillschweigende Duldung seiner Ex-Kollegen wäre ein Unternehmen wie das vom vergangenen Wochenende nicht möglich gewesen. Außerdem kostete so was eine Stange Geld, von Schaufeln, Spitzhacken und technischem Zubehör einmal abgesehen. Woher dieses Geld kam, war ein offenes Geheimnis, gab es doch einen Haufen Leute, die mit den Genossen eine Rechnung offen hatten. »Da erzählst du mir nichts Neues, Hajo.«
»Na also. Und wo liegt dann das Problem?«
»Das Problem, junger Mann, besteht darin, dass ein Mensch zu Tode gekommen ist.«
»Schon mal was von Peter Fechter gehört, Tom?«
»Du brauchst jetzt nicht ironisch zu werden, Hajo. Ich weiß, dass die da drüben Befehl haben, auf Flüchtende zu schießen. Und ich weiß auch, wie viele Tote es seit dem Mauerbau gegeben hat. Aber ich bin dagegen, dass den Grepos mit gleicher Münze heimgezahlt wird, frei nach dem Motto: Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe. Versteh mich nicht falsch, Hajo: Ich hab die Klugscheißer von der SED gefressen, und wenn ich könnte, würde ich den ganzen Laden hochgehen lassen. ›Deutsche Demokratische Republik‹ – wenn man da nicht das Kotzen kriegt, weiß ich auch nicht mehr! Aber all das, die Mauer, das Propagandagetue, die Stasi und der Maulkorb, den sie den armen Teufeln verpasst haben, rechtfertigt nicht, dass …«
»Der Tod eines Menschen als etwas Nebensächliches hingestellt wird, ich weiß.« Marquard schüttelte missbilligend den Kopf. »Falls du es vergessen hast, Tom: Ich studiere Theologie.«
»Weißt du was, Hajo: Ich finde, es bringt nichts, wenn wir anfangen rumzudiskutieren. Erzähl mir lieber, wie es dir ergangen ist.« Die Arme vor der Brust verschränkt, drehte sich Sydow um. »Oder darf ich das nicht wissen?«
»Doch.«
»Na also – dann schieß los.«
Der Theologiestudent, nach dem sich so manche Schwiegermutter die Finger geleckt hätte, seufzte aus tiefster Seele. »Die hätten den Laden dicht machen sollen«, flüsterte er, in Gedanken bei den Ereignissen, die er vom Dachboden des Hauses in der Bernauer Straße beobachtet hatte. »Aber nein, Reino und Zobel konnten den Hals nicht voll kriegen!«
Einmal in Fahrt, war Marquard nicht zu bremsen, und da er froh war, dass er ihn so weit hatte, nahm Sydow kommentarlos Platz.
»Aber so ist es nun mal: Wenn du nicht aufpasst, kann es sein, dass du auf die Schnauze fällst. So wie Christian. Ich versteh das nicht, Tom – ehrlich. Die hätten doch merken müssen, mit wem sie es zu tun haben. Noch einem Kumpel Bescheid sagen, der rübermachen will! Eine dümmere Ausrede hab ich in meinem Leben noch nicht gehört. Zu dumm, dass ausgerechnet wir drauf reingefallen sind.« Sichtlich aufgebracht, hielt es Marquard nicht mehr auf seinem Stuhl, und er begann ruhelos hin- und herzulaufen. »57 Ost-Berliner, Männer, Frauen, Kinder – und dann so etwas! Das hältst du ja im Kopf nicht aus. Aber lassen wir das. Wo waren wir gerade stehen … genau! Ziemlich genau um halb eins kam dann Leben in die Bude. Da sind nämlich die zwei Wartburgs und eine Kradstreife aufgetaucht. Weshalb, war mir auf Anhieb klar. Dank der Gaskandelaber konnte man nämlich genug sehen. Meinen Augen getraut hab ich trotzdem nicht. Da hast du wochenlang geschuftet, tonnenweise Sand durch die Gegend gekarrt, jede freie Minute unter Tage verbracht – und dann, wenn du denkst, das Ding ist gelaufen, tauchen auf einmal die Grepos auf. Ich also nichts wie ans Funkgerät, um die Jungs am Tunnelende im Westen zu warnen. ›Erbse an Kochtopf – Gefahr im Verzug!‹
Keine Ahnung, wie wir auf derart bescheuerte Codewörter gekommen sind. Egal: Die Jungs in der stillgelegten Backstube haben die Warnung umgehend weitergegeben. Wir hatten nämlich zwei Grubentelefone, musst du wissen. Genützt hatte es leider wenig. Als die Warnung eintraf, war das Geballere bereits in vollem Gang.«