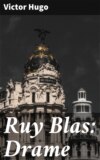Kitabı oku: «Les Misérables / Die Elenden», sayfa 6
Der Bischof fühlte, in seinem Innern eine unbeschreibliche Erschütterung.
Nach einer Pause hob der Greis einen Finger gen Himmel und sagte:
»Das Unendliche ist, dort ist es. Hätte das Unendliche kein Ich, so hätte es an dem Ich eine Beschränkung, es wäre dann nicht unendlich; anders ausgedrückt, es wäre nicht. Es ist aber. Also hat es ein Ich. Dieses Ich des Unendlichen ist Gott.«
Der Sterbende hatte die letzten Worte mit lauter Stimme gesprochen, von den Schauern der Verzückung durchbebt, als schaue er ein höheres Wesen. Als er seine Rede beendet hatte, fielen ihm die Augen zu. Die Anstrengung hatte seine Kräfte erschöpft. Augenscheinlich hatte er in einer Minute die Lebenskraft verbraucht, die sonst noch für einige Stunden gereicht hätte. Was er soeben gesagt, hatte ihn dem nahe gebracht, der in dem Tode ist. Sein letzter Augenblick kam heran.
Der Bischof begriff dies, die Zeit drängte, als Priester war er doch gekommen. Die ursprüngliche Abneigung war allmählich in das entgegengesetzte Extrem, in die tiefste Rührung übergegangen; er blickte auf die geschlossenen Augen, die eiskalte runzlige Hand des Sterbenden und beugte sich zu ihm nieder:
»Dies ist die Stunde Gottes. Nicht wahr, es wäre bedauerlich, wenn wir umsonst zusammengekommen wären?«
Der Sterbende schlug die Augen auf. Auf seinem Antlitz lag ein Ausdruck von würdevollem Ernst, aber mit einem Anflug von Mißmuth.
»Herr Bischof,« sagte er und seine Worte kamen langsam hervor, wohl mehr vom Gefühl seiner Würde getragen, als weil seine Kräfte ihn verließen, »mein ganzes Leben war dem Studium und der Betrachtung geweiht. Ich war sechzig Jahre alt, als mein Vaterland mich rief und mir befahl, mich mit seinen Angelegenheiten zu beschäftigen. Ich gehorchte. Es bestanden Mißbräuche, ich habe sie bekämpft; Unterdrückung, ich habe sie beseitigt; Rechte und Grundsätze, ich habe mich ihrer angenommen. Feindliche Armeen drangen in Frankreich ein, ich wagte mein Leben um es zu vertheidigen. Ich war nicht reich und bin arm geblieben. Ich war einer der Herren des Staates, die Keller des Schatzes waren mit Gold und Silber erfüllt, so daß die Mauern gestützt werden mußten, – ich speiste in der Rue de l'Arbre-Sec für zweiundzwanzig Sous. Ich habe die Unterdrückten befreit und den Unglücklichen geholfen. Ich habe Altartücher zerrissen, aber nur um die Wunden des Vaterlands zu verbinden. Ich habe immer den Drang des Menschengeschlechts nach dem Lichte unterstützt und bisweilen mich dem Fortschritt entgegengestemmt, wenn er kein Erbarmen hatte. Ich habe gelegentlich meine Feinde, Euch Priester, beschützt. Da ist zu Petegsem in Flandern, an demselben Ort, wo die merowingischen Könige ihren Winterpalast hatten, ein Urbanistinnenkloster, die Abtei der heiligen Klara, die ich 1793 gerettet habe. Ich that meine Pflicht nach Maßgabe meiner Kräfte und so viel Gutes, wie ich konnte. Nachher bin ich verbannt, gehetzt, verfolgt, drangsalirt, verleumdet, verhöhnt, verflucht, proskribirt worden. Seit Jahrzehnten sehe ich, daß viele Leute mit Verachtung auf mich herabsehen, die arme unwissende Menge sieht auf meinem Gesicht Merkzeichen künftiger Verdammniß und ich ertrage, ohne zu hassen die Einsamkeit eines allgemein Gehaßten. Jetzt bin ich sechsundachtzig Jahre alt und im Begriff zu sterben. Was wollen Sie nun von mir!«
»Ihren Segen,« bat der Bischof und kniete nieder.
Als er den Kopf wieder aufrichtete, hatte das Gesicht des ehemaligen Conventsmitgliedes einen erhabenen Ausdruck angenommen. Er war verschieden. Der Bischof ging nach Hause, tief in Gedanken versunken und brachte die ganze Nacht im Gebet zu. Am nächsten Tage versuchten einige neugierigen Leutchen ihn über das Conventsmitglied G. auszufragen, aber statt aller Antwort zeigte er nach dem Himmel. Von derselben Zeit an bezeigte er den kleinen Leuten und den Unglücklichen noch einmal so viel Sanftmuth und Mildthätigkeit.
Jede Anspielung auf den »alten Halunken« den G. versetzte ihn in eigentümlich tiefes Nachdenken. Niemand weiß zu sagen, ob nicht die Begegnung mit einem weisen und edlen Manne von anderer Sinnesart, als der seinigen, ihn in seinem Streben nach Vollkommenheit bestärkte.
Natürlich gab dieser »Seelsorgerbesuch« Anlaß zu allerlei Gerede:
»Gehört denn ein Bischof an das Sterbebette eines solchen Menschen hin? Augenscheinlich stand eine Bekehrung ja doch nicht zu erwarten. Die Revolutionäre sind insgesammt rückfällig. Warum ist er also zu ihm gegangen? Was hatte er bei ihm zu suchen? Ist er denn so neugierig, daß er durchaus einmal dabei sein mußte, wenn der Teufel eine Seele holt?«
Eines Tages schoß eine alte Schachtel, eine von jenen, die ihre Ungezogenheit für Witz halten, folgende Bosheit auf ihn ab:
»Alle Welt ist neugierig, wann Ew. Bischöfliche Gnaden die rothe Mütze bekommen werden.«
»Oh, oh,« versetzte er, »das ist eine schlimme Farbe. Glücklicherweise achten Diejenigen sie, die sie an einer Mütze hassen, desto mehr an einem Hute.«
XI. Eine Einschränkung
Man würde sich sehr täuschen, wenn man aus dem eben Erzählten schließen wollte, unser Bischof sei ein Philosoph oder ein »patriotischer Landgeistlicher« gewesen. Seine Begegnung mit dem Conventsmitgliede G. hinterließ bei ihm eine Art tiefes Erstaunen, das ihn noch weicher stimmte. Weiter nichts.
Obgleich Se. Gnaden Herr Bienvenu nichts weniger, als ein Politiker gewesen ist, ist hier vielleicht der Ort in aller Kürze anzugeben, wie er sich zu den Ereignissen der damaligen Zeit gestellt hat, vorausgesetzt, daß es. Se. Gnaden Herrn Bienvenu überhaupt beigefallen ist, Stellung zu irgend etwas zu nehmen.
Gehen wir also einige Jahre zurück. Kurze Zeit nach seiner Berufung zum Bischof hatte ihn der Kaiser zum Baron gemacht, zugleich mit mehreren andern Bischöfen. Bekanntlich fand die Verhaftung des Papstes in der Nacht vom 5. zum 6. Juli 1809 statt, und bei dieser Gelegenheit wurde Myriel von Napoleon in die zu Paris versammelte Synode der französischen und italienischen Bischöfe berufen. Diese Synode hielt ihre erste Sitzung am 15. Juni 1811 in der Notredame-Kirche unter dem Vorsitz des Kardinals Fesch. Myriel gehörte zu den Bischöfen, die an dieser Sitzung teilnahmen. Abgesehen von dieser, wohnte er nur noch drei oder vier Konferenzen bei. Als Bischof einer armseligen Gebirgs-Diöcese, der auch selber arm und schlichten Herzens war, brachte er Ideen mit, welche die hohen Herren unangenehm berührten. Er kam sehr bald nach Digne zurück. Wegen seiner eiligen Rückkunft befragt, antwortete er: »Ich war ihnen lästig. Ich brachte Luft von der Außenwelt mit, und kam ihnen vor, wie eine offen stehende Thür.«
Ein anderes Mal bemerkte er: »Die Herren sind Fürsten und ich bin ein armer Bauernbischof.«
In der That hatte er mißfallen. So war ihm u. a., als er sich eines Abends bei einem seiner vornehmsten Kollegen zu Besuch befand, die Aeußerung entschlüpft: »Was für schöne Uhren! Was für schöne Teppiche! Und die Livreen! Solch ein Luxus muß recht lästig sein! Dergleichen Ueberflüssigkeiten möchte ich nicht haben: Sie würden mir immer in die Ohren schreien: Es giebt Menschen, die hungern! Es giebt Menschen, die frieren! Es giebt Arme, Arme!«
Beiläufig gesagt, wäre der Haß des Luxus kein verständiger Haß. Solch ein Verdammungsurtheil würde auch die Künste treffen. Aber bei den Dienern der Kirche ist, abgesehen von der Repräsentation und dem Gottesdienst, der Luxus tadelnswerth. Er ist mit jeder umfassenderen Mildthätigkeit unvereinbar. Ein reicher Priester ist eine contradictio in adjecto. Der Priester soll Verkehr haben mit den Armen. Wie kann man aber unaufhörlich, Tag und Nacht in Berührung kommen mit allerlei Noth und Unglück und Dürftigkeit, ohne daß etwas von diesem Elend haften bleibt, wie Staub an dem Arbeiter? Kann man sich einen Menschen vorstellen, der bei einem Becken voll glühender Kohlen steht, und dem nicht warm ist? Kann man sich einen Arbeiter denken, der fortwährend bei einem Hochofen arbeitet, und dem nie ein Haar verbrannt, ein Nagel geschwärzt wird, dem nie Schweiß die Stirn feuchtet, dem kein Körnchen Asche ins Gesicht fliegt? Der Hauptbeweis einer wahrhaft mildthätigen Gesinnung ist bei einem Geistlichen die Armuth.
So dachte ohne Zweifel der Bischof von Digne.
Man glaube übrigens nicht, daß er über gewisse heiklige Fragen die Ideen seiner Zeit theilte. Er mischte sich wenig in die damaligen theologischen Streitigkeiten und äußerte sich nicht über das Verhältnis der Kirche zum Staat; hätte man aber nachdrücklich in ihn gedrungen, so würde es sich wohl herausgestellt haben, daß er mehr zum Ultramontanismus, als zum Gallikanimus hinneigte. Da wir eine getreue Schilderung entwerfen und nichts Wahres verhehlen mögen, so müssen wir eingestehen, daß Napoleons Niedergang ihn mehr als kühl ließ. Von 1813 an unterstützte er alle oppositionellen Kundgebungen durch seine persönliche Betheiligung oder mit seinem Beifall. Als der Kaiser von der Insel Elba zurückkehrte, lehnte es der Bischof ab ihm seine Aufwartung zu machen und während der Hundert Tage in den Kirchen für ihn beten zu lassen.
Er hatte noch an Geschwistern, außer seiner Schwester, zwei Brüder, von denen der Eine General, der Andere Präfekt war und mit denen er einen ziemlich lebhaften Briefwechsel unterhielt. Mit dem Ersteren nun brach er auf einige Zeit alle Beziehungen ab, weil der General nach der Landung Napoleons in Cannes sich an der Spitze von zwölfhundert Mann aufgemacht hatte, den Kaiser zu verfolgen, aber mit der Absicht ihn entwischen zu lassen. Mit dem andern Bruder, dem ehemaligen Präfekten, der zu Paris in Zurückgezogenheit lebte, blieb er in besserem Einvernehmen.
Unser Bischof hatte folglich auch eine Zeit, wo er in das politische Parteigetriebe verwickelt war und infolge dessen auch manche trübe Stunde. Auch auf seinen Pfad warfen die wild erregten Leidenschaften seiner Zeit ihren Schatten und störten ihn in seiner Betrachtung der ewigen Dinge. Gewiß hätte es ein solcher Mann verdient, daß ihm zu seinen vielen Vorzügen auch der zu Theil geworden wäre, keine politischen Meinungen zu haben. Man mißverstehe uns nicht: Wir verwechseln keineswegs was man politische Meinungen nennt, mit jenen begeisterten Fortschrittsbestrebungen, jenem idealen Glauben an das Vaterland, die Demokratie und die Menschheit, auf dem alle hochsinnig veranlagten Naturen unserer Zeit fußen. Ohne Fragen erörtern zu wollen, die zu dem Thema unseres Buches in keiner direkten Beziehung stehen, behaupten wir nur, es wäre schön gewesen, hätte unser Bischof nicht royalistische Politik getrieben und seinen Blick keinen Augenblick von jenen hehren Regionen ruhevoller Betrachtung abgewendet, wo hoch erhaben über dem stürmischen Wirrwarr der menschlichen Dinge, in reinem Glanze, die Wahrheit Gerechtigkeit und Liebe strahlen.
Wir geben ja zu, daß Gott den Bischof Bienvenu nicht für eine politische Laufbahn bestimmt hatte, hätten es aber begriffen und bewundert, wenn er im Namen des Rechtes und der Freiheit, als Napoleon auf dem Gipfel seiner Macht stand, sich zu freimüthigem Tadel und mannhaftem Widerstand erkühnt hätte. Aber dasselbe Verfahren, das einem Mächtigen gegenüber berechtigt ist, mißfällt uns, wenn es gegen eine gefallene Größe eingeschlagen wird. Wir billigen nur die Auflehnung, so lange sie mit Gefahr verbunden ist, und in allen Fällen steht nur Denen, die zu Anfang lauten Einspruch erhoben und sich zum Kampf ermannt haben, das Recht zu, nachher das Richteramt zu übernehmen und das Urtheil zu vollstrecken, den Feind zu vernichten. Wir persönlich glauben, daß von der Zeit an, wo die Vorsehung sich gegen Napoleon erklärte, jede Opposition gegen ihn aufhören mußte. Schon Angesichts des Unterganges der Großen Armee im Jahre 1812 fühlen wir uns ihm gegenüber entwaffnet. Daß 1813 der gesetzgebende Körper, kühn gemacht durch diese Katastrophe, sein langjähriges feiges Stillschweigen brach, kann nur unseren Unwillen erregen und dieses Verhalten zu billigen, war ungeziemend. 1814, als die Marschalle ihren Kaiser verriethen, als der Senat sich in Erbärmlichkeiten nicht genug thun konnte, als er von der Vergötterung zur Beschimpfung überging, als die Götzendiener, von feiger Angst befallen, ihren Götzen anspieen, war es Pflicht, Abscheu zu bezeigen. 1815, als die Endkatastrophe schon in der Luft schwebte, als ganz Frankreich wie von einem Vorgefühl des Verhängnisses ergriffen war, als man schon Waterloo und Napoleons Sturz in den Abgrund ahnen konnte, da hatte die Begeisterung des Heeres und des Volkes für den vom Schicksal aufgegebenen Kaiser Nichts, was eine Veranlassung zu lachen bot, und bei allem Vorbehalt gegen den Despotismus, hätte das edle Gemüth des Bischofs von Digne vielleicht nicht verkennen sollen, was der Bund einer großen Nation und eines großen Mannes Angesichts des Abgrunds Erhabenes und Rührendes hat.
Abgesehen hiervon war er und benahm er sich in allen Dingen gerecht, wahr, billig, weise, bescheiden und würdevoll; wohlthätig und wohlwollend, was ja übrigens nur eine andere Form der Wohlthätigkeit ist. Er war ein rechter Priester, ein Philosoph und ein Mann. Selbst als Politiker war er – so sehr wir seine Haltung Napoleon gegenüber mißbilligen – duldsam und nachsichtig, vielleicht mehr als wir, die wir dieses mittheilen. – Der Kastellan des Rathhauses verdankte seine Anstellung dem Kaiser. Der Mann war ein alter Gardeunteroffizier, der sich das Kreuz der Ehrenlegion bei Austerlitz verdient hatte und ein verbissener Bonapartist. Dem armen Kerl entschlüpften hier und da unbedachte Aeußerungen, die das damalige Gesetz als aufrührerische Reden qualifizirte. Seitdem die Abzeichen der Ehrenlegion nicht mehr das Bildniß seines Kaisers trugen, zeigte er sich nie in Uniform, um nicht den Orden auch anlegen zu müssen. Er hatte selber mit aller Ehrerbietung das Bildniß aus dem Kreuz, das ihm Napoleon gegeben, herausgenommen und nie die drei Lilien an seine Stelle setzen wollen. »Eher sterben«, schwur er, »als die drei Kröten auf meinem Herzen tragen.« Er machte sich auch ganz laut über Ludwig XVIII. lustig. »Wenn doch der alte Podagrist sammt seinen englischen Gamaschen und seinem Zopf nach Preußen gehen möchte!« ulkte er, indem er in seine Verwünschung des Bourbonen das, was er am meisten auf der Welt haßte, Preußen und England hereinzog. Er trieb es so arg, daß er seine Stelle verlor und nun mit Weib und Kind dem größten Elend ausgesetzt war. Da ließ der Bischof ihn zu sich kommen, schalt ihn milde aus und stellte ihn als Thürhüter am Dom an.
In neun Jahren war unser Bischof dank seiner frommen Mildthätigkeit und seinem sanftmüthigen Wesen in der Stadt Digne ein Gegenstand inniger, kindlicher Verehrung geworden. Sogar sein Verhalten gegen Napoleon verzieh das gute schwache Volk, das seinen Kaiser vergötterte, aber andererseits auch seinen Bischof liebte.
XII. Warum der Bischoff allein stand
Ein Bischof ist fast immer von einem Schwarm junger Geistlicher umdrängt, wie ein General von jungen Offizieren. Hat doch jedes Fach seine Streber, die sich um die am Ziel Angelangten schaaren. Kein Mächtiger, der nicht sein Gefolge; kein Glücklicher, der nicht seinen Hof hätte. Alle, die sich eine glänzende Zukunft schaffen wollen, gravitieren um eine glänzende Gegenwart. Jeder einigermaßen einflußreiche Bischof hat in seiner Nähe einen Trupp Seminaristen, die um ihn patrouilliren und darüber wachen, daß die Huld Sr. Gnaden keinen Andern, als ihnen zu Theil werde. Einem Bischof gefallen, verleiht die Anwartschaft auf das Unterdiakonat. Man will emporkommen; und eine fette Pfründe ist eine schöne Sache.
Wie unter den Beamten des Staates, so giebt es auch unter denen der Kirche, unter den Bischöfen solche, die über einen größeren Einfluß zu verfügen haben, als ihre Kollegen, diese Herren sind reich, gewandt, bei Hofe und in der höhern Gesellschaft gern gesehen, verstehen wohl zu Gott zu beten, aber auch die Großen dieser Welt zu bitten, die Vertretern ganzer Diöcesen nicht gern etwas abschlagen. Solche Bischöfe sind gewissermaßen Bindestriche zwischen der Kirche und der Diplomatie, mehr Welt- als Kirchenfürsten. Wohl Denen, die in ihrer Nähe weilen dürfen! Einflußreich wie sie sind, lassen sie auf ihre Günstlinge, auf all die jungen Priester, die sich bei ihnen einzuschmeicheln verstehen, einträgliche Pfarreien, Archidiakonate, Almosenämter und andere üppige Stellen und Stipendien niederregnen und ebnen für sie den Anfang des Pfades, der zur Bischofswürde führt. Indem sie selber vorrücken, fördern sie auch ihre Trabanten, wie eine Sonne mit ihren Planeten durch das Weltall vorwärts, immer vorwärts wandert. Das Licht, das sie von sich strahlen, beleuchtet ihr Gefolge im Verhältnis zu seiner Stärke: Je großer die Diöcese des Gebieters, desto einträglicher fällt die Pfarre des bevorzugten Dieners aus. Und nun erst Rom! Nimmt dich ein Bischof, der so gescheidt ist, sich zum Erzbischofsthron emporzuschwingen, oder ein Erzbischof, der es bis zum Kardinal gebracht, nach Rom als Conclavisten mit, so wird man in die Rota gewählt und bekommt das Pallium, wird Kammerherr und heißt »Monsignore«. Wer erst Se. Bischöfliche Gnaden heißt, steigt bald zur »Eminenz« empor, und zwischen Sr. Eminenz und Sr. Heiligkeit liegt auch nur eine Abstimmung. Kurz, jedes Priesterkäppchen kann gegen die Tiara eingetauscht werden. Der Priester ist heutzutage der Einzige, der regelrecht König werden kann, und was für ein König! Der oberste von allen Königen. Welch eine Pflanzschule von Hoffnungen ist daher auch ein Priesterseminar! Wieviel schüchterne Chorknaben, wieviel junge Abbés tragen auf ihrem Kopfe den berühmten Topf Milch des Märchens, den sie allmählich in Gedanken gegen immer theurere Waaren eintauschen! Wie leicht giebt sich der Ehrgeiz, – oft indem er in seliger Selbstbetrachtung sich zuerst täuscht – für edle Begeisterung aus!
Se. Gnaden Herr Bienvenu wurde wegen seiner Bescheidenheit, Armuth, Originalität nicht zu den Magnaten der Kirche gezählt. Das bekundete der Umstand, daß es in seiner Umgebung an jungen Priestern fehlte. Er hatte, wie oben erwähnt, in Paris mißfallen. Niemandem fiel es ein, diesen Alten als Edelreis zu benutzen, um damit den Baum seines Glückes zu occuliren. Niemand redete sich ein, daß unter solch einem Schatten das Pflänzlein des Ehrgeizes gedeihen könne. Seine Kanoniker und Großvikare waren gute, simple Leute wie er, denen die Diöcese keinen Ausweg, auf das Kardinalat bot, die am Ende ihres Weges angelangt waren, aber nicht wie er, ein schönes Ziel erreicht hatten. Daß der Bischof Bienvenu Niemand auf einen grünen Zweig bringe, war auch allgemein bekannt, und die von ihm geweihten jungen Priester verschafften sich deshalb, sobald sie das Seminar verlassen hatten, Empfehlungen an den Erzbischof von Aix oder Auch, worauf sie alsbald aus seinem Gesichtskreis verschwanden. Ein Heiliger, der an chronischer Selbstverleugnung leidet, ist ein gefährlicher Nachbar. Wie leicht steckt er Einen an! Er inficirt Einen mit einer unheilbaren Armuth, einer Rückensteife, die beim Vorwärtskommen sehr hinderlich werden kann. Deshalb wurde denn auch unser Bischof allgemein gemieden. Wir leben in einer argen Zeit. »Dränge dich empor!« heißt die Lehre, die sie uns auf Schritt und Tritt zuschreit.
Beiläufig gesagt, der Erfolg ist ein gräuliches Ding. Seine Ähnlichkeit mit dem Verdienst täuscht die Menschen. Für die große Menge hat ein glücklicher Mensch dasselbe Profil wie ein genialer. Daher ist es auch dem Erfolge, dem Zwillingsbruder des Talents gelungen, die Geschichte hinter das Licht zuführen, wogegen nur Juvenal und Tacitus zu protestiren gewagt haben. Zu unsrer Zeit ist eine beinah offizielle Philosophie in seinen Dienst getreten, trägt seine Livree und hantirt in seinem Vorzimmer. Ihre Theorie lautet: Sorge dafür, daß Du Glück hast. Bist Du glücklich, so ist das ein Beweis, daß Du Tüchtigkeit besitzest. Gewinne daß große Loos, so giltst du alsbald für einen gescheidten Mann. Wer triumphirt, wird geachtet. Wer »Schwein« hat, der hat Alles. Hast Du Erfolg, so bist Du ein großer Mann. Abgesehen von fünf oder sechs glänzenden Ausnahmen in einem Jahrhundert, ist die Bewunderung der Zeitgenossen eine kurzsichtige. Was nur obenhin leicht vergoldet ist, hält sie für massives Edelmetall. Der erste Beste ist der Beste, wenn er nur der Glücklichste ist. Der gemeine Haufe ist ein Narciß, der sich selbst bewundert und das Gemeine lobt. Jene großartige Tüchtigkeit, kraft deren Einer ein Moses, Aeschylus, Dante, Michel-Angelo, oder Napoleon wird, spricht die Menge ohne Weiteres Jedem zu, der in irgend einem Fache sein Ziel erreicht. Schwingt sich ein Notar zum Volksvertreter empor, schreibt ein Pseudo-Corneille einen »Tiridates«, legt sich ein Eunuch einen Harem zu, gewinnt ein unfähiger General durch einen Zufall eine Entscheidungsschlacht, liefert ein Apotheker einem Armeekorps Pappsohlen und erschwindelt er damit ein jährliches Einkommen von viermalhunderttausend Franken, legt sich ein Hausirer auf den Wucher und verdient er damit sieben oder acht Millionen, näselt ein Prediger so erbaulich, daß er höhern Ortes eines Bischofsthrons für würdig erachtet wird, ist ein Intendant, wenn er seinen Dienst quittirt, so reich, daß er Finanzminister werden kann, so nennen die Menschen das Genie, und verwechseln so zu sagen die Sterne, die Entenfüße in weichem Erdreich hinterlassen, mit den Sternen, die am Himmel prangen.