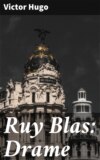Kitabı oku: «Les Misérables / Die Elenden», sayfa 7
XIII. Sein Glaubensbekenntiß
Zu untersuchen, ob der Bischof von Digne auch den von der Kirche vorgeschriebnen Glauben besaß, kommt uns nicht zu. Einem so hochsinnigen Manne gegenüber ist ein andres Gefühl, als das der Hochachtung nicht am Platze. Dem Gerechten soll man auf sein Wort glauben. Uebrigens geben wir zu, daß alle Schönheiten menschlicher Vortrefflichkeit auch innerhalb eines von dem unsrigen verschiednen Glaubens die herrlichsten Blüthen entfalten können.
Was er von diesem Dogma und jenem Mysterium hielt? Dergleichen Geheimnisse des innern Bewußtseins kennt nur das Grab, in dem die Seelen ohne Hülle sind. So viel ist sicher, nie lösten sich für ihn Glaubensschwierigkeiten in Heuchelei auf. Der Fäulniß ist der Diamant nicht fähig. Er glaubte, so gut er konnte. »Ich glaube an den Vater!« rief er oft aus und schöpfte im Uebrigen aus den Werken der Liebesthätigkeit dasjenige Quantum von Befriedigung, das dem Gewissen genügt und uns die Ueberzeugung gewährt, daß Gott auch mit uns zufrieden ist.
Bemerken müssen wir wohl, daß der Bischof so zu sagen, abgesehen von seinem Glauben, und über seinen Glauben hinaus, ein Uebermaß von Liebe hatte. Dies war seine verwundbare Stelle, quia multum amavit, diejenige, auf die von den »gesetzten«, den »anständigen«, den »vernünftigen«, Leuten hingewiesen wurde, – so lauten ja die Lieblingsphrasen, die der Egoismus einer pedantischen Philosophie entlehnt. Was war jenes Uebermaß von Liebe? Ein heitres Wohlwollen, das nicht blos die Menschen umfaßte, sondern sich auch gelegentlich auf Dinge erstreckte. Ihm war nichts zu gering. Er war nachsichtsvoll gegen Gottes Geschöpfe. Jeder, auch der beste Mensch besitzt eine unbewußte Härte, die er nur den Thieren gegenüber zum Ausbruch kommen läßt. Der Bischof von Digne hatte diese Art Härte nicht, die sich doch viele Priester gestatten. Er ging in dieser Hinsicht nicht so weit, wie die Brahmanen, hatte aber den Ausspruch des Prediger Salomo beherzigt, der da lautet: »Weiß man, was nach dem Tode aus den Seelen der Thiere wird?« Das häßliche Aussehen mancher dieser Geschöpfe, ihre Grausamkeit und Wildheit machte ihn nicht irre und verdrossen ihn nicht. Er betrachtete sie mit Bedauern, ja mit Wehmuth. Dergleichen Erscheinungen regten ihn zu tiefem Nachdenken an, er wäre gern über diese sinnfälligen Aeußerlichkeiten hinaus zu ihrer Endursache, ihrer Erklärung oder moralischen Rechtfertigung vorgedrungen. Es war, als bete er zuweilen, Gott möge doch dergleichen Geschöpfe ändern, verbessern. Er prüfte ohne Zorn und mit der mühseligen Sorgfalt eines Sprachforschers, der einen Palimpsest entziffert, den Ueberrest von Unordnung und Verwirrung, der noch in der Natur vorhanden ist. Dergleichen Betrachtungen entlockten ihm oft sonderbare Aeußerungen. Eines Morgens z.B., als er in seinem Garten allein zu sein glaubte, aber von seiner Schwester beobachtet wurde, blieb er plötzlich stehen und beobachtete eine große, schwarze, haarige, abscheuliche Spinne, die an der Erde kroch. »Armes Thier!« hörte ihn da seine Schwester vor sich hinrufen; »es ist ja doch nicht ihre Schuld.«
Warum auch nicht solcher kindlichen Äußerungen einer fast göttlichen Güte Erwähnung thun? Nenne man dergleichen kindlich; aber solche Kindlichkeiten verbrach auch ein Franz von Assisi und ein Mark-Aurel. Eines Tages verrenkte er sich den Fuß, weil er nicht auf eine Ameise, die auf seinem Wege kroch, treten wollte.
So lebte dieser gerechte Mensch. Bisweilen geschah es, daß er in seinem Garten einschlief, und dann mußte Jeder bekennen, daß er noch nie einen so unvergleichlich ehrwürdigen Anblick gehabt hatte.
Unser Bischof war ehedem, wenn man den Erzählungen über seine Jugend und sogar sein Mannesalter Glauben schenken durfte, von leidenschaftlicher, ja heftiger Gemüthsart gewesen. Seine Milde war also weniger ein Geschenk der Natur als das Ergebniß zahlreicher Wahrnehmungen und Urtheile, die im Laufe der Zeit, wie Wassertropfen durch einen Felsen, sich Wege in sein Inneres gebahnt. Solche, durch allmähliche Arbeit langsam ausgehöhlte Rinnen bleiben bestehen.
Im Jahre 1815 war er, wie wir schon mitgetheilt zu haben glauben, fünfundsiebzig Jahre alt, allein man hätte ihn auf sechzig geschätzt. Er war nicht groß und etwas beleibt. Um letzteres Uebel zu bekämpfen ging er viel zu Fuß, auch trat er fest auf und seine Gestalt war nur wenig gebeugt durch die Jahre. Hieraus mögen wir allerdings keine Schlüsse ziehen, denn Gregor XVI. hatte noch im Alter von achtzig Jahren eine sehr gerade Haltung und Freude am Dasein, dies hinderte ihn aber nicht ein schlechter Priester zu sein. Se. Gnaden Herr Bienvenu war eine angenehme Erscheinung, angenehm besonders wegen der Liebenswürdigkeit, die sich in ihr ausprägte.
Plauderte er mit jener ihm so wohl anstehenden kindlichen Fröhlichkeit, die wir schon an ihm gerühmt haben, so schien sein ganzes Wesen Freude auszustrahlen. Mit seiner gesunden frischen Gesichtsfarbe, seinen hübschen, noch gut erhaltenen Zähnen, sah er dann recht treuherzig, bieder, gemüthlich aus, so daß Jeder, der ihn zuerst sah, einfach sagte: »Das muß ein guter Kerl, eine gute alte Seele sein.« Auch Napoleon hatte ihn ja »einen guten Mann« genannt. Verweilte man aber mehrere Stunden in seiner Nähe und war man dabei, wenn er nachdenklich wurde, so ging mit dem »guten Mann« eine Umwandlung vor; seine äußere Erscheinung wurde ehrfurchtgebietend und majestätisch, ohne daß der Ausdruck der Güte von ihm gewichen wäre: man hatte dann die Empfindung, als sehe man einen lächelnden Engel seine Flügel ausbreiten. Ein unbeschreibliches Gefühl der Hochachtung erfüllte dann allmählich das Herz des Beobachters. Man wurde dann inne, daß man einem Manne von gewaltigem Verstande gegenüber stand, einem Manne, der die höchsten Stufen der Erkenntnis erklommen hat, einem Manne, der da weiß, daß die Wahrheit nur der Liebe und Nachsicht zugänglich ist.
Wie man gesehen hat, füllten Gebet, seine Amtspflichten, Almosengeben, die Tröstung der Leidbedrückten, die Gärtnerei, Liebeswerke, Frugalität, Gastfreundschaft, Entsagung, Studium, Arbeit jeden seiner Tage aus. Füllten aus, sagten wir, denn übervoll war solch ein Tag an guten Gedanken, Worten und Werken. Indessen galt er ihm noch nicht für vollständig ausgenutzt, wenn ihn des Abends, nachdem die beiden Frauen sich zur Ruhe begeben hatten, feuchte oder kalte Witterung hinderte, noch eine oder zwei Stunden in seinem Garten zuzubringen. Es war ihm ein Bedürfniß sich Angesichts des Sternenhimmels der Betrachtung hinzugeben, um sich zum Schlaf vorzubereiten. Bisweilen hörten die beiden Frauen, wenn sie wach geblieben waren, noch spät in der Nacht seinen Schritt in den Alleen des Gartens. Allein mit seinen Gedanken, andächtig, friedevoll empfand er da in der Dunkelheit die sichtbare Herrlichkeit der Gestirne und die unsichtbaren Herrlichkeiten Gottes und ließ die Gedanken, die dem Unbekannten entströmen, in seine Seele ein. In solchen Augenblicken, wo die Nachtblumen ihren Kelch aufthun, ihren Duft auszuhauchen, bot auch er sein Herz dar, wie eine Lampe inmitten der Sternennacht und ergab sich der Begeisterung. Er hätte dann selbst nicht sagen können, was in seinem Geiste vorging, er fühlte blos, daß etwas von ihm ausging, und daß etwas in ihn herniederstieg. O des geheimnißreichen Verkehrs zwischen den Tiefen der Seele und des Weltalls! Sein Geist beschäftigte sich mit Gottes Größe und Gegenwart, mit dem wunderbaren Geheimniß der zukünftigen Ewigkeit und dem noch wunderbarern der Vergangenheit; mit all den Unendlichkeiten, die sich nach allen Richtungen seinen Augen darboten, und schaute, ohne das Unbegreifliche begreifen zu wollen. Er suchte nicht das Wesen Gottes mit dem Verstande zu erfassen, er versenkte sich in Entzückung um seiner theilhaftig zu werden. Er erwog die Zusammenstöße der Atome, die dem Stoff die Form verleihen, Kräfte offenbaren, Individuen in der Einheit, Proportionen im Raum, das Unzählbare im Unendlichen schaffen und mittelst des Lichtes die Schönheit hervorbringen. Diese Vereinigungen finden ohne Unterlaß statt und lösen sich wieder auf; daher der Ursprung des Lebens und des Todes.
Er setzte sich auf eine Holzbank, deren Lehne ein altersschwaches Gitter berührte und betrachtete die Gestirne durch die Laubkronen seiner armseligen Obstbäumchen. Dieses so dürftig bepflanzte, durch unschöne Gebäude und Schuppen eingeengte Stückchen Erde war ihm theuer und genügte ihm.
Was bedurfte dieser Greis auch mehr? War dieser enge Raum, den oben der Himmel überwölbte, nicht groß genug um Gott in seinen erhabensten Werken anbeten zu können? Ist dies nicht das Wichtigste, und wozu noch mehr begehren? Ein Gärtchen zum Spazierengehn und die Unendlichkeit als Spielraum für seine Gedanken! Vor den Füßen etwas zu pflegen und zu pflücken, über dem Haupte Stoff zu Studien und Betrachtungen; auf der Erde einige Blumen und am Himmel alle Sterne!
XIV. Seine Philosophie
Noch ein Wort.
Vielleicht verleiten einige der von uns angeführten Einzelheiten Manchen zu dem Schlusse, der Bischof von Digne sei ein Pantheist gewesen und habe sich, wie viele andre unsrer Zeitgenossen, eine Privatphilosophie für seinen eignen Gebrauch zurecht gemacht, die bei ihm die Stelle der Religion vertreten hätte. Solchen Vermuthungen gegenüber betonen wir, daß Niemand, der Herrn Bienvenu gekannt hat, eine solche Annahme für gerechtfertigt gehalten hätte. Dieser Mann regelte sein Denken nur nach den Eingebungen seines Herzens.
Kein System, nur Werke. Dem menschlichen Verstand, der sich mit tiefsinnigen Spekulationen über die Natur der Dinge befaßt, schwindelt leicht, und nichts deutet darauf hin, daß unser Bischof sich gern in apokalyptischen Räthseln ergangen habe. Ein Apostel darf kühn sein, einem Bischof geziemt Zurückhaltung. Er hätte wahrscheinlich Bedenken getragen, die, so zu sagen nur den übermenschlich veranlagten Geistern vorbehaltne Lösung gewisser Aufgaben zu unternehmen. Wohl stehen die Thore offen, aber den gewöhnlichen Wanderer durchschauert bei ihrem Anblick ein Schrecken, der ihn zurücktreibt. Wehe dem, der sich hineinwagt! Nur das Genie erhebt sich mittels der Abstraktion und des reinen Denkens über die Höhen des Dogmas und fragt Gott mit dem Gebet. Dies ist unvermittelte Religion; wer ihre steilen Höhen zu erklimmen wagt, der übernimmt schwere Verantwortlichkeit und qualvolle Sorgen.
Die innere Betrachtung achtet keiner Schranken. Sie unterfängt sich in ihre eignen Tiefen zu dringen und sendet das Licht, das sie dort findet, in die Natur hinauf. Die geheimnisvolle Welt, die uns umgiebt, erstattet, was sie empfangen, zurück. Es ist wahrscheinlich, daß die Betrachter betrachtet werden. Wie dem auch sei, es giebt auf der Erde Menschen, – wenn wir sie noch so nennen können, – die fern am Horizont des Ideals die Höhen des Absoluten schauen. Unser Bischof gehörte nicht zu diesen Menschen, er war kein Genie. Er wäre vor jenen Höhen zurückgeschreckt, von denen Einige, darunter recht große Geister, wie Swedenborg und Pascal, in die Tiefen des Wahnsinns hinabstürzten. Allerdings haben dergleichen großartige Träumereien ihren moralischen Nutzen und auf diesen steilen Pfaden steigt man zur idealen Vollkommenheit empor. Aber der Bischof schlug einen kürzern Weg ein, denjenigen, den das Evangelium zeigt.
Er hüllte sich nicht in den Mantel des Elias, beleuchtete nicht die Ereignisse der dunkeln Zukunft und war weder Prophet noch Magier. Er liebte, und dies genügte seinem bescheidenen Sinne.
Daß er das Gebet über das allgemein menschliche Maß ausdehnte, ist wahrscheinlich; aber man kann eben so wenig zu viel beten, als zu viel lieben, und wenn es eine Ketzerei wäre, anders zu beten, als die Bücher es vorschreiben, so müßte man die heilige Theresa und den heiligen Hieronymus Ketzer nennen.
Er ließ sich mitleidig herab zu Denen, die da seufzen zu Denen, die da büßen. Das Weltall erschien ihm wie ein großer Körper, der voller Krankheit ist. Ueberall Fieber, überall Schmerzen! Aber er versuchte nicht das Wesen der Krankheit zu ergründen, er bemühte sich nur, sie zu heilen. Das furchtbare Schauspiel der erschaffenen Dinge stärkte in ihm den Trieb des Mitleids. Er sann nun auf Mittel, wie er Unglückliche am trostreichsten beklagen, wie er ihr Leid am wirksamsten lindern, und wie er auch Andere diese Weisheit lehren könne. Alles, was da ist, war für diesen guten und seltenen Priester ein Gegenstand der Trauer, die nach Trost verlangt.
Es giebt Menschen, die sich mit der Gewinnung des Goldes aus den Tiefen der Erde beschäftigten. Er beschäftigte sich mit der Gewinnung des Mitleids aus den Tiefen des menschlichen Herzens. Das allgemeine Elend war der Schacht, in dem er arbeitete. Angesichts des großen Jammers, der überall herrscht, verwies er nur auf den Spruch: »Kindlein, liebet Euch unter einander.« In diesem Spruch war für ihn alle Weisheit enthalten. Eines Tages sagte der schon erwähnte Senator, der sich für einen »Philosophen« hielt: Aber so sehen Sie Sich doch das Schauspiel an, das die Welt bietet: Ueberall Krieg Aller gegen Alle; der Stärkste ist auch der Klügste. Ihr Wahlspruch: »Liebet Euch unter einander« ist eine Dummheit. »Sehr wohl« erwiderte der Bischof, ohne sich auf eine Widerlegung einzulassen: »Wenn das eine Dummheit ist, so soll sich die Seele darin einschließen, wie die Perle in die Auster.«
Zweites Buch. Der Fehltritt
I. Am Abend eines Tagemarsches
An einem der ersten Tage des Monats Oktober im Jahre 1815 betrat ungefähr eine Stunde vor Sonnenuntergang ein Wanderer die kleine Stadt Digne. Die wenigen Leute, die zu dieser Zeit am Fenster oder auf ihrer Thürschwelle standen, betrachteten den Mann mit ängstlichen Gefühlen. War es doch schwer sich einen elenderen Anblick vorzustellen, als dieser unbekannte Vorübergehende darbot. Es war ein untersetzter starker Mann, der sechsundvierzig bis achtundvierzig Jahre zählen mochte. Er trug eine Mütze, deren lederner Schirm sein sonnengebräuntes, mit Schweiß bedecktes Gesicht zum Theil barg. Sein grobes gelbes Hemd, das oben durch einen kleinen silbernen Anker zusammengehalten wurde, ließ seine haarige Brust sehen. Er trug ein, wie ein Strick zusammengedrehtes Halstuch, verschlissene Beinkleider aus blauem Zwillich, von denen das eine Bein am Knie weiß, daß andere durchlöchert war, einen alten grauen zerlumpten Kittel, dem am Ellenbogen ein mit Bindfaden genähter Flick aufgesetzt war, einen sehr vollen, gut zugeschnallten und ganz neuen Tornister, einen gewaltigen Knotenstock und eisenbeschlagene Schuhe ohne Strümpfe. Das Kopfhaar war sehr kurz geschoren, der Bart dagegen sehr lang.
Niemand kannte diesen müden, über und über mit Staub bedeckten Wanderer. Woher kam er? Von Süden, vielleicht vom Meere her. Denn er betrat die Stadt auf derselben Straße, die sieben Monate vorher den Kaiser Napoleon auf seinem Zuge von Cannes nach Paris hatte einziehen sehen. Der Fremde mußte offenbar den ganzen Tag marschiert haben. Einige Frauen aus dem unterhalb der Stadt gelegenen Flecken hatten gesehen, wie er unter den Bäumen des Boulevard Gassendi, am Ende der Promenade, stehen geblieben war, um aus der Fontaine zu trinken. Er schien recht durstig zu sein, denn zweihundert Schritte weiter wurde er von Kindern beobachtet, wie er aus der Marktfontaine abermals trank.
An der Ecke der Rue Poichevert angelangt, wandte er sich links und ging auf das Stadthaus zu. Hier trat er ein und kam nach einer Viertelstunde wieder heraus. Dicht bei der Thür saß ein Gendarm auf einer steinernen Bank, auf der am 4. März der General Drouot gestanden und dem verwunderten Volke die Proklamation des Kaisers Napoleon vorgelesen hatte. Unser Wanderer nahm seine Mütze ab und grüßte demüthig den Gendarmen.
Dieser sah ihn, ohne ihm zu danken, aufmerksam an, folgte ihm mit den Augen und ging dann in das Rathhaus hinein.
Es gab zu der Zeit in Digne eine sehr gute Herberge »zum Kreuze.« Der Wirt hieß Jacquin Labarre und erfreute sich in der Stadt einer besondern Hochachtung wegen seiner Verwandtschaft mit einem andern Labarre, der die Herberge zu den »Drei Dauphins« in Grenoble besaß und bei der Leibwache gedient hatte. Zur Zeit der Landung Napoleons bei Cannes waren über diese Herberge »zu den drei Dauphins« ganz sonderbare Gerüchte umgegangen. Es hieß, der General Bertrand sei, als Fuhrmann verkleidet, im Monat Januar oft dort eingekehrt, um an die Soldaten Ehrenkreuze und an die Civilisten Napoleond'ors zu vertheilen. Thatsächlich aber hatte der Kaiser bei seinem Einzug in Grenoble die Einladung, im Präfekturgebäude Wohnung zu nehmen, mit Dank abgelehnt, indem er zu dem Bürgermeister sagte: »Ich kehre bei einem rechtschaffenen Gastwirt, den ich kenne, ein« und hatte in den drei Dauphins logirt! Die große Ehre, die so dem Labarre in Grenoble zu Theil wurde, warf noch fünfundzwanzig Meilen weit einen Abglanz auf den Labarre in Digne. Man rühmte von diesem: »Er ist ein Vetter von dem in Grenoble.«
Nach dieser Herberge »zum Kreuze«, der besten in der der Stadt, lenkte unsrer Wanderer seine Schritte. Er trat in die Küche ein, deren Thür unmittelbar auf die Straße hinausging. Alle Kochherde und Backöfen waren im Gange, und im Kamin brannte ein lustiges Feuer. Der Wirt stand am Herde und hatte alle Hände voll zu thun mit der Zubereitung eines üppigen Abendessens, das für eine sehr vergnügte Gesellschaft von Frachtfuhrleuten in einem Nebenzimmer bestimmt war. Ißt und trinkt doch, wie Jedem, der viel gereist hat, bekannt ist, Niemand besser als die Fuhrleute. Am Kamin drehte sich am Bratspieß ein von Repphühnern flankirtes fettes Murmelthier und auf den Kochherden brieten zwei große Karpfen aus dem See von Lauzet und eine Forelle aus dem See von Alloz.
Als der Wirth die Thür gehen und einen neuen Gast hereinkommen hörte, fragte er ohne den Kopf umzuwenden:
»Was wünscht der Herr?«
»Ein Abendessen und ein Nachtlager.«
»Nichts leichter, als das«, erwiderte der Wirt. In demselben Augenblick aber wandte er sich um, überflog mit einem Blicke den Ankömmling von Kopf bis zu Fuß und ergänzte seine Antwort mit der Einschränkung: »Wer bezahlt!«
Der Fremde holte eine große lederne Börse aus einer Tasche seines Kittels hervor und antwortete:
»Ich habe Geld.«
»In dem Fall stehe ich zu Diensten.«
Der Mann steckte die Börse wieder ein, nahm seinen Tornister ab, stellte ihn in der Nähe der Thür an die Erde, behielt seinen Stock in der Hand und ließ sich auf eine Fußbank vor dem Kamin nieder. Digne liegt im Gebirge und die Oktoberabende sind daselbst kalt.
Währenddem musterte der Wirt, indem er überall herumhantirte, den Ankömmling.
»Wird bald gegessen?« fragte dieser.
»Gleich!« lautete der Bescheid des Wirtes.
Während der Gast sich am Kamin wärmte, zog der wackre Wirt Jaqcuin Labarre hinter seinem Rücken einen Bleistift aus der Tasche und riß von einer alten Zeitung, die sich aus einem kleinen Tisch am Fenster herumtrieb, eine unbedruckte Ecke ab. Auf diesen Fetzen Papier schrieb er ein paar Zeilen, faltete ihn ohne ihn zuzusiegeln und übergab ihn einem Jungen, den er in der Küche und als Laufburschen in seinem Dienst hatte. Diesem flüsterte er einige Worte ins Ohr, worauf der Junge spornstreichs davon eilte, nach dem Stadthaus zu.
Der Gast hatte von dem ganzen Vorgang nichts bemerkt.
Nach einer Weile fragte er wieder: »Wird bald gegessen!« und abermals antwortete der Wirt: »Gleich!«
Bald darauf kam der Küchenjunge mit dem Stück Papier zurück. Der Wirt faltete es hastig auseinander, wie Jemand, der die Antwort mit Ungeduld erwartet hat. Er schüttelte den Kopf, während er den Zettel las und sah eine Weile nachdenklich vor sich hin. Dann trat er vor den Gast, der in trübe Gedanken versunken schien.
»Guter Freund, ich kann Sie nicht aufnehmen.«
Der Gast richtete sich auf seinem Sitz empor.
»Wieso? Haben Sie Angst, daß Sie kein Geld von mir kriegen? Soll ich vorausbezahlen? Ich habe Geld, sage ich Ihnen.«
»Nicht darum.«
»Ja, warum denn aber?«
»Sie haben Geld ...«
»Ja gewiß«, bestätigte der Fremde.
»Aber ich habe kein Zimmer für Sie.«
»Dann lassen Sie mich im Stall schlafen.«
»Geht nicht!«
»Warum nicht?«
»Weil die Pferde allen Platz im Stall brauchen.«
»Gut, dann weisen Sie mir irgend einen Winkel auf dem Boden an. Ein Bund Stroh werden Sie ja auch wohl noch haben. Wir können ja nach dem Essen darüber sprechen.
»Ich kann Ihnen nichts zu essen geben.«
Diese in ruhigem Tone, aber mit Nachdruck abgegebene Erklärung machte den Gast stutzig. Er erhob sich von seinem Sitze.
»Das ist ja noch schöner! Ich falle um vor Hunger. Ich habe seit Sonnenaufgang marschirt. Wenn ich Geld habe, muß ich doch zu essen bekommen.«
»Ich habe aber nichts,« entgegnete der Wirt.
Der Fremde lachte laut auf und wies mit dem Kopf nach dem Kamin und dem Herde.
»Sie haben nichts! Ist das nichts?«
»Das ist alles bestellt.«
»Von wem?«
»Von den Herren Fuhrleuten.«
»Wie viele sind das?
»Zwölf.«
»Damit können Zwanzig reichen.«
»Sie haben alles bestellt und vorausbezahlt.«
Der Fremde setzte sich wieder und fuhr, ohne heftig zu werden, fort:
»Ich bin in einer Herberge, ich habe Hunger, also bleibe ich.«
Jetzt beugte sich der Wirt zu ihm nieder und sagte mit einer Betonung, bei der sein Gast zusammenschrak! »Gehen Sie!«
Der Fremde hatte sich gerade niedergebückt und stieß mit der eisernen Zwinge seines Stockes einige Kohlen in das Feuer. Er wandte sich hastig um, aber als er den Mund zu einer Erwiderung aufthat, sah ihm der Wirt fest in die Augen und fuhr mit leiser Stimme fort: Lassen wir die überflüssigen Redensarten. Soll ich Ihnen sagen, wie Sie heißen? Jean Valjean. Und wer Sie sind? Vorhin, als Sie hereinkamen, habe ich schon einen richtigen Animus gehabt und habe auf dem Stadthaus nachfragen lassen. Können Sie lesen?
Bei diesen Worten überreichte er dem Fremden den Zettel, der zwischen dem Stadthaus und der Herberge hin- und hergewandert war ... Der Gast überflog ihn mit einem Blicke. Dann fuhr der Wirt nach einer Pause fort:
»Ich bin aus Grundsatz gegen Jedermann höflich. Gehen Sie.«
Der Fremde ließ den Kopf auf die Brust sinken, hob den Tornister von der Erde auf und ging.
Er ging die Hauptstraße entlang. Vor sich hin, auf's Gerathewohl, dicht an den Häusern, wie Einer, dem eine Demüthigung widerfahren, und der infolgedessen schwermüthig gestimmt ist. Er drehte sich nicht ein einziges Mal um. Hätte er es gethan, so würde er gesehen haben, wie der Gastwirt und um ihn herum alle seine Gäste, so wie andres Publikum ihm nachschauten, nach ihm zeigten, sich lebhaft unterhielten, und hätte aus ihren mißtrauischen und ängstlichen Blicken schließen können, daß binnen Kurzem seine Ankunft wie ein wichtiges Ereignis ausposaunt sein würde.
Aber er merkte nichts von alle dem. Die Unglücklichen sehen sich nicht um. Sie wissen auch so, daß das Unglück hinter ihnen geht.
So schlich er eine Zeitlang dahin, durch Straßen, die er nicht kannte, ohne seine Müdigkeit zu beachten, wie dies bei schwermüthiger Stimmung der Fall zu sein pflegt. Plötzlich aber meldete sich wieder der Hunger. Die Nacht brach herein. Er sah sich um, ob er nicht irgend einen Unterschlupf finden könne.
Aus dem feinen Gasthaus war er hinausgewiesen worden; er suchte also irgend ein bescheidenes Logirhaus, irgend ein armseliges Loch.
In dem Augenblick flammte gerade am Ende der Straße ein Licht auf, und ein Kiefernzweig an einem eisernen Ständer zeichnete sich an dem weißen Abendhimmel ab. Er ging darauf zu.
Es war in der That eine Schänke, die in der Rue de Chaffaut.
Der Fremde blieb einen Augenblick davor stehen und betrachtete durch das Fenster einen niedrigen Saal, der von einer kleinen Lampe und einem hellen Kaminfeuer beleuchtet war. Es waren einige Gäste darin. Der Wirt stand am Kamin und wärmte sich. Ueber dem Feuer hing ein eiserner Topf an einem Kesselhacken.
Diese Schänke, in der man auch logieren kann, hat zwei Thüren, von denen die eine nach der Straße hinausgeht, und die andere nach einem Hofe, in welchem Dünger liegt.
Zu der Straßenthür wagte der Fremde sich nicht hinein. Er schlich sich in den Hof, blieb nochmals stehen, drückte auf die Klinke und machte die Thür auf.
»Wer ist da?« rief der Wirt.
»Jemand, der um ein Abendessen und ein Nachtlager bittet.«
»Sehr wohl. Das kann man hier kriegen.«
Er trat ein. Alle Gäste sahen nach ihm hin, während die Lampe von der einen und das Kaminfeuer von der andern Seite in beleuchteten. So musterte man ihn eine Zeit lang, während er seinen Tornister aufschnallte.
Der Wirt sagte dann zu ihm: »Hier ist ein gutes Feuer. In dem Topf kocht das Abendbrod. Kommen Sie näher, guter Freund, und wärmen Sie Sich!«
Der Fremde setzte sich, hielt seine wund gelaufenen Füße an das Kaminfeuer und sog den angenehmen Duft ein, der dem Kochtopf entstieg. Derjenige Theil seines Gesichts, den seine tief heruntergezogene Mütze noch sehen ließ, drückte Behagen aus und erhellte einigermaßen die leidensvollen Falten, die fortgesetztes Elend um seinen Mund gebildet hatte.
Das Profil des Fremden deutete auf Festigkeit und Energie. Seine Züge ließen auf ein sonderliches Gemisch von Demuth und Strenge schließen. Die Augen leuchteten unter den Augenbrauen wie Feuer aus einem Gestrüpp hervor.
Zufälliger Weise befand sich unter den Gästen in diesem Lokal auch ein Fischhändler, der kurz zuvor sein Pferd bei Labarre untergebracht hatte. Der Mann erkannte in dem neuen Ankömmling ein verdächtiges Subjekt, dem er am Morgen eben dieses Tages zwischen Bras d'Asse und – wenn ich mich recht entsinne – Escoublon begegnet war. Dieser, der schon zu der Zeit sehr ermüdet schien, hatte ihn gebeten, ihn hinter sich auf sein Pferd zu nehmen, worauf der Fischhändler statt aller Antwort noch schneller gefahren war. Dieser Mann also, der eine halbe Stunde vorher mit Labarre auf der Thürschwelle gestanden und seine gefahrvolle Begegnung erzählt hatte, winkte jetzt heimlich dem Wirt. Derselbe trat an ihn heran und sie wechselten einige Worte im Flüsterton, während der Fremde am Feuer saß und seinen Gedanken nachhing.
Der Wirt kam alsbald wieder zu dem Kamin zurück legte derb seine Hand auf die Schulter des Fremden und herrschte ihn an:
»Mach, daß Du fortkommst!«
Der Fremde wandle den Kopf und erwiederte mit sanfter Stimme!
»Sie wissen also ...?«
»Ja.«
»Ich bin aus der andern Herberge hinausgewiesen worden.«
»Und hier wirst Du auch weggejagt.«
»Wo soll ich denn hingehen?«
»Anderswohin.«
Der Fremde griff nach seinem Stock und Tornister und ging davon.
Als er herauskam, warfen ihn einige Kinder, die ihm von der ersten Herberge her gefolgt waren und hier auf ihn zu warten schienen, mit Steinen. Er lief ihnen wüthend nach und drohte mit dem Stock. Die Kinder stoben auseinander wie ein Schwarm aufgescheuchter Vögel.
Er kam an einem Gefängniß vorbei. An der Thür hing eine eiserne Kette, die an einer Glocke befestigt war. Er schellte.
»Herr Schließer, bat er mit demüthig abgenommener Mütze, »würden Sie wohl die Güte haben mir aufzumachen und mir für diese Nacht Unterkunft zu geben?«
Eine Stimme antwortete:
»Ein Gefängnis ist keine Herberge. Erst müssen Sie arretirt sein. Dann wird Ihnen aufgemacht.«
Damit ging das Schiebefenster wieder zu.
Nun kam er in eine Straße, an der viele kleine Gärten liegen. Einige davon sind, statt mit hohen Mauern, nur von Hecken eingehegt, was der Straße ein hübscheres Aussehen verleiht. Hier erblickte er ein kleines einstöckiges Haus, dessen Fenster erleuchtet war. Er schaute hinein, wie kurz vorher in die Fenster der Schenke. Er sah ein großes weißgetünchtes Zimmer mit einem Bett, das mit Draperien aus bedrucktem Kattun behängt war, einer Wiege in einer Ecke, einigen Holzstühlen und einer Doppelflinte, die an der Wand hing.
In der Mitte des Zimmers stand ein gedeckter Tisch. Eine Lampe strahlte ihr Licht aus über das weiße grobe Tischtuch, die zinnerne Weinkanne, die wie Silber glänzte, und die dampfende braune Suppenschüssel. An diesem Tisch saß ein etwa vierzig Jahre alter Mann, der sehr vergnügt ein Kind auf seinen Knieen reiten ließ. Neben ihm säugte eine junge Frau ein andres Kind. Der Vater lachte, das Kind krähte vergnügt und die Mutter lächelte dazu.
Der Fremde sah einen Augenblick diesem anmuthenden und friedlichen Schauspiel zu. Was ging in seiner Seele vor? Er allein hätte es sagen können. Wahrscheinlich dachte er, daß in einem Hause, wo es so gemüthlich zuging, auch Gastfreundschaft geübt werden müsse. Vielleicht würde er hier, wo er so viel Glück sah, auch ein wenig Erbarmen finden.
Er klopfte ganz schwach an die Fensterscheibe.
Niemand hörte.
Er klopfte zum zweiten Mal.
Jetzt hörte er die Frau sagen: »Männchen, mir däucht, es klopft.«
»Bewahre!« antwortete der Mann.
Er klopfte zum dritten Mal.
Der Mann stand auf, nahm die Lampe, kam auf die Thür zu und schloß sie auf.
Es war ein hochgewachsener Mann, halb Bauer, halb Handwerker. Er trug eine große Lederschürze, die ihm bis zur linken Schulter hinaufreichte, und die über dem Gürtel von einem Hammer, einem rothen Tuch, einem Pulverhorn aufgebauscht war. Er hielt den Kopf nach hinten geneigt und sein weit offenes Hemd, dessen Kragen niedergeschlagen war, ließ seinen weißen, stiermäßig starken Hals sehen. Er hatte buschige Augenbrauen, einen gewaltigen schwarzen Backenbart, hervorstehende Augen, ein spitzes Kinn und über dem Ganzen war jener unbeschreibliche Ausdruck von Ruhe und Sicherheit ausgebreitet, welchen das Bewußtsein Herr eines eignen Heims zu sein, dem Menschen verleiht.
»Ich bitte um Verzeihung, lieber Herr,« begann der Wanderer. »Wenn ich bezahle, würden Sie mir wohl einen Teller Suppe abgeben und einen Winkel in dem Schuppen da, wo ich schlafen könnte. Ja, würden Sie das? Ich bezahle.«