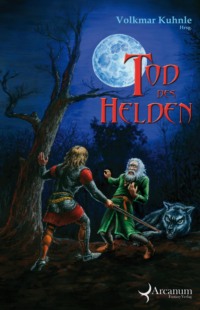Kitabı oku: «Tod des Helden», sayfa 3
Sie waren erwartet worden. Anders konnte Aryonna es nicht erklären, dass die Stellung der kaisertreuen Soldaten, die sie angriffen, vor Geschäftigkeit nur so summte, kaum dass der erste Schuss gefallen war. Sie wirkte wie ein einziges, großes Lebewesen. Ein stählerner Koloss, der sein riesiges Maul aufsperrte, Geschützfeuer und mit Enterhaken besetzte Stahltrosse ausspie. Nur der Geschicklichkeit des Kapitäns war es zu verdanken, dass das Luftschiff keinen Volltreffer erlitt.
Später vermochte Aryonna nicht zu sagen, wie lange der ungleiche Kampf gedauert hatte. Irgendwie war es den Rebellen gelungen, dem drohenden Absturz zu entgehen und sich zurückzuziehen. Doch das Schiff war erneut schwer beschädigt, die Mannschaft bis auf einige Ausnahmen verwundet oder tot. Aryonna gehörte zu den wenigen, die unverletzt geblieben waren. Sie war nie dazu gekommen, ihre Armbrust abzufeuern. Stattdessen hatte sie, als der erste Kampfgefährte an ihrer Seite getroffen zusammensank, ohne nachzudenken die Waffe von sich geschleudert und war dem Verletzten zu Hilfe geeilt. Danach war der Strom derjenigen, die ihren Beistand brauchten, nicht mehr abgerissen. Der Junge Ratte und ein paar andere freiwillige Helfer hatten, ohne zu fragen, Aryonnas Anweisungen befolgt, und so hoffte sie, dass es ihr gelungen war, dem Tod zumindest einige seine Opfer abzuringen. Vielleicht war sie doch eine Heilerin. Nachdem das Luftschiff mehr schlecht als recht gelandet war, musste sich selbst der Kapitän eine Schusswunde behandeln lassen. Als Aryonna die Wunde ihres Vaters versorgte, war es ihr, als musterte er sie eingehender als sonst, doch sie hatte kaum Zeit, seinen Blick zu erwidern. Es gab noch so viele andere, die auf Hilfe warteten. Erst als sie halb ohnmächtig vor Erschöpfung am Feuer kauerte und ihr irgendjemand einen Kanten Brot in die Hand schob, kam Aryonna dazu, an den Jungen zu denken. Ratte, wo war er nur? Auf dem Schiff war er an ihrer Seite geblieben, um zu helfen, doch dann hatte sie ihn aus den Augen verloren. Auch unter den Verwundeten konnte sie ihn nirgends entdecken. War er am Ende während der harten Landung über Bord gegangen? Von den Männern, die Aryonna fragte, hatte ihn keiner gesehen, doch die machten nur wegwerfende Handbewegungen: Sie sollte sich keine Sorgen machen, dem kleinen Strauchdieb passierte schon nichts. Doch trotz lähmender Müdigkeit kam sie nicht zur Ruhe. Schließlich schlich sie sich hinaus, kämpfte sich gebeugt gegen den zunehmenden Schneesturm vor und fand den Weg zum einzigen Ort, an dem sie auf Unterstützung hoffen konnte. Ihre erste Hoffnung, den Jungen schlafend in Marjas Marketenderwagen vorzufinden, erfüllte sich nicht. Nein, die Alte hatte ihn nicht mehr gesehen, seitdem sie ihm vor ein paar Tagen dringend davor gewarnt hatte, sich freiwillig in den Kampf zu stürzen. Ihn jetzt in diesem Sturm zu suchen, wäre Wahnsinn, weigerte sich die alte Frau zunächst: „Er wollte nicht auf mich hören, also muss er zusehen, wie er zurechtkommt, basta!“
„Aber er ist dein Enkelsohn, nicht wahr? Blut von deinem Blut.“ Aryonna wusste selbst nicht, woher die plötzliche Gewissheit kam. Ihre Stimme war ruhig, doch ihr Blick zwang die keifenden Proteste der Alten nieder, bis Marja sich schließlich in ihren Fellumhang hüllte und Aryonna nach draußen folgte, um das Pferd anzuspannen.
„Ich hätte auf sie hören sollen“, denkt Aryonna mutlos. „Sie hatte Recht, wir setzen nur vergeblich unser Leben aufs Spiel.“ Ihre Erleichterung darüber, dass der Sturm tatsächlich nachgelassen hat, ist schnell von neuerlicher Angst verdrängt worden: Das Knacken des Eises, das sich unter den Rädern ihres Wagens bewegt, übertönt längst das Heulen des Windes. Sie müssen umkehren, wenn sie nicht in dieser unwirtlichen Landschaft umkommen wollen. Doch gerade als Aryonna sich mühsam auf dem Kutschbock aufrichtet, um die Zügel anzuziehen und das treue Pferdchen zum Einlenken zu bringen, sieht sie es: Es ist nur eine kleine Erhöhung inmitten des Schnees, die ein verschneites Grasbüschel hätte sein können – könnte Aryonna nicht den Lauf der Armbrust erkennen, der daraus emporragt. Sie hatte den Kopf geschüttelt, als Ratte die Waffe anhob, die sie selbst achtlos beiseite geschleudert hatte, um sich an Bord des Luftschiffes um die Verletzten zu kümmern. Sie war viel zu schwer für ihn, und es würde wohl noch Jahre dauern, bis er sie richtig spannen, geschweige denn damit schießen konnte. Dennoch hat er die Waffe nicht mehr aus der Hand gelegt, hat sie selbst dann noch bei sich getragen, als er hilflos im Schnee umherirrte und schließlich vor Erschöpfung zusammensank. Doch er kann noch nicht lange hier gelegen haben. Den Göttern sei Dank, es ist noch Leben in ihm, stellt Aryonna fest, als sie unter der steifgefrorenen Kleidung seinen Herzschlag ertastet. Sie hüllt ihn in ihren eigenen Umhang und trägt ihn zum Kutschbock, wo er – so hofft sie – zwischen ihr selbst und der Alten sitzend schon ein wenig Wärme bekommt, bis sie es zurück ins Lager schaffen. Doch sie sind noch nicht weit gekommen, als ein neuerliches Knacken, lauter und schärfer als zuvor, wie ein Schuss die Nacht durchdringt. Unerbittlich neigt sich der Wagen zur Seite, und unter den Rädern dringt schwarzes Wasser hervor. Das Pferdchen wiehert und bäumt sich auf, doch es gelingt ihm nicht, den Wagen aus dem Eisloch zu zerren, das schnell größer wird. Aryonna ist vom Kutschbock gestolpert, hat den Jungen über ihre Schulter gelegt, doch schon spürt sie, wie eisiges Wasser in ihre Stiefel dringt. Auch die Alte ist vom Bock gestiegen, hat von irgendwoher eine Axt, mit der sie sich an der Deichsel zu schaffen macht, um den Wagen loszuschlagen. Der Wagen ist verloren, vielleicht aber können sie das Pferd noch retten. Endlich gibt das Holz unter ihren Schlägen nach. Schon macht sie einen Schritt zur Seite, doch da bricht auch unter ihr das Eis. Aryonna gelingt es gerade noch, auf Knien liegend, den Arm der alten Frau zu packen, die binnen weniger Augenblicke in der schwarzen Tiefe zu versinken droht. Aryonna schwankt unter der doppelten Last. Eben noch hielt sie Marjas Arm, jetzt ist es nur das Handgelenk. Wenn sie mit beiden Händen zupacken könnte – doch dann müsste sie erst den Jungen loslassen.
„Lass … mich. Nimm … das Kind. Das Pferd …“ mit einem Ruck hat sich die Alte von Aryonnas Hand gelöst. Einen Augenblick lang sieht Aryonna noch ihr Gesicht, bevor es vom dunklen Wasser verschlungen wird. Aryonna taumelt zurück. Keuchend richtet sie sich auf, schultert den noch immer reglosen Jungen und stolpert die wenigen Schritte zu dem Pferd, das treu stehengeblieben ist und sich willig den Jungen auf den Rücken laden lässt. Weiter geht es schwankend, Schritt für Schritt, doch irgendwann knicken die Hinterbeine des Pferdes ein. Einen Moment lang versucht es mit zitternden Flanken, sich aufzurichten, dann geben auch die Vorderbeine nach, und es sinkt zu Boden. Aryonna lauscht in die Dunkelheit, es ist völlig still. Haben sie das verräterische Eis hinter sich gelassen? Sie müsste den Jungen nehmen, müsste weitergehen. Aber als sie versucht, ihn vom Rücken des Pferdes zu heben, das sie mit seinen dunklen Augen scheinbar verständnisvoll ansieht, wollen die Füße ihr nicht mehr gehorchen. Ein paarmal noch versucht sie aufzustehen, doch irgendwann lässt sie sich nur gegen den am Boden ausgestreckten Bauch des Pferdes sinken, zieht den Jungen zu sich herab und bettet ihn zwischen sich und den noch warmen Pferderumpf. Ihr ist, als habe er sich unter ihren Händen bewegt. Vielleicht haben die Männer im Lager ja ihr Verschwinden bemerkt und suchen sie. Sie hat getan, was sie tun konnte. Was eine Heilerin tun muss.
Es ist ein frostklarer Morgen, so still, als habe es nie einen Sturm gegeben. Aber auch der gestrige Tag war schön gewesen – heiter und sonnig, und doch angefüllt mit Leid und Tod. Binnen eines Tages hat Kapitän Alessandro die Hoffnung auf einen erfolgreichen Feldzug ebenso begraben müssen wie viele seine Kameraden. Es war ihre letzte Hoffnung. Sie sind nicht mehr genug Männer, um das Luftschiff wieder klarzumachen und einen neuen Vorstoß zu wagen. Und dennoch, nach all dem Unglück, ist es das rätselhafte Verschwinden des Rekruten Yann, das Kapitän Alessandro am meisten schmerzt. Er versteht selbst nicht wieso, doch er ahnt, dass der Junge, der nicht schießen konnte, aber wusste, wie man eine Wunde versorgt, ein Geheimnis verbarg. Nun wird er es vielleicht nie mehr lüften können. Während der Kapitän seine verbliebenen Männer mit barschen, verbissenen Befehlen wieder und wieder zur Suche antreibt, schüttelt er innerlich den Kopf über sich selbst.
Vielleicht werde ich alt und sehe Gespenster, denkt er. Aber als der junge Rekrut gestern seinen verwundeten Arm verband, hätte er schwören können, dass es in seinen Augen blau aufgeblitzt hat.
Kaum eine Stunde später hat der Kapitän Gewissheit: Die Männer haben die Reste des verunglückten Marketenderwagens gefunden und nicht weit entfernt den steif gefrorenen Leib des Pferdes. Sie sind zu spät gekommen. Die Augen so blau wie nur ein anderes Augenpaar, das der Kapitän je gekannt hat, starren blicklos in den bleichen Winterhimmel. Wie hat er so blind sein können, nicht zu durchschauen, dass jenes schmale, makellos glatte Gesicht das Antlitz eines jungen Mädchens ist? Wochenlang hat seine eigene Tochter bei ihm und seinen Männern gelebt. Doch er hat sie nicht erkannt, hat sie kaum eines Blickes gewürdigt – ebenso wenig wie den Betteljungen, der ihr wie ein Hund folgte. Der Junge jedoch lebt. Selbst als ihre Kräfte schwanden, hat Aryonna ihn mit ihrem eigenen Körper bedeckt und ihn so vor dem Erfrieren bewahrt. Auch später, als Aryonna im Lager aufgebahrt liegt, weicht das Kind nicht von ihrer Seite. Mit vor Angst geweiteten Augen schaut es zu Alessandro auf, als er fragt:
„Wusstest du es?“
„Dass sie ein Mädchen ist? Ja.“ Der Junge nickt zögernd.
„Und sonst? Hat sie dir irgendetwas von ihrer Familie erzählt?“
„Ihr Mutter ist tot, sagte sie“, flüstert der Junge. „Sie hatte noch einen Bruder, glaube ich. Aber der ist auch tot.“
Alessandro muss die Augen schließen, um sich gegen den plötzlichen Schwindel zu wappnen, der ihn überfällt. Seine Frau, tot! Seine Kinder, die den Frieden kennenlernen sollten … Er hatte geglaubt, in den Bergen seien sie sicher. Hatte sich vorgegaukelt, sie würden auf ihn warten, wann immer er nach Hause kam. Was für ein Narr war er doch!
„Oh, es ist alles meine Schuld!“ Das verzweifelte, atemlose Schluchzen des Jungen durchbricht das Schweigen. „Ich wollte doch nur ein Krieger sein! Aber dann bin ich über Bord gefallen und habe mich verlaufen. Irgendwann konnte ich nicht mehr weitergehen, doch als ich aufgewacht bin, lag ich neben dem Pferd, und sie war da. Ich wollte sie wärmen, aber das nützte nichts, mir war ja selbst so kalt!“
Alessandro sieht den Jungen an: Mager ist er und schmutzig, verlaust und diebisch, und niemand nennt ihn je anders als Ratte. Dennoch ist er ein Kind. Der Junge windet sich unter dem prüfenden Blick des Mannes – des Anführers, den er in Alessandro sieht, und dieser schämt sich mehr als je zuvor.
„Deine Schuld ist es nicht, höchstens meine“, murmelt er.
„Dann lassen Sie mich bei Ihnen bleiben und kämpfen lernen?“ Den hoffnungsvollen Ausdruck, den das Gesicht des Jungen angenommen hat, kann Alessandro kaum ertragen. Nein, es kann nicht so weitergehen wie bisher. Er kann nicht zulassen, dass noch mehr Leben in sinnlosen Kämpfen verschwendet werden. Es muss einen anderen Weg geben. Ein Gedanke beginnt, in Alessandros Kopf Gestalt anzunehmen. Kräftig ist der Junge nicht, denkt er. Aber flink und aufgeweckt. Er wäre ein guter Spion.
„Sag, bist du schon einmal in einer Stadt gewesen?“, fragt er. Der Junge schüttelt den Kopf.
„Aber meine Gro... die alte Marja wollte im Frühjahr in Richtung Hauptstadt ziehen, um Handel zu treiben und Neuigkeiten zu erfahren“, ergänzt er hoffnungsvoll. „Sie meinte, man müsse endlich die Wahrheit über den Kaiser herausfinden.“
Alessandro nickt. Auch die Alte hat er wohl falsch eingeschätzt: Mürrisch und eigennützig mag sie gewesen sein – dumm war sie nicht.
„Ja, das müssen wir“, sagte er.
Kornelia Schmid Der Ton einer Harfensaite
„Heute bist du gestorben.“
Zuerst waren die Worte nur ein Wispern und schwirrten wie eine sanfte Melodie in seine Träume. Rerik blinzelte den Schlaf aus den Augen. Die Stimme summte noch in seinen Ohren. Langsam setzte er sich auf. Unter seinem Türschlitz sickerte Glut hervor und waberte auf ihn zu. Ein hoher Ton zitterte in der Luft.
„Vielleicht bist du nicht einmal mehr hier“, sagte die Stimme. Nicht mehr leise. Sie klang direkt vor Rerik. Als stünde der Sprecher im Raum. Das sonderbare Leuchten bäumte sich auf und spie ein Paar stechender Augen aus, bevor sich um sie ein Gesicht aus rotem Licht zusammenballte. Die Hände formten sich als Nächstes, bevor der restliche Körper aus Flammen wuchs. Das Geräusch in seinen Ohren stach..
Rerik strampelte sich aus seiner Bettdecke. Der wirbelnde Umhang des Eindringlings warf Funken auf die Dielen. Würden die fremden Augen ihn verbrennen, wenn er sie zu lange ansah? Kurz war Rerik reglos, starrte nur die Erscheinung an, und schwarze Pupillen starrten zurück. Der Moment zog sich so lang, dass er die Hitze vergaß. Wenn er träumte, so musste gleich alles davonfliegen.
Der Fremde schnippte eine Flamme zu Rerik herüber. Für einen Augenblick flatterte sie wie ein Schmetterling, dann brannte sie auf seiner Hand und fraß sich in seine Haut. Vor Schmerz schrie er auf. Die letzten Reste des Traumes fielen von ihm ab, und heiß durchdrang ihn das Bewusstsein der Wirklichkeit. Es passiert tatsächlich. Blutiger Schein in seinem Zimmer. Diese Hölle brach in der Realität los. Hier in seinem Palast, in seinem Zimmer, in diesem Moment.
Rerik sprang in die Höhe und hechtete zur verschlossenen Tür. Wie war der Kerl hier hereingekommen? Ein Magier. Ein waschechter Magier, und das fünfhundert Jahre nach König Karyans Tod.
Die Wachen vor seinen Gemächern waren verschwunden, als hätten sie sich in Luft aufgelöst. Rerik hastete über den verlassenen Flur. Eine feurige Woge verfolgte ihn und trieb ihm Schweiß auf den Rücken. Seine nackten Füße patschten über den Boden.
Der Magier trug metallbeschlagene Schuhe, die gleichmäßig auf die Fliesen klackten. Von hinten flutete Licht über Rerik hinweg und löschte das Weiß der Säulen und Bodenplatten. Keuchend erreichte er die gewundene Treppe. Als er die Stufen hinunterjagte, schirmten die Wände das Glühen vor ihm ab, doch in der Eingangshalle quoll es wieder hinter ihm auf.
Rerik riskierte einen Blick über die Schulter. Glühender Nebel um eine hochgewachsene Gestalt in kostbaren Gewändern. Der Magier hatte es offenbar nicht eilig. Hoch aufgerichtet stand er im Saal. Ein Paar funkelnder Augen verfolgte Rerik, und Flammen loderten am Boden. Seine Lippen mochten ein Lächeln formen.
Die große Tür war vor ihm. Rerik drückte den Griff und warf sich mit aller Kraft dagegen. Ein schwerer Flügel schwang auf, und Rerik schob sich ins Freie. Sein Herz hämmerte heiß in seiner Brust. Jeder Atemzug brannte.
Die beiden Wachen starrten ihn an, ohne ein Wort zu sagen. Natürlich nicht. Man sprach seinen König nicht an.
„Nehmt ihn fest“, schnappte Rerik und wies hinter seinen Rücken.
„Aber Ihr sagtet doch -“
„Ich sagte?“
Über den Hof donnerte eine Explosion. Eine Hitzewelle schleuderte Rerik nach vorne. Seine Handflächen platzten beim Aufprall auf. Als er sich aufrappelte, stand der Magier nur ein paar Schritte entfernt. Das Rot zog sich allmählich zurück, sodass seine Konturen deutlich genug sichtbar wurden, um menschlich zu wirken. Auf seinem Haupt lag Reriks Krone. Der Magier hob so langsam die Hand, als würde die Zeit zerschmelzen.
Rerik ließ es nicht darauf ankommen. Er rannte, so schnell er konnte, und drehte sich erst um, als sein Palast weit hinter ihm lag.
Um die Türme des Schlosses wand sich roter Dunst, doch ansonsten lag es ruhig da, als wäre nichts geschehen. Keine Schreie gellten aus den Fenstern. Keine Flüchtenden strömten durch die Tore. Rerik rieb sich mit dem Handrücken über die Stirn. Hatte er keine Verbündeten? Seine Garde, seine Berater ...
Das rote Licht sickerte über die Wände, floss in seine Richtung. Rerik schnappte nach Luft und begann wieder zu laufen. Am Horizont leuchtete die Morgensonne unter dunklen Wolkenbahnen und tauchte den Tag in Glut.
Rerik hielt sich an den Verlauf der Straße. Vielleicht keine gute Idee. Mit Pferden mochten sie ihn schnell einholen. Aber wer waren sie überhaupt? Der Magier verfolgte ihn nicht. Warum? Rerik wischte sich Schweiß von der Stirn. Offenbar war er keine Bedrohung für ihn. Rerik stieß Luft zwischen den Zähnen aus. Wer auch immer das Geheimnis der Magie ergründet hatte, hatte es nicht aufgeschrieben. Niemand konnte ihm sagen, wie man ein Magier wurde. Oder was der Preis dafür war. König Karyan hatte der Legende nach sein Blut verkauft.
Gegen Mittag spannte sich ein grauer Himmel über die Landschaft und ließ keine Spur von Rot mehr auf seinen Wolken zu. Die Straße war belebter geworden. Händler und Kuriere taten ihre Arbeit. Regentropfen klatschten auf den Boden. Rerik schlang die Arme um die Brust und senkte den Blick. Kaum jemand beachtete ihn, während er zitternd dem matschigen Weg folgte. Die Wagen rollten gleichgültig an ihm vorbei.
Rerik biss die Zähne zusammen. Er trug eine dünne Hose, keine Schuhe, nicht einmal ein Hemd. Niemand würde ihn für einen König halten – und wenn sie es täten, mochte das sein Leben kosten. Rerik zwang sich Schritt für Schritt durch den kalten Schlamm. Die Regentropfen stachen wie Eiskristalle in seine Haut. Die brennende Berührung der roten Flamme war erloschen. Seine aufgeschürften Handflächen hingegen schmerzten noch immer.
Wolken verhüllten die Nachmittagssonne. Der Regen war abgeklungen, hatte jedoch schweren Moderduft in der Luft zurückgelassen. Reriks Haut fühlte sich wie gefroren an. Seine Muskeln waren verhärtet und schmerzten bei jeder Bewegung. Ein König fror nicht. Ein König ging nicht zu Fuß.
Grüne Hügel säumten die schmaler werdende Straße. Im Gras schimmerten Tropfen. Rerik sackte auf einen Stein am Wegrand und schloss eine Weile die Augen. Sein Herz pochte so schwach, dass ihn nur das laute Knurren seines Magens und seine wunde Kehle daran erinnerten, dass er noch lebendig war.
„Ich bin der König von Zenbara“, flüsterte Rerik. Dem König musste es doch möglich sein, irgendwo Kleidung und eine Bleibe zu finden.
Und dann? Wer würde ihm seine Krone zurückgeben können, solange sie die Stirn eines Magiers zierte? Vielleicht war der Magier ohnehin ein besserer König als er.
Rerik schüttelte den Kopf. Es spielte keine Rolle. Eine Tränenspur benetzte seine Wange. Er blinzelte gegen das Brennen in seinen Augen an. Hinter den Bäumen glomm ein blaues Licht. Nebelschwaden wirbelten heraus und trugen unruhigen Schein mit sich. Der Wind pfiff hohe Töne wie von einem Lied. Reriks verschwimmender Blick klärte sich. Sein Herz pochte schneller. Eine Melodie aus dem zarten Schwirren einer Harfensaite. Er hatte so etwas schon einmal gehört.
Langsam stemmte er sich in die Höhe. Der Wald schloss in einem gleichmäßigen Bogen an den Hügel an, als hätte jemand mit einem Zirkel einen Kreis gezogen. Wie war dieses Licht nur möglich? Rerik lauschte auf die Musik der Luft und machte ein paar Schritte auf die Bäume zu. Je näher er kam, umso lauter wurden die Klänge. Das Leuchten pulsierte stärker, färbte sich zu einem satten Türkis. Rerik streckte die Hände aus. Seine Finger zitterten. Inmitten des Dickichts lag Magie. Dort konnte er sie finden. Als Magier konnte er sein Königreich zurückerlangen. Er würde mit blauem Feuer gegen den Thronräuber kämpfen. So hatte der große König Karyan die Macht erlangt. Der letzte Magier und mächtigste Herrscher von Zenbara. Um seine Person rankten sich mehr Legenden, als in ein Buch passten.
Rerik schnaubte. Er war sich ziemlich sicher, dass in fünfhundert Jahren niemand mehr über ihn sprechen würde. Er war schließlich nur ein bedeutungsloser Monarch, jung gekrönt und ebenso jung gestürzt.
Magie also. Vielleicht musste auch er dafür sein Blut opfern, ganz wie Karyan es getan hatte. Rerik nickte und machte einen weiteren Schritt vorwärts.
„Nicht, mein Junge!“ Ein bärtiger Mann sprang auf ihn zu und patschte ihm eine große Hand auf die Schulter.
Rerik starrte den Fremden an und fragte sich verzweifelt, wie dieser es nur wagen konnte, so mit einem König zu reden. Aber er war kein König mehr. Konnte man es dem Mann verdenken, dass er nur einen verdreckten Jungen sah? Mit allerweltsbraunen Haaren und zerschlissen genug gekleidet, um nirgendwo anders hin als auf die Straße zu gehören.
Der Mann hingegen trug ein Wams aus Leinen und eine saubere Hose. Sein breitkrempiger Hut schützte ihn vor dem Wetter, und sein Bart war ordentlich gestutzt – alles im Gegensatz zu Rerik.
Er holte tief Luft. „Was soll ich nicht tun?“
„Der Wald ist verflucht“, sagte der Mann.
Der türkisfarbene Schein sah nicht bösartig aus. Ganz anders als das Glutlicht des Thronräubers. Rerik deutete auf die Nebelschwaden. „Was ist das?“
Der Mann blickte nur kurz hinüber. „Der Wald der Seelen. Mächtige Magie ist dort am Werk.“
„Welche Art von -“
„Welche Art? Wann hat uns Magie jemals etwas Gutes gebracht?“ Der Fremde schüttelte den Kopf. „Was auch immer du vorhast, lass es bleiben. Auf meinem Hof gibt es keine Magie, dafür ehrliche Arbeit.“
Als er Hof hörte, musste Rerik lachen. Hatte es an seinem Hof auch ehrliche Arbeit gegeben? Er hustete gegen das Kratzen in seinem Hals. Wie ein Bauer sollte er arbeiten, dabei war er doch ein König. Gewesen.
Rerik nickte langsam. „Vielen Dank.“ Seine Stimme war ein Krächzen.
Er sah noch einmal zu den Bäumen hinüber, doch der leuchtende Nebel war verschwunden. Der Fremde atmete hörbar aus und murmelte etwas, das Rerik nicht verstand. Als er zurück zu seinem Wagen ging, folgte ihm Rerik.
Die Arbeit trieb ihm Schweiß auf die Stirn und ließ seinen Rücken schmerzen. Während er das Feld von Derias Vater pflügte, vergaß Rerik oft, dass er eigentlich ein König war. Erst abends, wenn er der Straße bis zum Waldrand folgte, dachte er wieder daran, dass die Magie auf ihn wartete.
Leider hatte er den blauen Schein seit dem Tag vor drei Jahren nie wieder gesehen. Genauso wenig wie die Soldaten seines Palastes, seine Berater oder den Thronräuber. Niemals hatte er das Küchenmesser, das er immer bei sich trug, zur Verteidigung ziehen müssen. Das war vermutlich gut so, aber wenn er die Kneipe des Dorfes aufsuchte und kein einziges Gerücht über seinen Sturz hörte, schmerzte seine Bedeutungslosigkeit wie ein Stich in die Eingeweide. Sie sprachen zwar vom „König“, nannten ihn aber nie beim Namen, kannten diesen vermutlich auch gar nicht. Ein fremder Fürst sollte letzten Monat vor ihm gekniet haben.
Rerik schirrte das Pferd ab und führte es zurück in den Stall. Im angrenzenden Haus brannte Licht. Derias Mutter hatte das Abendessen vorbereitet. Rüben, vermutlich. Oder Kohl. Rerik schloss die Tür ab und lief zur Straße. Es dauerte nicht lange, bis er den Stein erreichte, auf dem er damals gesessen hatte, frierend und schmutzig. Die Hügel wölbten sich wie zuvor, und die Bäume raschelten im Abendwind. Der Schein der untergehenden Sonne durchdrang ihr Laub. Sonst nichts.
Rerik war schon oft hineingegangen. Ein Wald wie jeder andere. Das spektakulärste, was er gefunden hatte, war ein verrostetes Schwert in der Erde. Ansonsten nur einen vermodernden Wegweiser, dessen Schrift unleserlich geworden war, und ein leeres Fass, das irgendjemand zwischen Baumwurzeln zurückgelassen hatte. Rerik rieb sich fröstelnd die Oberarme. Was war damals anders gewesen als jetzt? Warum hatte er auf Derias Vater gehört?
„Schon wieder hier?“
Rerik zuckte zusammen und wandte sich um. Derias Augen waren blau wie der verborgene Schein. Ihr Lächeln zauberte Grübchen in ihre Wangen. Rerik schluckte und spürte, wie ihm Blut in die Wangen schoss. Er hatte noch nicht einmal ihre Schritte gehört.
„Ich wollte nur -“
„Die Bäume anstarren, wie immer.“ Deria verschränkte die Arme. Sie lächelte noch immer, aber die Grübchen waren verschwunden, und ihre Augen blickten ernst.
Rerik holte Luft und deutete auf die Bäume. Sie ragten gerade auf, und keine Spur von Nebel oder Licht schwebte zwischen ihnen. Ein Eichhörnchen sprang einen Stamm hinauf. Vögel zwitscherten. „Ich weiß, dass dort der Wald der Seelen liegt.“
Deria rollte mit den Augen. „Und was willst du dort? Selbst der mächtigste Magier, der jemals gelebt hat, ist im Wald der Seelen gestorben.“
Rerik rieb sich die Hände. „Es heißt, König Karyan wäre unsterblich.“
Deria zuckte mit den Schultern. „Aber er ist nicht mehr hier, oder? Sonst würde er noch immer über Zenbara herrschen.“
Die Sonne war am Horizont untergegangen und hatte einen Streifen roten Lichtes am Himmel zurückgelassen. Rerik blickte auf das Gras zu seinen Füßen. Ein Windzug schaukelte die Halme. Er hatte nicht oft auf Wiesen gestanden, als er noch König gewesen war. Oder er hatte es nicht zur Kenntnis genommen. Er hatte noch keine Angst vor rotem Leuchten gehabt. „Ein anderer Magier regiert nun Zenbara“, sagte er.
Deria trat neben ihn und legte ihm eine Hand auf die Schulter. „Ist doch egal. Solange er sich nicht um uns schert. Könige kommen und gehen.“
Wenn er doch nur wieder gehen würde. Wohl kaum. Er baute ein gewaltiges Viadukt, eine halbe Tagesreise entfernt. Die Menschen fanden das wunderbar. Rerik schüttelte den Kopf. „Was könnte den mächtigsten Magier, der jemals gelebt hat, töten?“
„Die Magie im Seelenwald ist anders“, sagte Deria. Ihre Nägel krallten sich in sein Fleisch. „Rerik ...“, sagte sie in einem Tonfall, der ihn aufschauen ließ. Derias Augen fixierten ihn, als wollten sie ihn einfrieren. „Dein Leben findet nicht in irgendwelchen alten Geschichten statt. Die bringen uns nicht weiter.“
„Der Wald der Seelen ist Realität. Ich habe ihn gesehen“, sagte Rerik rau. „Und Karyan war auch real.“
„Ich habe den Seelenwald noch nie gesehen. Wahrscheinlich will er meine Seele nicht.“ Deria lächelte schief und zog ihre Hand zurück. „Vielleicht ist sie zu glücklich für ihn.“
Sie wandte sich um und ging zurück zur Straße. Natürlich erwartete sie, dass er ihr folgte. Also warf er noch einen letzten Blick zum einsamen Waldrand und schloss dann zu ihr auf.
Ein weiterer Abend senkte sich finstergrau auf die Landschaft. Wind peitschte über die Hügel und verwirbelte Reriks Haar. Er weilte auf seinem Stein und blinzelte mit tränenfeuchten Augen zum Wald hinüber. Als Deria kam, setzte sie sich neben ihn, obwohl kaum Platz auf dem Felsen war. Ihr Körper war warm und könnte vielleicht die Kälte vertreiben. Rerik faltete die Hände und zwang sich zu einem Lächeln, doch Deria sah ihn nur ernst an.
„Ich hatte gehofft, du würdest mich irgendwann fragen, ob ich dich heiraten möchte“, sagte sie nach einer Weile.
Rerik schluckte. „Das werde ich auch.“
„Aber wann denn?“ Auf Derias Stirn erschienen zornige Falten. „Ich warte seit drei Jahren.“
„Ich muss vorher etwas erledigen“, sagte Rerik matt.
Deria sprang auf. „Vergiss den verdammten Seelenwald! Vergiss Karyan und die Legenden.“
„Du verstehst nicht“, sagte er.
Deria schnaubte laut. „Du denkst, wenn du deine Seele und dein Blut für ein Königreich verkaufst, bist du glücklicher? Was ist mit deinem Leben hier? Ist das so schlecht?“
Rerik starrte sie an. Ihr Gesicht war auch im Zorn noch hübsch, und ihre blauen Augen blickten so klug, dass es wehtat. „Seit wann weißt du es?“
Deria verschränkte die Arme und holte tief Luft. Dann war ihre Stimme wieder ruhiger. „Es ist das mindeste, wenn man jemanden liebt. Du hättest es mir selbst sagen sollen.“
Rerik fixierte die Grashalme. Im Dämmerlicht verloren sie ihre Farbe. Er hatte immer gewusst, was sie sagen würde. Dass er sein altes Leben vergessen solle. Aber das konnte er nicht. Der Magierkönig hatte den Barbarenführer von der Südklippe besiegt. War selbst in die Schlacht geritten. Die Menschen jubelten.
„Wenn ich zurückkomme, werde ich dich zu meiner Königin machen“, sagte Rerik.
„Ich will keine verdammte Königin sein, du dämlicher ...“ Deria stampfte auf und atmete dann durch. „Bin ich nicht jetzt schon deine Königin?“
„Es tut mir leid.“ Die Worte klangen schon hohl, bevor sie seinen Mund verließen.
Deria funkelte ihn noch einen Moment lang an, dann wirbelte sie herum, sodass ihr Zopf flog, und stapfte über die Straße davon. Diesmal folgte Rerik ihr nicht. Der Wald begann zu leuchten, und sein Blut erstarrte. Blaue Wirbel kringelten sich in die Luft. Das Laub der Bäume hing still. Nebel waberte um ihre Stämme.
Rerik erhob sich zitternd von seinem kalten Stein. Der Wind um ihn herum sang. Das Lied schwirrte durch seine Ohren direkt hinter seine Stirn und verursachte einen stechenden Schmerz. Mit jedem Schritt wurde es lauter.
Der Nebelschein teilte sich vor ihm und schloss sich hinter seinem Rücken. Als Rerik den Kopf wandte, konnte er weder den Hügel noch Deria erkennen, nur ein Dickicht aus Bäumen und Dunst. Das Licht strömte über ihn hinweg, ohne zu seiner Quelle zu führen. Er blinzelte langsam und schluckte die Bitternis in seinem Hals hinunter. Dann begann er seine Wanderung in den Wald der Seelen.
Je weiter er ins Unterholz vordrang, umso dunkler wurde es. Es gab keinen Weg, aber manchmal schien es ihm, als würden die Bäume eine Gasse formen. Stille umschwebte ihn und wurde mit jedem Schritt dichter. Ein Schwarm grüner Glühwürmchen flatterte über ihn hinweg. War es schon Nacht geworden? Das Blätterdach über seinem Kopf war so dicht, dass er keinen Himmel erkennen konnte.