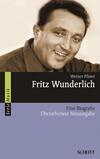Kitabı oku: «Fritz Wunderlich», sayfa 4
Übrigens gab es zur Rundfunksendung »Hausmusik bei Zelter« noch ein kleines Nachspiel: »Etwa drei Wochen später meldete mein Vorzimmer den Besuch einer Dame mit Namen Wunderlich und eines dazugehörigen jungen Herrn«, erzählte Emmerich Smola. »Ich hatte Kusel schon längst vergessen und war überrascht, daß man sich meine Bemerkung von damals… durch den Kopf gehen ließ. Die Frage, wohin zum Studium, wurde schnell geklärt. Ich sagte ihm, er solle nach Freiburg gehen. Er solle aber nicht nur Gesang machen, sondern auch ein Instrument spielen.«24 Ein zweites Mal wurde Fritz von berufener Seite, und das heißt: von einem Berufsmusiker, bestätigt, daß er wirklich eine Stimme und womöglich auch das Zeug zu einem Sänger habe. Bald gesellte sich noch ein drittes fachmännisches Urteil dazu: Auch Joseph Müller-Blattau war von den stimmlichen Qualitäten Wunderlichs überzeugt, und auch er empfahl Freiburg. Er ließ seinen Schützling aber nicht nur so auf gut Glück zur Aufnahmeprüfung hinfahren, sondern gab ihm ein Gutachten mit auf den Weg. Der Name Joseph Müller-Blattau hatte in der musikwissenschaftlichen Fachwelt Gewicht, nach wie vor; darauf konnte sich Fritz verlassen. Das Gutachten ist datiert vom 28. Februar 1950 und lautet:
Der Musiker Fritz Wunderlich verfügt über eine Naturstimme von gutem Sitz und natürlichem Schmelz, ferner über eine ungewöhnliche musikalische Begabung. Die Ausbildung in Kaiserslautern, der er sich unter großen äußeren Schwierigkeiten unterzog (für eine Stunde etwa einen Tag Arbeitsausfall), hat ihn soweit gefördert, daß er die Mikrofonprüfung mit Erfolg ablegen konnte und im Rundfunk zu Nachwuchssendungen herangezogen wurde. Es wäre dringend erwünscht, daß ihm durch eine Ausbildungsbeihilfe die Möglichkeit gegeben würde, eine regelrechte Ausbildung durchzuführen ohne den ständigen Zwang, Tanzmusik machen zu müssen. – Es kann jetzt schon gesagt werden, daß Fritz Wunderlich nach abgeschlossener Ausbildung eine große Zukunft als Sänger hat.
Anfang Oktober fand die Aufnahmeprüfung an der Staatlichen Hochschule für Musik in Freiburg statt. Bis zuletzt hatte Wunderlich bei Käthe Bittel-Valckenberg in Kaiserslautern seine wöchentliche Gesangsstunde gehabt. Nun war er auf den Nachmittag zum Vorsingen bestellt. Das Fahrgeld nach Freiburg mußte er sich leihen, so viel Geld hatte man zu Hause nicht vorrätig. Mit Schubert-Liedern im Gepäck ging Wunderlich am frühen Morgen zum Bahnhof und setzte sich in den letzten Waggon des schon bereitstehenden Zuges. Pünktlich fuhr der Zug in Richtung Landstuhl–Kaiserlautern ab – allerdings ohne Fritz. Denn der letzte Waggon, in dem der Unglückliche saß, war abgekoppelt worden. Was sollte er nun tun? Den Vorsingtermin an der Hochschule in Freiburg durfte er auf keinen Fall verpassen. Guter Rat war teuer, zumal damals nur ganz wenige Züge verkehrten. In Kusel erzählte man deshalb immer wieder die Geschichte von einem Mann, der sich das Leben nehmen wollte und sich aus diesem Grunde quer über das Bahngleis gelegt habe. Zwei Tage später habe man den Armen dann gefunden – aber nicht von der Bahn überfahren, sondern verhungert. Weil in der Zwischenzeit gar kein Zug vorübergefahren sei …
Wie auch immer, plötzlich erinnerte sich Wunderlich, daß jeden Morgen um diese Zeit in der gegenüberliegenden Molkerei ein Lastwagen die Milch nach Kaiserslautern fuhr. Nichts wie los – und er erwischte den Wagen, der eben aus dem Gelände der Molkerei herauskurvte, gerade noch. Allerdings reichte es für den vorgesehenen Anschlußzug in Kaiserslautern nicht mehr, so daß er zu spät in Freiburg eintraf. Zu spät, aber gerade noch rechtzeitig, um als letzter der aufgebotenen Gesangsschüler vorzusingen. Dieses Vorsingen fand im Hauptgebäude der Staatlichen Hochschule am Münsterplatz statt, und zwar im Erdgeschoß im sogenannten ovalen Saal. Alle Hochschulprofessoren saßen versammelt da. Wunderlich sang zwei jener Schubert-Lieder, die er mit Käthe Bittel-Valckenberg einstudiert hatte – darunter den »Wegweiser« aus dem Liederzyklus Die Winterreise. »Und zwar mit einer schönen, aber noch ungepflegten Stimme«, erzählte Jahre später Margarethe von Winterfeldt, die damals die Meisterklasse für Gesang leitete und mit den Professorenkollegen im Auditorium saß. »Mit viel Gefühl sang er und aus warmem Herzen, aber etwas überschwenglich. Und als er fertig war, sagte er: ›War wohl schmalzig, was? Na, genau das will ich hier ja auch lernen: Wie man das anders macht.‹«25 Mehr als die Hälfte der Sänger fiel bei dieser Aufnahmeprüfung durch; Wunderlich bestand und wurde für das kommende Wintersemester als Gesangsschüler angenommen. Als Leiterin der Meisterklasse hatte Margarethe von Winterfeldt die erste Wahl unter den neueintretenden Studenten. Daß sie Fritz Wunderlich sogleich in ihre Meisterklasse aufnahm, überraschte damals keinen: »Allen war eindeutig klar, daß er außergewöhnlich begabt war, trotz dialektaler Ungeschliffenheiten in seiner Aussprache, trotz seines etwas gar kitschigen, sentimentalen Singens.«26
Nun hatte Fritz Wunderlich freie Bahn. Ende Oktober begann das Semester, also mußte er sich sogleich nach einer Bleibe in Freiburg umschauen. Er fand ein Zimmer im Herzen der Altstadt, in der Rempartstraße 3. Ein Zimmer gar mit Klavier, so daß er problemlos üben konnte. Auch einen Lebenslauf mußte er zuhanden der Hochschule verfassen:
Freiburg, 2. Oktober 1950
Lebenslauf
Am 26. September 1930 wurde ich in Kusel als Sohn des Kapellmeisters Paul Wunderlich und seiner Ehefrau Musiklehrerin Anna Wunderlich geboren. Als ich fünf Jahre alt war, verlor ich meinen Vater. Nachdem ich vier Klassen Volksschule hinter mir hatte, trat ich in die Oberschule Kusel ein, wo ich sieben Klassen absolvierte, dann aber infolge finanzieller Schwierigkeiten das Studium abbrechen mußte. Früh schon mußte ich anfangen, die von meinen Eltern übernommene musikalische Begabung zum Broterwerb zu benutzen, indem ich auf Tanzmusiken spielte; meine jetzt 62jährige Mutter und ich waren auf diesen Verdienst angewiesen. Herr Prof. Dr. Joseph Müller-Blattau in Kusel erkannte als erster meine stimmliche Begabung und schickte mich nach Kaiserslautern zu Frau K.B. Valckenberg, wo ich meine erste Ijährige Ausbildung erfuhr.
Auf Tanzmusiken habe ich Akkordeon und Waldhorn gespielt. Auch im Orchesterspiel habe ich mir eine gewisse Routine angeeignet. Im Orchester der Stadt Kusel habe ich nur Waldhorn geblasen.
HochachtungsvollFritz Wunderlich
Zu Hause in Kusel wurde er mit großem Hallo empfangen. Es war beschlossene Sache, ihm eine würdige Abschiedsfeier zu bereiten. Gefestet wurde bei der Mutter zu Hause, zusammen mit den Kameraden aus dem Städtchen und den Kumpels von der Tanzkapelle. »Wenn Fritz mit seiner Tanzkapelle jeweils in den umliegenden Dörfern aufspielte, aß er stets unheimlich gerne Waffelbruch«, erzählte seine Schwester, »Abfälle von gefüllten Zuckerwaffeln, die an den Kirmessen in bunten Tüten verkauft wurden. Für das Abschiedsfest erstanden seine Musikerkumpels bei einem Großhändler einen ganzen Karton mit hundert solcher Waffeltüten und schenkten sie Fritz zum Abschied. Aus lauter Freude improvisierte dieser mit seinen Kollegen sogleich eine ›Waffelbruch-Oper‹. Jeder hatte ja sein Instrument bei sich, passende Texte wurden aus dem Stegreif ersonnen, und Fritz dirigierte das Ganze vom Klavier aus.«27
DRITTES KAPITEL
» … die entscheidende Phase meines Lebens …« : Studienjahre in Freiburg
»Es ist merkwürdig, wenn man beim Eintritt in das alte, schöne Wenzingerhaus am Domplatz in Freiburg aus allen Ecken Musik von Strawinsky, Hindemith, Bartók und anderen neuen Komponisten hört. Und es scheint fast paradox, daß man in diesem alten Bau die modernste Musikhochschule Deutschlands finden soll. Hier gibt es keine modernen und zweckmäßigen Unterrichtsräume, keine Teppiche, keine gepolsterten und schallsicheren Doppeltüren und keine repräsentativen Professorenheiligtümer. Manche Räume sind nur mit einem Flügel, einer schlichten Holzbank und allenfalls noch mit einem Notenpult möbliert. Das ›Büro‹ des Direktors ist eine winzige Klause mit einem alten Schreibtisch und einem Sessel.« Zu lesen war das in der Illustrierten Funkwelt. Sie informierte ihre Leserschaft über eine bevorstehende Sendung des SWF mit dem Titel »Kunst, die nicht verdirbt«, und der Untertitel machte klar, worum es gehen werde: »Deutschlands modernste Musikhochschule in Freiburg«.
Staatliche Hochschule für Musik hieß sie offiziell, gleich neben dem Münster im Wenzinger-Palais untergebracht, einem der wenigen Häuser, die während des Krieges nicht beschädigt wurden. Daß die Illustrierte Funkwelt für dieses moderne Institut im alten, stilvollen Rokokogebäude voller Bewunderung war, hatte seine guten Gründe: »Bekannte Künstler … bilden den Lehrkörper der Schule. Es sind alles Persönlichkeiten, die neben ihren großen fachlichen Qualitäten es vor allem verstehen, menschlichen Kontakt mit den Schülern zu bekommen. Die Zahl der Schüler darf 240 nicht überschreiten … Die Auswahl der Studenten, die aufgenommen werden, geschieht nach außergewöhnlich strengen Maßstäben. Man vermeidet dadurch in diesem Beruf, zu dem sich immer noch viele junge Menschen drängen und der so wenigen materielle Existenz im späteren Leben bietet, den Zulauf von nur durchschnittlichen Begabungen..«28
Diesen gestrengen Maßstäben hatte Fritz Wunderlich standzuhalten vermocht. Nun schrieb er sich zum Studium ein: Im Hauptfach belegte er Gesang in der Meisterklasse Margarethe von Winterfeldts. Weiter schrieb er sich für das zweite Hauptfach bei Lothar Leonards ein, dem ersten Hornisten im Städtischen Orchester in Freiburg und Leiter einer Fachklasse für Horn. Als Nebenfach belegte er Klavier bei Friedrich Finke. Das Nebenfach war, laut der auf Fritz Wunderlich ausgestellten Karteikarte der Freiburger Musikhochschule, gebührenfrei. Der Hornfachklassenunterricht kostete dagegen 100 Mark pro Semester, und für die Gesangsmeisterklasse mußte er gar 280 Mark hinblättern. Die Mutter hatte ihm zum Abschied eine ganze Monatsrente mitgegeben, 89 Mark. Nicht einmal für den Start in Freiburg würde dieses Geld ausreichen, bei weitem nicht. Also mußte sich Wunderlich schleunigst nach Verdienstquellen umsehen.
Die Freiburger Musikhochschule wurde im ersten Nachkriegsjahr, am 26. Februar 1946, gegründet. Initiator war Gustav Scheck, damals einer der führenden Flötisten. Bis 1945 hatte er als Dozent für Flöte an der Berliner Musikhochschule unterrichtet. Dann setzte er sich nach Überlingen an den Bodensee ab, um dort das Ende des Krieges abzuwarten – und zu überleben. Nach wiederholten Verhandlungen wurde Scheck im Februar 1946 mit der Gründung einer Musikhochschule in Freiburg beauftragt, und zwar in Zusammenarbeit mit Wilibald Gurlitt, damals Ordinarius für Musikwissenschaft an der Freiburger Universität. Der Oberbürgermeister hatte ihnen freie Wahl unter den wenigen geeigneten, heil gebliebenen Gebäuden der fürchterlich zerstörten Stadt angeboten, und so wählten sie das Palais »Zum Schönen Eck« am Münsterplatz, welches der Rokokobaumeister, Maier und Bildhauer Christian Wenzinger sich im Jahr 1761 errichtet hatte.
Am 1. Mai erfolgte die Berufung Schecks zum Direktor der Musikhochschule; am 6. Mai konnte der Unterricht beginnen. Scheck hatte eine imposante Reihe bedeutender Künstler und Musikhistoriker als Lehrkräfte für die Meisterklassen nach Freiburg geholt: Harald Genzmer (Komposition), Reinhold Hammerstein (Musikgeschichte und Formenkunde), Fritz Neumeyer (historische Tasteninstrumente), Carl Seemann (Klavier) und Margarethe von Winterfeldt (Gesang). Bis 1950 kamen Jahr für Jahr neue Lehrkräfte hinzu: unter ihnen Walter Kraft (Orgel), Edith Picht-Axenfeld (Klavier), Emil Seiler (Viola), Lothar Leonards (Horn), Ulrich Grehling (Violine) und Friedrich Finke (Klavier). Durchaus verständlich also, daß die Illustrierte Funkwelt in begeisterten Tönen von der modernsten Musikhochschule berichtete. Die Entwicklung in den ersten paar Jahren übertraf denn auch alle Erwartungen. Es kamen nicht nur Studierende aus Deutschland und den europäischen Nachbarländern, sondern auch aus den USA, aus Brasilien, Ägypten, England und aus der Türkei nach Freiburg. Ein erfolgreicher Start, was bald auch von staatlicher Seite anerkannt wurde: Am 1. April 1948 wurde die Musikhochschule von Baden-Württemberg übernommen und firmierte fortan als Staatliche Hochschule für Musik.29
Anfänglich kam sich Fritz Wunderlich recht verloren vor inmitten dieser illustren Gesellschaft von Studenten aus allen Himmelsrichtungen. »Ich hatte die Welt praktisch nur bis Kaiserslautern gesehen und kannte bis dahin keinen Menschen außer meinem engsten Freundeskreis«, erzählte er Jahre später. »Freiburg – für mich war das damals eine vollkommen neue Welt …«30 Der Sprung von Kusel nach Freiburg machte ihm zu schaffen, löste in ihm eine Art Kulturschock aus. Weite Teile der Stadt waren im November 1944 zerstört worden; rundherum lagen immer noch Trümmer. Oft sehnte sich Wunderlich nach der ländlichen Geborgenheit seiner pfälzischen Heimat. Zum ersten Mal war er weg von zu Hause, herausgerissen aus der Umgebung seiner Kindheit. Neues stürmte auf ihn zu, drängte sich an den Platz der alten Lebensgewohnheiten. Verunsicherung machte sich breit. Zuweilen stieg er die unzähligen Treppen des Freiburger Münsterturms empor, um allein, in schwindelnder Höhe, einen Blick in Richtung Heimat zu werfen. Heimweh spürte er, und oft litt er an seiner Liebe zu dieser Heimat und zu den Erinnerungen, die ihn mit ihr verbanden. Aus einer solchen Stimmung heraus schrieb er, noch in den ersten Freiburger Monaten, hoch oben auf dem Münsterturm ein paar Verse auf, die Jahre später – und von ihm selbst vertont – ihre Reise rund um die Welt antreten sollten:31
Mein Kusel in der Pfalz
Wir saßen einst im Freundeskreis
im schönen Schwarzwaldort.
Der Abendwind sang draußen leis,
und keiner sprach ein Wort.
Der eine war vom Nordseestrand,
der andre kam aus Wien.
Der dritte kam vom Schwabenland,
der andre aus Berlin.
Das Heimweh war bei uns zu Gast,
schlich sacht sich ins Gemüt,
der Wind hat’s Heimweh angefaßt,
trägt heimwärts auch mein Lied:
Ein Städtchen ist’s im Pfälzerland,
ein Tal, so wunderschön –
Dort ist’s, wo meine Wiege stand,
wo meine Träume gehn.
Die alte Burg schaut stolz ins Tal,
erzählt von alter Zeit,
sie sah mich schon so manches Mal
als Kind voll Fröhlichkeit.
Der Mühlberg sah unser frohes Spiel,
der Bach war unser Meer,
der Wald war unser liebstes Ziel,
ihn liebte ich so sehr.
Zieh in die Welt ich einmal fort,
dann bitt’ ich Gott: »Erhalt’s,
mein Städtchen, meinen Heimatort,
mein Kusel in der Pfalz!«
Es war in einer musikwissenschaftlichen Vorlesung bei Reinhold Hammerstein. Fritz Wunderlich war hier ein seltener Gast, die graue Theorie schien ihn nicht sonderlich zu interessieren. Viel lieber wollte er musizieren als über die Ursprünge und die Entwicklung der Musik in Geschichte und Gegenwart nachdenken. Dem gegenübersitzenden Studenten schien solche Reflexion an jenem Tag auch Mühe zu machen. Jedenfalls flüsterte er Fritz etwas von seiner mißlichen Wohnlage zu, worauf dieser impulsiv entgegnete: »Herr Kollege, suchen Sie ein Zimmer mit Klavier?« Selbst unter Studenten verkehrte man damals per Sie. »Fritz flüsterte, daß man in sein Zimmer noch ein zweites Bett reinstellen könne«, erzählte Hans-Martin Hackbarth, Schulmusiker und Gesangsstudent wie Wunderlich. »Und so wohnten wir, etwa ab Dezember 1950, zusammen, im Zimmer in der Rempartstraße, jeder für fünfzehn D-Mark im Monat.«
Man lebte zu zweit zwar recht eng aufeinander, konnte sich aber doch ausweichen. Oder einander aushelfen. »Fritz war ein herrlicher Langschläfer. Ich konnte am Morgen jeweils Klavier üben, und er schlief fröhlich weiter. Beim Morgenkaffee sagte Fritz oft: ›Du, Hackbraten, geh doch mal für mich zum Finke. Ich will heute nicht in den Klavierunterricht!‹«32 Hackbraten war Hackbarths Spitzname – und damit hatte es eine ganz besondere Bewandtnis. Mutter Wunderlich konnte ihrem Sohn zwar nicht mit Geld helfen, aber hie und da bot sich Gelegenheit, zu günstigen Bedingungen Fleisch zu kaufen. »Mein Mann kannte damals den Metzger einer Nachbargemeinde«, erzählte Schwester Marianne, »und er bekam von diesem oft einen Tip: daß beispielsweise ein verunglücktes Tier zum Schlachten angeliefert worden sei und man also Fleisch bekommen könne.« Der Mutter waren solche unverhofften Fleischportionen ebenfalls willkommen. Stets verfertigte sie daraus einen Hackbraten, den sie umgehend ihrem Sohn zukommen ließ, damit dieser wieder einmal etwas Richtiges zum Essen habe. Lange Zeit über dankte Fritz auch regelmäßig für diesen Zustupf. »Doch eines Tages schrieb er der Mutter, sie solle doch bitte mal was anderes schicken als immer nur Hackbraten. Sein Zimmergenosse könne nämlich Hackbraten kaum mehr sehen, geschweige denn essen.«33
Morgens konnte es also vorkommen, daß Hackbarth für Wunderlich in den Klavierunterricht ging. Auch abends wußten sich die beiden zu arrangieren. »Wir hatten nur einen einzigen Hausschlüssel. Wenn nun einer abends länger weg war, so mußte der andere den Schlüssel aufs Fensterbrett legen, und zwar an einer langen Schnur festgemacht. Der Spätheimkehrer warf dann ein Steinchen gegen das Fenster, um den schon Schlafenden zu wecken. Dieser ließ den Schlüssel an der Schnur hinunter, und so konnte die Haustür aufgeschlossen werden.« Manchmal waren sie sich allerdings nicht einig, wer zu Hause bleiben sollte oder umgekehrt: wer ausgehen durfte. »Einmal wollte Fritz durchaus Skat spielen. Ich aber sagte: ›Nein, ich geh’ zu meiner Freundin‹, und kam erst spät in der Nacht nach Hause. Fritz lag schon im Bett, ich suchte meinen Schlafanzug, doch ich suchte lange vergeblich – Fritz hatte ihn unter den Klavierdeckel geschoben. Nun wollte ich reinschlüpfen, kam aber nicht rein: Die Ärmel waren zugenäht und auch die Beine. Der entsprechende Kraftausdruck meinerseits ließ selbstverständlich nicht auf sich warten – und Fritz schüttelte sich vor Lachen. Dann warf ich mich aufs Bett, flog aber gleich wieder raus: Fritz hatte mir leere Bierflaschen unter die Matratze geschoben.«
Wie gesagt: Schon in den ersten Wochen sah sich Fritz nach einem Verdienst um. Für sein Studium und seinen Lebensunterhalt mußte er selber aufkommen, Unterstützung gab es keinerlei. Naheliegend war, daß er es wiederum mit Tanzmusik versuchte wie schon in Kusel; Erfahrungen hatte er ja genug gesammelt. Hackbraten wollte am Klavier mitmachen – warum es nicht einmal ausprobieren? Und zwar unten in ihrem Haus in der Rempartstraße, in der Gastwirtschaft »Breisacher Hof«. Das war zwar ein etwas verrufenes Lokal, und man hörte oft von nächtlichen Messerstechereien munkeln. Die Wirtin war einverstanden: Man könne das durchaus mal versuchen, am liebsten an Wochenenden. »Und so spielten wir sozusagen auf Abruf, oft schon am Freitag, meistens am Samstag und, wenn Betrieb war, auch am Sonntag. Stets von acht Uhr abends bis um Mitternacht.« Fritz spielte Akkordeon und, mit dem Fuß per Pedal, die große Trommel; Hackbraten begleitete am Klavier. »Um Mitternacht ging dann der Rausschmeißer in der Gaststätte von Tisch zu Tisch und sammelte Geld für uns. Fünf, manchmal sogar zehn Mark schauten da für jeden heraus. Und nachher saß man noch zusammen und spielte ein bißchen Skat.«
Auch zusammen gesungen haben die beiden. »Und wenn Fritz einen ganz tollen drauf hatte, imitierte er den Jazztrompeter Louis Armstrong, ›Blueberry Hill‹ zum Beispiel, und zwar mit seiner Trompete. Auch gesungen hat er dann wie Armstrong. Eine umwerfend komische Parodie.«34 Einige Monate später vergrößerte sich das Duo zum Trio. Ein weiterer Schulmusikstudent, der im selben Haus ein Dachzimmer bewohnte, übernahm nun das Schlagzeug, Fritz spielte weiterhin Akkordeon und Trompete, und Hackbarth begleitete am Klavier. Nach ungefähr einem Jahr trennten sich dann ihre Wege als Unterhaltungsmusiker. Fritz fand Anschluß an eine andere Band, an »Die flotten Fünf«. Oft musizierte er übers Wochenende auch außerhalb von Freiburg, in den umliegenden Landgaststätten und Bierlokalen. Oder er spielte bei Abendveranstaltungen auf. Das muß recht professionell geklungen haben, denn bald kriegten sie fünf D-Mark Honorar pro Stunde.
Während der ersten drei Semester setzte Wunderlich vor allem auf das Hornstudium, denn sollte es mit dem Gesang nicht klappen, so wollte er zumindest ein guter Hornist werden. »Schon das erste Begegnen mit ihm war sehr erfreulich«, erzählte Fachklassenlehrer Lothar Leonards. »Er war hochmusikalisch und hatte schon ein wenig Horn geblasen … Die erste Begegnung mit ihm ist für mich unvergeßlich: Sein Horn sah so ›marmoriert‹ aus. Ich fragte ihn, was mit seinem Horn denn wäre, und da sagte er, da wäre eben ein Lastwagen drüber gefahren, und er habe das Horn anschließend wieder ausbeulen lassen…«35
Interessanter und spannender war zweifellos der Gesangsunterricht. Zweimal die Woche stieg Wunderlich im Wenzingerhaus die Treppe hoch ins erste Stockwerk hinauf, wo Margarethe von Winterfeldt in einem Eckzimmer, das zum Münsterplatz hinausging, ihren Unterricht erteilte. Sie stammte aus Potsdam, war von Kindheit an blind, aber von einer unwahrscheinlichen Auffassungsgabe. Sie hatte Klavier und Gesang studiert und wirkte anschließend als Konzertsängerin. Früh schon widmete sie sich der pädagogischen Tätigkeit, anfänglich in Berlin und später, nach Kriegsende, in Freiburg, wo sie eine Meisterklasse für Gesang übernahm. »Sie war ein Mensch, der mit allen Sinnen einen anderen Menschen erfaßt«, erzählte später Dorothea Goesch. Sie hatte Margarethe von Winterfeldt kurz vor Kriegsende kennengelernt und war ihr dann, als persönliche Begleiterin und Betreuerin, nach Freiburg gefolgt, wo sie als Dozentin eine eigene Gesangsklasse unterrichtete. »Wir haben zusammen gewohnt, hatten ja auch denselben Beruf und dieselben Sorgen. Zudem habe ich sie auch zu ihren Konzertauftritten hinbegleitet; allein konnte die blinde Dame ja nicht reisen. Dennoch: Wenn man auch nur fünf Minuten mit ihr an einem Tisch saß, vergaß man völlig, daß sie blind war. Auffälligerweise hatte sie in ihrem Vokabular auch den Ausdruck: ›Das habe ich gesehen…‹«36
Schon in den ersten zwei, drei Semestern fiel auf, daß Fritz Wunderlichs Gesang ausgesprochen natürlich klang, daß da nichts Gekünsteltes war und nichts angelernt wirkte. Genau darauf hatte es Margarethe von Winterfeldt in ihrem Gesangsunterricht auch abgesehen: »Das ist ja das Ziel, das wir alle gerne erreichen wollen … Aber das heißt nicht, daß den jungen Sängern, auch wenn sie sehr begabt sind, alles sozusagen in den Schoß fällt. Sondern sie müssen arbeiten, und zwar streng arbeiten. Und das konnte Wunderlich, denn er war Arbeit gewöhnt von zu Hause her.«37 Begabt war Wunderlich zweifellos, das war schon bei seinem Vorsingen aufgefallen. Später bestätigten das auch seine Kommilitonen: Fritz hätte ebensogut bei einem Schuster singen lernen können oder bei einem Schreiner, hieß es manchmal.38 Dennoch war Margarethe von Winterfeldt außerordentlich wichtig für ihn. Sie gab ihm Rückenstärkung, und dies nicht nur in sängerischer und musikalisch-künstlerischer Hinsicht. Sondern sie ersetzte ihm in gewissen Bereichen auch seine Mutter, brachte ihm einigermaßen weltmännische Manieren bei und half ihm so, jenen Kulturschock zu überwinden, den die Übersiedlung von Kusel nach Freiburg ausgelöst hatte.
Zwei Dinge aber waren, rückblickend beurteilt, in Wunderlichs Gesangsausbildung von zentraler Bedeutung. Zum einen, daß Margarethe von Winterfeldt den jungen Sänger stets auf seinen ureigenen Instinkt verwies, ihm also Selbstbewußtsein einflößte und ihn auf seine Gefühle vertrauen lehrte. Und zum andern, daß sie ihn stets anhielt, sich alle Vorgänge beim Singen bewußt zu machen. Gesang sollte ja etwas Natürliches sein. Also mußte er auch auf natürlichen Voraussetzungen basieren. Und Wunderlich sollte sich nun im Verlaufe des Unterrichts all dieser natürlichen Vorgänge bewußt werden und sie über das Bewußtsein auch kontrollieren lernen. Wenn er jeweils ins Unterrichtszimmer trat, saß die Lehrerin schon am Flügel. Gesprächsweise versuchte sie, zu Beginn jeder Gesangsstunde die momentane Alltagsverfassung ihres Studenten zu erspüren, auch seine Sorgen und Nöte. Wenn sie merkte, daß er keinen guten Tag hatte und innere Spannungen da waren, stellte sie sich darauf ein. Nie hätte sie sich in einem solchen Moment auf ein bestimmtes Unterrichtspensum versteift.
Ihr Unterricht war im wesentlichen ein technischer Unterricht: Intonations- und Resonanzübungen, Intervalle singen und immer wieder Atemübungen. Grundlage sollte die normale Atmung sein; also kein Stützatem oder Preßatem. Und beim Tiefatmen nicht die Schultern hochziehen. Denn das bewirkt augenblicklich eine Verspannung der Schultermuskulatur. Anschließend das Ausatmen: Langsam mußte Fritz, die Lippen zugespitzt, die Luft herausblasen und spüren lernen, wie sich, sobald man die Lippen stärker schürzt, in der Bauchgegend ein Gegenreflex einstellt. Eine Art von Gegendruck, der dem Sänger das Gefühl einer inneren Luftsäule vermittelt, die von der unteren Bauchgegend bis zu den geschürzten Lippen hinauf reicht. Wie wichtig es für einen Sänger ist, sich dieser Vorgänge bewußt zu werden, hat Fritz Wunderlich später wiederholt betont: »Eigentlich ist es so: Einen langen Atem hat man genau so, wie man eine Stimme hat. Aber man kann einen langen Atem dadurch verlängern, daß man weiß, wie man es gesangstechnisch anstellt, keine Luft zu verschenken zwischen den Tönen. Es wird da viel zu wenig darauf geachtet von seiten der Gesangslehrer. Langer Atem heißt zunächst einmal: Wie wird der Körper mit dem Stickstoff fertig, der sich dadurch ansammelt, daß man die Luft anhält? Man singt ja mit verbrauchter Luft und nicht mit frischer, und der Körper will eben nach einer gewissen Zeit Sauerstoff haben. Und langen Atem kann man trainieren, indem man Atemübungen macht. Wie ein Taucher.«39
Atmen und Singen, Atemführung und Stimmführung gehörten für Margarethe von Winterfeldt aufs engste zusammen. Entsprechend hielt sie ihre Gesangsschüler an, über das Ausatmen nach den Resonanzen zu suchen. Zum Beispiel durch ein langgezogenes W-w-w. Oder durch die Vokale U und Ü, die beide hervorragende Resonanzsucher sind. Gesucht und ausprobiert wurden diese Resonanzen zur Hauptsache beim Singen von Intervallen auf einzelnen Vokalen. Es kam darauf an, die Resonanzfarben in allen Tonhöhen möglichst gleichzuhalten. »Bewußt sprach die Winterfeldt dabei nie von Registern«, betonte Dorothea Goesch, »daß die Bruststimme von da bis da reiche, die Mittellage von da bis da und so weiter. Denn sie war der Ansicht, daß einer, der das mal so richtig eingetrichtert bekommen hat, innerlich sozusagen unüberwindliche Grenzen aufbaut: Zäune, die völlig künstlich sind. Und beim Singen steht dann ein einziger Gedanke unentwegt im Vordergrund: Wie komme ich jetzt über diesen Zaun?«40
Im ersten Studienjahr muß es gewesen sein, als der Postbote eines Tages bei Mutter Wunderlich in Kusel Sturm läutete. Ein Telegramm, aus Freiburg:
Habe Radio gewonnen – stop – bin überglücklich – stop – dein Bub.
»Fritz hatte in einem Kaufhaus ein Überhemd im Sonderangebot gekauft«, erzählte seine Schwester Marianne. »Der Zufall wollte es, daß er der 500ste oder 1000ste Kunde war, der ein solches Überhemd kaufte, und auf diesen wartete als Geschenk ein kleines Radio, ein Volksempfänger, auf dem man mehrere Sender empfangen konnte. Und impulsiv, wie er war, hat er sofort ein Telegramm aufgegeben.«
Während der Semesterferien ging Fritz stets nach Hause. »Kaum eine halbe Stunde später standen jeweils schon seine Kumpels vor der Haustür. Fritz suchte schleunigst seine alten Fußballklamotten zusammen, und ab ging die Post.« Fritz kam gerne nach Hause, vor allem der Mutter wegen. Mit ihm erlebte sie im Kreis seiner Jugendfreunde gesellige Stunden, wo man oft bis spät in die Nacht beisammensaß. Seiner Lebensfreude, seiner prallen Vitalität konnte keiner widerstehen. Manchmal schien es, als vermöchte er damit alle Hindernisse, die ihm irgendwo in den Weg gelegt waren, mühelos wegzuschwemmen. Humor, zuweilen auch deftige Lustigkeit, verbreitete er überall, wo er auftauchte. Doch die Kehrseite war zuweilen genauso spürbar: Wenn Fritz, eben noch in lautstarker Ausgelassenheit mit den Kollegen herumalbernd, die gesellige Runde plötzlich verließ und allein sein wollte. Wenn man ihm nachging und ihn nach Gründen fragte, so gab er allenfalls zur Antwort: »Ach, es ist alles so traurig.«41 Oft plauschte Fritz auch mit seinen beiden Neffen herum, den Söhnen von Schwester Marianne, baute mit ihnen einen Rennschlitten, der dann schon auf der Jungfernfahrt in Brüche ging, oder einen Drachen.
Zur Weihnachtsfeier 1950 brachte Fritz seiner Mutter ein besonderes Geschenk: eine selber komponierte Arie für Tenor und Klavier mit dem Titel Mutterliebe. Das Titelblatt, mit eigenhändig gezeichneten Weihnachtstannenästchen verziert, weist auch eine Widmung auf: »Meiner treusorgenden Mutter dankbar zugeeignet, Weihnachten 1950.« Ein großartiger Dank an die Mutter, weil sie ihn studieren ließ. Auch das Abschlußdatum dieser Weihnachtskomposition ist säuberlich vermerkt: »Freiburg, am 5. Dezember 1950, F. Wunderlich.« Das kleine Werk, drei Seiten Notenhandschrift umfassend, gliedert sich in ein einleitendes Rezitativ und ein anschließendes Arioso. Komponieren, Texten und Arrangieren: Darin hatte Fritz Wunderlich seit seinen frühen Auftritten mit den »Hutmacher«-Tanzmusikkumpels weitreichende Erfahrungen. Ganze Unterhaltungsprogramme hatte er damals zusammengestellt und arrangiert. Einiges ist handschriftlich von ihm überliefert: unter dem Titel Frohsinn etwa eine Folge »beliebter Walzerlieder«, wie es im Untertitel heißt, von »Kornblumenblau« über »Der alte Peter«, »Gib acht auf den Jahrgang«, »Einmal am Rhein« und »Trink, trink, Brüderlein trink« bis hin zum großen Finale »Oh du wunderschöner deutscher Rhein« reichend, mit Ritardando und im Fortissimo zu beenden. Alle diese Walzerlieder hat Wunderlich mit einfachsten Akkorden harmonisiert. Eingeleitet werden sie mit einem achttaktigen Vorspiel; zwischen den einzelnen Liedern hat er knappe Überleitungen komponiert, um – harmonisch einigermaßen anstandslos – über die Runden, und das heißt: in die neue Tonart des nächstfolgenden Liedes zu kommen. Auch hier schien er der Devise zu vertrauen, daß es im entscheidenden Moment letztlich vor allem auf den eigenen Instinkt ankomme.