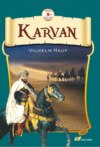Kitabı oku: «Lichtenstein», sayfa 9
Kapitel 16
Als die runde Frau und Bärbele von der Bodenkammer herabstiegen, war ihr erster Gang nicht in das Gemach, wo ihr Gast war, sondern nach der Küche, und zwar aus zweierlei Gründen: Einmal, weil jetzt dem Gast ein kräftiges Hafermus gekocht werden mußte, und dann—von der Küche ging ein kleines Fenster in die Stube, dorthin stellte sich die Mutter, um die Mienen des Junkers zu rekognoszieren.
Bärbele stellte sich auf die Zehen und schaute ihrer Mutter über die Schulter durchs Fensterlein. Sie staunte, und ihr Herz pochte seit siebzehn Jahren zum ersten Mal recht ungestüm:
Denn so hübsch hatte sie sich doch den Junker nicht gedacht. Sie war zwar oft von seinem Anblick bis zu Tränen gerührt gewesen, wenn er mit starren Augen, ohne Bewußtsein, beinahe ohne Leben da lag. Seine bleichen, noch im Kampf mit dem Tod so schönen Züge hatten sie oft angezogen, wie ein rührendes, erhabenes Bild den frommen Sinn einer Betenden anzieht. Aber jetzt, sie fühlte es, jetzt war es was ganz anderes. Die Augen waren wieder gefüllt von schönem, mutigem Feuer; es wollte dem Bärbele auf den Zehen bedünken, als habe sie, so alt sie geworden, noch gar keine solchen gesehen. Das Haar lag nicht mehr in unordentlichen Strängen um die schöne Stirn. Es fiel geordnet und reich auf den Nacken hinab.
Seine Wangen hatten sich wieder gerötet, seine Lippen waren so frisch wie die Kirschen an Petri und Paul. Und wie ihn das seidengestickte Wams gut kleidete, und der breite weiße Halskragen, den er über das Kleid heraus gelegt hatte! Aber das konnte das Mädchen nicht ergründen, warum er wohl immer wieder auf eine aus weiß und blauer Seide geflochtene Schärpe nieder sah. So fest, so eifrig, als wären geheimnisvolle Zeichen eingewoben, die er zu entziffern bemüht sei. Ja, es kam ihr sogar vor, als drücke er die Feldbinde an das Herz, als führe er sie an die Lippen voll Andacht und Inbrunst, wie man Reliquien zu verehren pflegt.
Die runde Frau hatte indessen ihre Forschungen durch das Fensterlein beendet. "'s ist a Herr wie na Prinz", sagte sie, indem sie das Hafermus umrührte. "Was er a Wammes a hat! Dia Herra z'Stuagert kennet's et schöner hau. Was duet er no mit dem Fetza, won er in der Hand hot? Er guckt a so schier ausenander! Es ist, ka sei, a bisle Bluat na komme, daß ens verzirnt."
"Noi, sell isch et", entgegnete Bärbele, die jetzt bequemer das Zimmer übersehen konnte. "Aber wisset Er, Muater, wia mers fürkommt? Er macht so gar fuirige Auga druf na. Sell ist gewiß ebbes von seim Schatz."
Die runde Frau konnte sich nicht enthalten, über die richtige Vermutung ihres Kindes ein wenig zu lächeln, doch schnell nahm sie ihre mütterliche Würde wieder zusammen, indem sie entgegnete: "A, was woist Du von Schätz! So na Kind wie Du muaß gar a nix so denka. Gang jetzt weg vom Fensterle dort, lang mir sell Häfele her. Der Herr wir a fürnehmes Fressa g'wohnt sei, i muaß am a bisle viel Schmalz in de Brei dauh."
Bärbele verließ etwas empfindlich das Fenster. Sie wußte, daß sie ihrer Mutter nicht widersprechen dürfe, aber diesmal hatte diese offenbar unrecht.
Das Frühstück des Junkers war indessen fertig geworden, es fehlte nichts mehr als ein Becher guten alten Weines. Auch dieser war bald hereingebracht, denn der Pfeifer von Hardt war zwar ein geringer Mann, aber nicht so arm, daß er nicht für feierliche Gelegenheiten ein Fäßchen im Keller liegen hatte. Das Mädchen trug den Wein und das Brot, und die runde Frau ging in vollem Sonntagsstaat, die Schüssel mit Hafermus in beiden Fäusten, ihrem holden Töchterlein voran in die Stube.
Es kostete den jungen Mann nicht geringe Mühe, den vielen Knixen der Pfeifersfrau Einhalt zu tun. Sie hatte in ihrer Jugend einmal auf dem Schloß zu Neuffen gedient und wußte, was Lebensart war. Daher blieb sie mit der rauchenden Schüssel an ihrer eigenen Schwelle stehen, bis ihr der gestrenge Junker ernstlich befahl, vorzutreten. Die Tochter aber stand errötend hinter der runden Frau, und ihr verschämtes Gesicht wurde nur auf Augenblicke sichtbar, wenn die Mutter sich recht tief verneigte. Auch sie machte die gehörige Anzahl Knixe, doch mochten sie nicht so ungemein ehrerbietig sein, denn sie hatte ja schon ein halbes Stündchen mit ihm geplaudert.
Das Mädchen deckte jetzt den Tisch mit frischem Linnen, setzte dem Junker das Hafermus und den Wein an den Ehrenplatz in der Ecke der Bank unter dem Kruzifix. Dann steckte sie einen zierlich geschnitzten, hölzernen Löffel in das Mus. Er blieb aufrecht darin stehen, und es war dies ein gutes Zeichen, daß das Frühstück delikat bereitet sei. Als der Junker sich niedergelassen hatte, setzten sich auch Mutter und Tochter an den Tisch zu ihrem Suppennapf, doch in bescheidener Entfernung, und nicht, ohne das Salzfaß zwischen sich und ihren vornehmen Gast zu stellen. Denn so wollte es die Sitte in den guten alten Zeiten.
Georg hatte, während sie das Frühmal verzehrten, Muße genug, die beiden Frauen zu betrachten. Er gestand sich, daß die Hausehre des Pfeifers von Hardt eine stattliche Frau sei, die vielleicht manchen weniger kühnen Mann als seinen Führer und Erretter unter die Stelzen ihrer gewichtigen Schuhe (Pantoffeln hatte sie wohl nicht) gebracht hätte. Auch das Kind des Spielmanns dünkte ihm eine liebliche Dirne, und ein so schöner Kopf, solche freundlichen Augen hätten vielleicht in seinem Herzen einen nicht zu verachtenden Raum gewonnen, wäre es nicht von einem Bild schon ganz erfüllt gewesen, wäre nicht die Kluft so unendlich groß gewesen, welche Geburt und Verhältnisse zwischen den Erben des Namens Sturmfeder und der geringen Tochter des Pfeifers von Hardt befestigt hatten. Nichtsdestoweniger ruhten seine Blicke mit Wohlgefallen auf ihren reinen, unschuldigen Zügen, und wäre die runde Frau nicht mit ihrer Suppe zu beschäftigt gewesen, so wäre ihr wohl die Röte nicht entgangen, die auf den Wangen ihres Kindes aufstieg, wenn zufällig einer ihrer verstohlenen Blicke dem Auge des jungen Mannes begegnete.
"Der Napf ist leer, jetzt ist es Zeit zu schwatzen." Dieser richtige Spruch galt auch hier, sobald das Tischtuch weggenommen war. Georg lagen vornehmlich zwei Dinge am Herzen: Er mußte gewiß sein, wann der Pfeifer von Lichtenstein zurückkommen würde, weil er nur seine Nachrichten über die Geliebte abwarten wollte, um dann sogleich zu ihr zu eilen. Und zweitens war es ihm sehr wichtig, zu erfahren, wo das Heer des Bundes in diesem Augenblick stehe. Über das Erstere konnte er keine weitere Auskunft erhalten, als was ihm das Mädchen früher schon gesagt hatte. Der Vater sei etwa seit sechs Tagen abwesend, habe aber versprochen, am fünften Abend wieder hier zu sein, und sie erwarteten ihn daher stündlich Die runde Frau vergoß Tränen, indem sie dem Junker klagte, daß ihr Mann, seitdem dieser Krieg begonnen, kaum einige Stunden zu Hause gewesen sei. Er sei von trüberen Zeiten her schon als ein unruhiger Mann berüchtigt. Jetzt murmeln die Leute auch wieder allerlei über ihn, und gewiß bringe er seine Frau und sein Kind durch sein gefährliches Leben noch in Unglück und Jammer.
Georg suchte alle Trostgründe hervor, um ihre Tränen zu stillen. Es gelang ihm wenigstens so weit, daß sie ihm seine Fragen nach dem Bundesheer beantwortete.
"Ach, Herr", sagte sie, "des ist a Graus und a Jomer. 'S ist grad, wie wenn der wild Jäger uf de Wolka reitet, und mit seine g'schpenstige Hund übers Lager wegzieht. 'S ganz Unterland hent se schau, und jetzt goht's mit em hella Haufe ge Tibenga."
"So sind die Festungen alle schon in ihrer Hand?" fragte Georg verwundert. "Hellenstein, Schorndorf, Göppingen, Teck, Urach? Sind sie alle schon eingenommen?"
"Älles hent se. A Mann vo Schorndorf hot's g'sait, daß se de Hellastoi, Schorndorf und Göppinga hent. Aber von Teck und Aurich kan e Uich ganz gnau berichta, mer send jo koine drei, vier Stund davo." Sie erzählte nun: Am dritten April sei das Heer vor Teck gezogen. Sie hätten einen Teil des Fußvolkes vor das eine Tor gesetzt und sich mit der Besatzung über die Übergabe besprochen. Da seien alle Knechte zu diesem Tor geeilt und haben zugehört, und indessen sei das andere Tor von den Feinden bestiegen worden. Im Schloß Urach aber seien vierhundert herzogliche Fußknechte gewesen. Die habe die Bürgerschaft nicht in die Stadt lassen wollen, als der Feind anrückte. Es sei zum Gefecht zwischen ihnen gekommen, worin die Knechte auf den Markt gedrungen seien, dort aber sei der Vogt von einer Kugel getroffen und nachher mit Hellebarden niedergestoßen worden. Die Stadt habe sich dem Bund ergeben. "Es ist koi Wunder", schloß die runde Frau ihre Erzählung, "älle Burga und Schlösser nehme se ei. Denn se hent lange Feldschlanga und Bombardierstuck, wo se Kugla draus schießet, graißer als mei Kopf, daß älle Maura zema brecha und älle Tirn einfalla müaßet."
Georg konnte nach diesem Bericht ahnen, daß eine Reise von Hardt nach Lichtenstein nicht minder gefährlich sein werde als jener Ritt über die Alp, denn er mußte gerade die Linie zwischen Urach und Tübingen durchschneiden. Doch war Urach schon seit mehreren Tagen vom Heer verlassen. Die Belagerung von Tübingen mußte notwendig viel Mannschaft erfordern, und so konnte Georg dennoch hoffen, daß keine eigentlichen Posten mehr den Strich Landes, den er zu durchreisen hatte, besetzt halten würden.
Mit Ungeduld erwartete er daher die Ankunft seines Führers. Seine Kopfwunde war geheilt. Sie war nicht tief gewesen, denn die Federn seines Barettes und sein dichtes Haar hatten dem Hieb, der nach ihm geführt worden war, seine Schärfe genommen. Doch war der Schlag noch immer kräftig genug gewesen, um ihn auf so viele Tage des Bewußtseins zu berauben. Auch seine übrigen Wunden an Arm und Beinen waren geheilt, und die einzige körperliche Folge jener unglücklichen Nacht war eine Mattigkeit, die er dem Blutverlust, dem langen Liegen und dem Wundfieber zuschrieb. Doch auch diese schwand von Stunde zu Stunde, denn ein frischer Mut und sehnsüchtige Gedanken in die Ferne verjagten gar bald solche schlimmen Gäste.
Er mußte auch die trauliche gutmütige Geschwätzigkeit des Mädchens bewundern. Die runde Frau mochte schmälen wie sie wollte, mochte sie noch so oft ermahnen, den hohen Stand des Ritters zu bedenken, sie ließ es sich nicht nehmen, ihren Gast zu unterhalten, besonders da sie ihren geheimen Plan, zu erforschen, ob sie in Hinsicht auf die Feldbinde besser geraten habe als die Mutter, noch nicht aufgegeben hatte. Sie hatte hierüber noch ihre ganz besonderen Gedanken. Als nämlich der Junker so gar krank gelegen, war sie in der Nacht noch lange aufgeblieben, um dem Vater Gesellschaft zu leisten, der am Bett des Verwundeten wachte. Doch bald schlief sie über ihrer Arbeit ein. Es mochte ungefähr zehn Uhr in der Nacht sein, da sie von einem Geräusch im Zimmer aufgeweckt wurde. Sie sah einen Mann mit dem Vater angelegentlich sprechen; seine Züge entgingen ihr nicht, obgleich er sich in eine große Kappe gehüllt hatte; sie glaubte einen Diener des Ritters von Lichtenstein, der schon oft auf geheimnisvolle Weise zu dem Pfeifer von Hardt gekommen war und bei dessen Anwesenheit sie immer das Zimmer hatte verlassen müssen, in ihm zu erkennen.
Neugierig, endlich einmal zu hören, was dieser Mann bei dem Vater zu tun habe, schloß sie ihre Augen wieder fest zu; denn es war ihr wahrscheinlich, daß ihr Vater sie nur im Zimmer ließ, weil er sie für fest eingeschlafen hielt. Der Mann erzählte von einem Fräulein, die über eine gewisse Nachricht untröstlich sei. Sie habe den fremden Mann gebeten und gefleht, nach Hardt zu gehen und Nachricht einzuziehen, sie habe geschworen, wenn er nicht gute Nachricht bringe, ihrem Vater alles zu sagen, und zur Pflege des Kranken selbst zu kommen. Solches hatte der Lichtensteiner heimlich gesprochen; der Vater hatte darauf das Fräulein beklagt, hatte dem Boten den ganzen Zustand des Kranken geschildert und versprochen, daß er, sobald sich der Kranke gebessert habe, selbst kommen werde, um dem Fräulein diesen Trost zu bringen. Der fremde Mann hatte sodann dem Kranken ein Löckchen von seinen langen Haaren abgeschnitten, es in ein Tuch geschlagen und unter dem Wams wohl verwahrt; darauf war er, vom Vater geführt, aus der Stube gegangen, und kurz nachher hörte sie ihn bei Nacht und Nebel wieder wegreiten.
Diese Begebenheit hatten die vielerlei Geschäfte der folgenden Tage bald wieder aus dem leichten, jugendlichen Sinn der Tochter des Pfeifers von Hardt verdrängt, sie erwachte aber jetzt aufs neue, aufgeregt durch das, was Bärbele durchs Küchenfenster gesehen hatte. Sie wußte, daß der Ritter von Lichtenstein eine Tochter habe, denn die Schwester des Spielmanns war ja ihre Amme. Und dieses Fräulein mußte es wohl sein, die den Lichtensteiner Knecht gesandt habe, um sich so angelegentlich nach dem Kranken zu erkundigen, die sogar selbst kommen wollte, um ihn zu pflegen.
Tränen traten ihr in die sonst so fröhlichen Augen, als sie bedachte, wie leicht der Junker seinem Liebchen hätte wegsterben können, und wie sie dann so einsam und ohne Liebe gewesen wäre, und doch war sie gewiß recht schön und eines vornehmen reichen Ritters Kind. Doch ist nicht der Junker noch viel schlimmer daran? dachte das gutherzige Schwabenkind weiter; dem Fräulein hat ja der Vater jetzt Nachricht von ihm gebracht, aber er, er wußte ja seit vielen Tagen kein Wörtchen von ihr; denn früher wußte er nichts von sich selbst, und seit er wieder ganz bei Leben war, konnte er auch nichts wissen; darum hatte er wohl die Binde, die er gewiß von ihr hatte, so bewegt angeschaut und ans Herz und den Mund gedrückt? Sie nahm sich vor, ihm zu erzählen, was in jener Nacht vorgegangen sei, vielleicht ist es ihm doch ein Trost, dachte sie.
Georg hatte bemerkt, wie die fröhliche Miene des spinnenden Bärbele nach und nach ernster geworden war, wie sie über etwas nachzusinnen schien, ja er glaubte sogar eine Träne in ihrem Auge bemerkt zu haben. "Was hast Du, Mädchen", sagte er, als die Mutter gerade das Zimmer verlassen hatte, "warum wirst Du auf einmal so still und ernst und netzest ja sogar Deine Fäden mit Tränen?"
"Send denn Ihr so lustig, Junker? fragte Bärbele und sah ihm recht fest ins Auge, "i han gmoint, es sei vorig ebbes aus Eure Auge grollt, was selle Binde dort gnetzt hot. Sell hent Er gewiß vo Eurem Schätzle, und jetzt tuets Uich loid, daß Er et bei er send."
Sie mochte nahe ans Ziel getroffen haben, denn der junge Mann errötete tief über ihre Frage. "Du hast vielleicht recht", sagte er lächelnd, "doch bin ich deswegen nicht gar zu traurig, ich werde sie bald wiedersehen."
"Ach, was des für a Freud sein wird in Lichtastoi!" entgegnete Bärbele mit einem schelmischen Seitenblick.
Georg erstaunte; sollte ihr der Vater von dem Geheimnis seiner Liebe etwas gesagt haben? "In Lichtenstein?" fragte er sie. "Was weißt Du von mir und Lichtenstein?"
"Ach, i mags dem gnädigen Fräule wohl gönna, daß se wieder a mol a Freud hot; mer hot mer gsait, se häb rechtschaffa g'jommert, wie Er so krank gwä send."
"Gejammert, sagst Du?" rief Georg, indem er aufsprang und zu ihr trat. "So wußte sie um meine Krankheit? Oh sprich, was weißt Du von Marie? Kennst Du sie? Was sagte der Vater von ihr?"
"Der Vater hot koi sterbes Wörtle zu mer gsait, und i wißt au net, daß es a Fräule von Lichtastoi geit, wenn et mei Bas ihr Amm wär. Aber Er müeßet mers et übel nemme, Junker, dasse a bissele ghorcht han, gucket, des Ding ist so ganga." Sie erzählte dem Junker, wie sie hinter das Geheimnis gekommen sei und daß der Vater, wahrscheinlich, um guten Trost zu bringen, nach Lichtenstein gegangen sei.
Georg wurde schmerzlich bewegt durch diese Nachricht, er hatte bis jetzt geglaubt, Marie werde die Nachricht seines Unfalls zugleich mit der tröstlichen Kunde seiner Genesung erhalten, und jetzt mußte er erfahren, daß sie mehrere bange Tage in Ungewißheit geschwebt habe: in der schrecklichen Ungewißheit, ob er nicht hier noch entdeckt werde, ob er gerettet werde, ob sie ihn je wiedersehen würde; er kannte ihr treues Herz, und wie lebhaft konnte er sich ihren Kummer denken! Wahrlich, sein eigenes Unglück schien ihm gering und nicht zu beachten, wenn er sich den Jammer des teuren Mädchens vorstellte. Wieviel hatte sie in Ulm gelitten, wie schmerzlich war ihr der Abschied von ihm geworden: und kaum hatte ihr Herz wieder freier geatmet in dem Gedanken, daß er des Bundes Fahnen verlassen werde, kaum hatte sie ein wenig heiterer in die Zukunft gesehen, so kam ihr die Schreckensbotschaft von der tödlichen Wunde. Und dieses vor den Blicken des Vaters verschließen zu müssen, diesen großen Schmerz allein tragen müssen, ohne eine, auch nur eine Seele zu haben, bei welcher sie weinen, bei welcher sie Trost suchen konnte. Jetzt fühlte er erst, wie notwendig es sei, schnell nach Lichtenstein zu eilen, und seine Ungeduld wurde zum Unmut, daß jener sonst so kluge Mann gerade in diesen kostbaren Augenblicken so lange ausbleibe.
Das Mädchen mochte seine Gedanken erraten: "I sieh wohl, Er möchtet gern fort; wenn no der Vater do wär, denn alloi fendet Er da Weg nach Lichtastoi net; Er send koi Witaberger, des merke an der Sproch, und do kennet Er leicht verirra. Wisset Er was? I lauf em Vater entgege und mach, daß er bald kommt."
"Du wolltest ihm entgegengehen?" sagte Georg, gerührt von der Gutmütigkeit des Mädchens. "Weißt Du denn, ob er schon in der Nähe ist? Vielleicht ist er noch Stunden entfernt, und in einer Stunde wird es Nacht!"
"Und wär's so Nacht, daß mer da Weg mit de Händ greifa müeßt, und müeßt i laufa bis Lichtastoi, i wetts gern dauh, Er kommet jo no bälder zu—". Errötend schlug sie die Augen nieder, denn trieb sie auch ihr gutes Herz, sich zum Liebesboten des Ritters anzubieten, so schämte sie sich doch, jenes zarte Verhältnis, das ihr heute so klar wie noch nie zuvor einleuchtete, zu berühren.
"Und willst Du mir zulieb gehen bis Lichtenstein, so wäre es ja töricht von mir, zurückzubleiben und erst Deinen Vater zu erwarten. Ich sattle geschwind mein Roß und reite neben Dir her, und Du zeigst mir den Weg, bis ich ihn nicht mehr verfehlen kann."
Das Mädchen von Hardt schlug die Augen nieder und spielte mit dem langen Zopfband "Aber es wird jo scho en era Stund Nacht", flüsterte sie kaum hörbar.
"Ei, was schadet das? Dann bin ich um den Hahnenschrei in Lichtenstein", antwortete Georg, "Du wolltest Dich ja vorhin selbst bei Nacht und Nebel auf den Weg machen."
"Ja i wohl", entgegnete Bärbele, ohne aufzusehen, "aber Uich ist's gwiß et gsund, wo ner erst krank gwä send, so in der kühla Nacht en Weg von sechs Stund zmacha."
"Das kann ich nicht beachten", rief Georg, "und die Wunde ist ja geheilt, ich bin gesund wie zuvor; nein, rüste Dich immer, gutes Kind, wir brechen sogleich auf, ich gehe, mein Pferd zu satteln." Er nahm den Zaum von einem Nagel an der Wand, wo er aufgehängt war; und schritt zur Tür.
"Herr! Euer Gnaden!" rief ihm das Mädchen ängstlich nach. "Lasset's lieber geh. Gucket, 's tuet se et, daß mer so selbander in der Nacht fortganget. D'Leut in Hardt send so gar wunderlich, und mer tät mer gwiß ebbes ahänga, wenne—wartet lieber bis morga früh, so wille Uich meinetwega führa bis Pfullinga."
Der Junker ehrte die Gründe des guten Mädchens und hing schweigend den Zaum wieder an die Wand. Er beschloß, diesen Abend und die folgende Nacht noch auf den Pfeifer zu warten, käme er nicht, so wollte er mit dem frühesten Morgen zu Pferd sein und unter Leitung seiner schönen Tochter nach Lichtenstein aufbrechen.
Kapitel 17
Aber der Pfeifer von Hardt kehrte auch in dieser Nacht nicht nach Haus zurück, und Georg, der seine Sehnsucht nach der Geliebten nicht mehr länger zügeln konnte, sattelte, als der Morgen graute, sein Pferd. Die runde Frau hatte nach einigen harten Kämpfen ihrem Töchterlein erlaubt, daß sie den Junker geleiten dürfe. Sie wußte zwar, daß ein so unerhörtes Ereignis viele Abende zur Unterhaltung in den Spinnstuben von Hardt dienen werde, und sah es deswegen nicht ganz gerne. Wenn sie aber bedachte, wieviel ihrem Eheherrn an dem jungen Ritter gelegen sein müsse, weil er ihn in sein Haus aufgenommen und wie einen Sohn gepflegt hatte, so glaubte sie doch, diesen letzten Dienst ihrem Gast nicht abschlagen zu dürfen; doch machte sie die Bedingung, daß Bärbele vorausgehen und ihn eine Viertelstunde hinwärts an einem Markstein erwarten müsse.
Georg nahm gerührt Abschied von der stattlichen, runden Frau, die ihm zu Ehren heute noch einmal in ihrem Sonntagsstaat prangte; er hatte in den geschnitzten Schrank einen Goldgulden gelegt, ein wichtiges Geschenk für die damalige Zeit, und eine bedeutende Summe für die Reisekasse Georgs von Sturmfeder. Der Pfeifer von Hardt soll übrigens nie etwas von diesem Depositum erfahren haben; sei es nun, daß die gute runde Frau den Goldgulden nicht gefunden hat oder daß sie ihrem Eheherrn nichts davon berichtete, aus Angst, er möchte den Junker durch die Rückgabe des Geschenkes beleidigen. Nur so viel ist gewiß, daß die Frau des Spielmanns kurze Zeit nach diesem Vorfall mit einem nagelneuen Rock in der Kirche erschien, zur Verwunderung aller Weiber in der Gegend, und daß ihre Tochter Bärbele eine schönes Mieder von feinem Tuch mit Goldborden auf der nächsten Kirchweih trug, das man früher nie an ihr gesehen. Auch soll sie jedes Mal errötet sein, wenn die Mädchen das neue Mieder befühlten und lobten.
Georg fand seine Führerin auf dem bezeichneten Markstein sitzend. Sie sprang auf, als er herankam, und ging mit raschen Schritten neben ihm her. Das Mädchen kam ihm heute noch viel hübscher vor als gestern. Ihre Wangen hatte der frische Aprilmorgen mit hohem Rot bedeckt, und ihre Augen glänzten freundlich. Ihre Tracht eignete sich ganz gut zu einem weiten Marsch, denn das kurze Röckchen hinderte den Fuß nicht, flink auszuschreiten. Sie hatte ein Körbchen an den Arm gehängt, als wolle sie zum Markt in die Stadt gehen. Sie trug aber weder Gemüse noch Früchte darin, was sie wohl sonst in die Stadt zu bringen pflegte, sondern ein Regentuch, mit dem sie sich gegen die wechselnden Launen eines Apriltages versehen hatte.
Sie wählte meistens Nebenwege und führte den Reiter höchstens zwei- bis dreimal durch Dörfer, von zwei zu zwei Stunden aber machten sie halt. Endlich nach vier solchen Stationen sah man in der Entfernung von einer kleinen halben Stunde ein Städtchen liegen; der Weg schied sich hier, und ein Fußpfad führte links ab in ein Dorf. An diesem Scheidepunkt blieb das Mädchen stehen und sagte: "Was Er dort sehet, ist Pfulliga, von dort kann Uich jedes Kind da Weg nach Lichtastoi zeiga."
"Wie? Du willst mich schon verlassen?" fragte Georg, der sich an die munteren, sinnigen Reden seiner Begleiterin so gewöhnt hatte, daß ihn der Abschied überraschte. "Warum gehst Du nicht wenigstens mit mir bis Pfullingen? Dort kannst Du in der Herberge etwas essen und trinken; Du willst doch nicht geradezu nach Haus laufen?"
Das Mädchen suchte freundlich auszusehen und zu scherzen, doch konnte sie einen schmerzlichen Zug um den Mund und trübe Augen nicht verbergen; denn wohl mochte auch ihr die Nähe ihres schönen Gastes teurer geworden sein, als sie vielleicht selbst wußte. "Do mueß i von Uich geh, gnädiger Herr", sagte sie, "so gerne au no weiters mitging, aber d'Mueter will's so; dort in dem Dörfle am Berg hanne a Bas, und bei der bleibe heut, und morga gange wieder nach Hardt. Jetzt b'hüet Uich Gott der Herr und d'heilig Jungfrau, und älle seine Heilige nemmet Uich in Schutz. Grüßet mer de Vater und au", setzte sie lächelnd hinzu, indem sie schnell eine Träne abschüttelte, "grüßet mer sell Frähla, die Er so gern hent."
"Dank Dir, Bärbele", entgegnete Georg und reichte ihr die Hand zum Abschied vom Pferd hinab. "Ich kann Dir Deine treue Pflege nicht vergelten. Aber wenn Du nach Haus kommst, so schau in den geschnitzten Schrank, dort wirst Du etwas finden, das vielleicht zu einem neuen Mieder oder zu einem Röckchen für den Sonntag reicht. Nun, und wenn Du es dann zum ersten Mal anhast und Dein Schatz Dich darin küßt, so denke an Georg von Sturmfeder!"
Der junge Mann gab seinem Pferd die Sporen und trabte über die grüne Ebene hin dem Städtchen zu. Bald war er am Tor der kleinen Stadt angelangt. Er fühlte sich ermüdet und durstig und fragte daher auf der Straße nach einer guten Herberge. Man wies ihn nach einem kleinen düsteren Haus, wo ein Spieß über der Tür und ein Schild, mit einem springenden Hirsch geziert, zur Einkehr luden. Ein kleiner barfüßiger Junge führte sein Pferd in den Stall, ihn selbst aber empfing in der Tür eine junge, freundliche Frau und führte ihn zur Trinkstube.
Es war dies ein weites finsteres Zimmer, an dessen Wänden sich schwere eichene Tische und Bänke hinzogen. Die ungeheure Menge von Kannen und Bechern, die blank gescheuert von den Gestellen am Getäfel herabblinkte, bewies, daß die Herberge zum Hirsch sehr besucht sein müsse. In der Tat saßen auch, obgleich es erst Mittag war, schon viele Gäste beim Wein. Sie schauten den stattlichen jungen Ritter prüfend an, als er an ihren Tischen vorüber zum Ehrenplatz, in ein sechseckiges, wie eine Laterne aus lauter Fenstern erbautes Erkerlein geführt wurde; doch ließen sie sich in ihrem Gespräch durch den vornehmen Gast nicht lange stören, sondern schwatzten weiter über Krieg und Frieden, über Schlachten und Belagerungen, wie ehrsame Spießbürger in so unruhigen Zeiten, wie Anno 1519, zu tun pflegten.
Die Wirtin schien an ihrem Gast Gefallen zu finden. Sie schaute mit lächelnder Miene nach ihm herüber, wenn sie am Erkerlein vorbeiging, und als sie ihm eine Kanne alten Heppacher und einen silbernen Becher vorsetzte, zog sich ihr etwas großer Mund zu holdseliger Freundlichkeit. Sie versprach ihm auch, ein junges Huhn zu braten und einen Tisch zu decken, wenn er sich nur ein wenig gedulden wolle; einstweilen solle er sich den Wein gut bekommen lassen. Das laternenförmige Erkerlein lag um zwei Stufen höher als die übrige Trinkstube; Georg konnte daher mit Muße die Tische übersehen und trinkend die Gäste mustern. Ob-gleich er nicht viel in Herbergen und Weinstuben sich herumzutreiben pflegte, so hatte er doch, vielleicht dadurch, daß er weniger sprach als beobachtete, einen eigenen Takt in Beurteilung solcher Umgebungen gewonnen, der ihn auch bei seinen jetzigen Beobachtungen unterstützte.
Die Gesellschaft, die um einen der großen eichenen Tische saß, bestand aus etwa zehn bis zwölf Männern. Sie unterschieden sich auf den ersten Anblick nicht sehr voneinander, große Bärte, kurze Haare, runde Mützen, dunkle Wämser gehörten dem einen so gut wie dem andern an. Doch sonderte ein schärferer Blick bald vorzüglich drei von den übrigen. Der eine—er saß Georg am nächsten, war ein kleiner, fetter, freundlicher Mann. Sein Haar war im Nacken etwas länger als das der anderen, er hatte es sorgfältiger gekämmt; auch schien sein dunkler Bart besser gepflegt zu sein. Ein Mantel von feinem schwarzem Tuch und ein Filzhut mit spitzigem Kopf und breiter Krempe, die hinter ihm an einem Nagel hingen, bezeichneten einen Mann von einigem Gewicht, vielleicht gar einen Ratsherrn. Er mochte auch eine bessere Sorte trinken als die übrigen, denn er schlürfte bedächtig, und wenn er mit dem Deckel an seinem Krug das Zeichen gab, daß er leer sei, tat er dies mit einem gewissen Anstand und vernehmlicher als die übrigen. Er sah bei allem, was gesprochen wurde, überaus fein und listig aus, als wisse er noch manches, ohne es gerade hier preisgeben zu wollen. Auch hatte er das Vorrecht, das Kellnermädchen in die Wangen zu kneifen oder ihren runden Arm zu "tätscheln", wenn sie ihm die gefüllte Kanne brachte.
Ein anderer Mann, der am entgegengesetzten Ende des Tisches saß, stach nicht minder gegen seine Umgebung ab als der Fette; alles war an ihm länglich und hager. Sein Gesicht, von der Stirn bis zu dem langen, zugespitzten Kinn, maß wohl eine gute Mannesspanne; seine Finger, mit welchen er auf dem Tisch den Takt eines Liedes spielte, das er leise vor sich hin pfiff, hatten etwas Spinnenartiges, und als sich Georg einmal zufällig bückte, gewahrte er zu seinem großen Erstaunen, daß der hagere Mann lange, dünne Beine beinahe unter dem ganzen Tisch hin ausgestreckt hatte. Er hatte um seine Nase etwas Hochfahrendes, das sich auch in der Art, wie er allem, was die Bürger vorbrachten, widersprach, ausdrückte; er sah aus wie einer, der viel mit vornehmen Herren umgegangen ist, ihre Art und Weise angenommen hat, aber doch nicht recht bequem damit zurechtkommt. Er konnte nicht aus dem Städtchen sein, denn er hatte die Wirtin nach seinem Pferd gefragt. Nach Georgs Mutmaßungen war er ein reisender Arzt, wie sie zu jener Zeit im Land umherzogen, um die Menschen künstlich umzubringen.
Der dritte Mann, der dem Gast im Erker auffiel, sah etwas zerrissen und zerlumpt aus; er hatte übrigens etwas Bewegliches, Listiges in seinem Wesen, das ihn von der gutmütigen, behaglichen Ruhe der Spießbürger merklich unterschied. Er hatte über dem einen Auge ein großes Pflaster, das andere aber blickte kühn und offen um sich. Ein großer Reisestock mit eiserner Spitze, der neben ihm lag, und sein lederbesetzer Rücken, worauf er gewöhnlich einen Korb oder eine Kiste tragen mochte, ließen schließen, daß er entweder ein Bote sei oder, wahrscheinlicher noch, einer jener herumziehenden Krämer, die auf Märkten und Kirchweihen, nebst wundersamen Nachrichten aus fernen Landen, für die Weiber wirksame Mittel gegen behextes Vieh und für die Mädchen schöne bunte Bänder und Tücher bringen.
Diese drei waren es auch, die das Gespräch führten, das nur hin und wieder durch einen Ausruf der Verwunderung oder durch ein Klopfen mit den Krugdeckeln von den übrigen ehrsamen Bürgern unterbrochen wurde.
Diese Männer handelten übrigens eine Materie ab, die Georgs Interesse sehr in Anspruch nahm. Sie sprachen über die Unternehmungen des Bundes im württembergischen Unterland. Der Krämer mit dem ledernen Rücken hatte erzählt, daß Möckmühl, worin sich Götz von Berlichingen eingeschlossen, von den Bündischen erstürmt und jener tapfere Mann gefangen worden sei.
Der Ratsherr hatte zu dieser Nachricht listig gelächelt und einen guten Zug von seiner besseren Sorte getrunken; der Hagere ließ aber den Lederrücken nicht aussprechen; er schlug den Takt mit den langen Fingern etwas vernehmlicher und sagte mit hohler Stimme: "Das ist erstunken und erlogen, Freund! Seht, das ist gar nicht möglich, denn der Berlichingen versteht die schwarze Kunst und ist fest, das muß ich wissen, und überdies hat er allein mit seiner eisernen Hand in mancher Schlacht zweihundert Mann maustot geschlagen, was wird er sich denn fangen lassen."