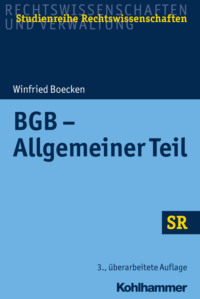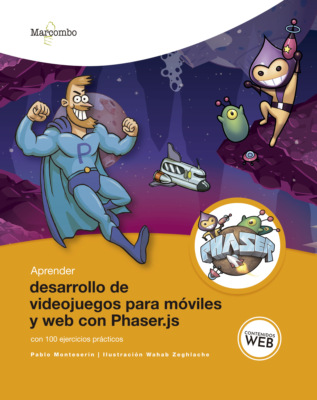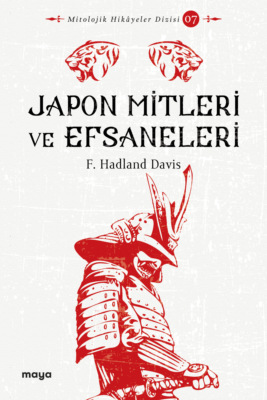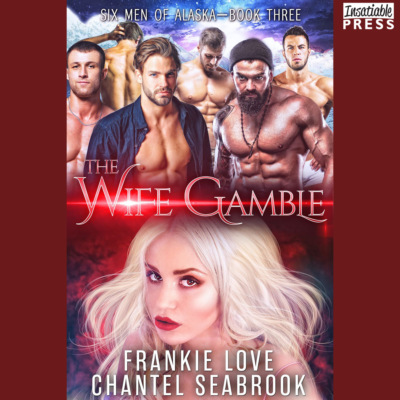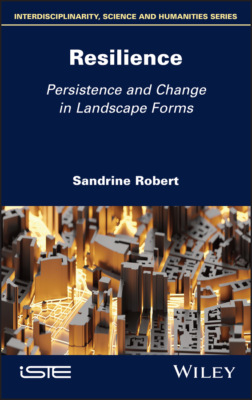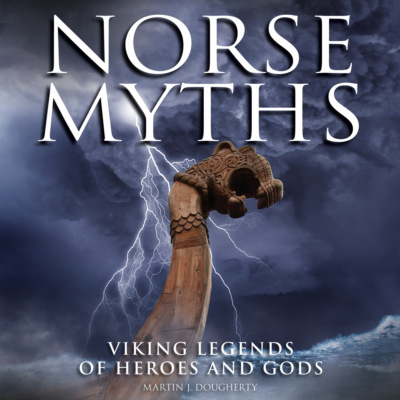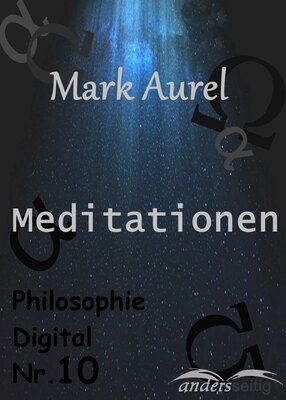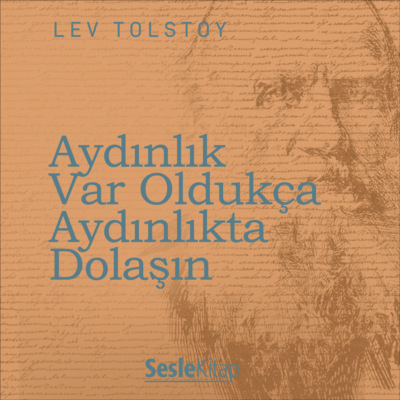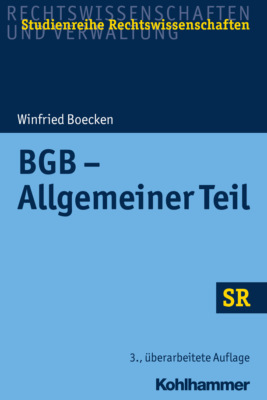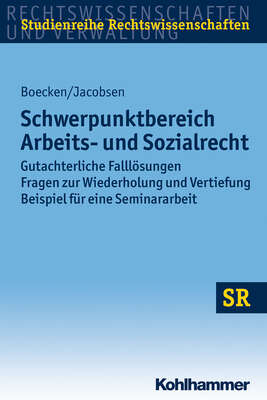Kitabı oku: «BGB – Allgemeiner Teil», sayfa 2
1. Teil: Einführung in das Bürgerliche Recht
§ 1 Recht und Privatrecht (Bürgerliches Recht und Sonderprivatrecht)
Literatur:
Canaris, Grundrechte und Privatrecht, AcP 184 (1984), 201; ders., Zur Problematik von Privatrecht und verfassungsrechtlichem Übermaßverbot, JZ 1988, 494; Diederichsen, Die Selbstbehauptung des Privatrechts gegenüber dem Grundgesetz, JURA 1997, 57; Hager, Grundrechte im Privatrecht, JZ 1994, 373; Merten, das System der Rechtsquellen, JURA 1981, 169; Medicus, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Privatrecht, AcP 192 (1992), 35; Singer, Vertragsfreiheit, Grundrechte und der Schutz des Menschen vor sich selbst, JZ 1995, 1133.
Rechtsprechung:
EuGH NJW 1996, 1267 – Brasserie du Pêcheur (Schadensersatz aufgrund eines gemeinschaftsrechtlichen Staatshaftungsanspruchs bei Verstoß des Mitgliedstaates gegen Gemeinschaftsrecht; Art. 5, 189, 215 EGV a. F. = Art. 10, 249, 288 EGV n. F.); BVerfGE 58, 300 – Naßauskiesungs-Beschluss (Inhalt und Schranken des Eigentums, Enteignung; Art. 3 Abs. 1, 14 GG, §§ 903, 905 BGB); BVerfGE 7, 198 – Lüth-Urteil (Einwirkung der Grundrechte über die Generalklauseln des bürgerlichen Rechts, Schranke der allgemeinen Gesetze, Wechselwirkungstheorie; Art. 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 5 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 GG, § 826 BGB); BAGE 103, 111 – Islamisches Kopftuch (Sozialwidrigkeit einer Arbeitgeber-Kündigung, Abwägung von Grundrechtspositionen; Art. 4 Abs. 1, Abs. 2 GG und Art. 12 Abs. 1, 19 Abs. 3 GG, §§ 315 Abs. 1, 242, § 102 Abs. 1 BetrVG, § 1 Abs. 2 KSchG).
I.Recht
1.Begriff und Bedeutung
1 Angesichts der Vielgestaltigkeit und Komplexität zwischenmenschlicher Beziehungen ist es in weiten gesellschaftlichen und sozialen (etwa Familie, Schule, Kirche, Gemeinde, Verein) aber auch wirtschaftlichen Bereichen (Unternehmen, Verbände) notwendig, dass bestimmte Verhaltensweisen einem Gebot oder Verbot unterliegen oder sonstige Folgen an sie geknüpft sind. Regelmäßig nur so kann der Einzelne sein Handeln nach diesen „sozialen Spielregeln“1 ausrichten. Das Recht soll dabei das Zusammenleben der Menschen regeln und ordnen2. Neben den rechtlichen Regelungen können Normen der Sitte und der Moral (Sittlichkeit) das zwischenmenschliche Zusammenleben beeinflussen und lenken3. Das Recht stellt dabei, anders als Sitte und Moral (Sittlichkeit), verbindliche Regeln auf, die Rechtsnormen. Nur diese können mit Hilfe staatlicher Institutionen, insb. der Gerichte, zwangsweise durchgesetzt werden. Rechtsnormen sind im Hinblick auf das Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG)4 und das Erfordernis der Rechtssicherheit nur dann für den Einzelnen verbindlich, wenn sie ein hinreichendes Maß an Bestimmtheit aufweisen5. Die inhaltlich maßgebliche Leitvorstellung allen Rechts muss die Idee der Gerechtigkeit sein6. Erst daraus kann in überzeugender Weise die Verbindlichkeit des Rechts für jeden Rechtsunterworfenen abgeleitet werden. Die Vorstellungen des Einzelnen davon, was „Gerechtigkeit“ bedeutet, können z. T. deutlich divergieren. Doch gibt es allgemein anerkannte Werte, etwa die gemäß Art. 1 Abs. 1 Satz 1 GG „unantastbare“ Menschenwürde7, aufgrund derer sich nach Art. 1 Abs. 2 GG das Deutsche Volk „zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt“ bekennt. So ist nach Art. 102 GG die Todesstrafe abgeschafft. Gerechtigkeit kann maßgeblich auch über den Aspekt der Gleichheit angestrebt werden.
2 Über das Ziel der Verwirklichung von Gerechtigkeit hinaus ist die Befriedungsfunktion des Rechts zu betonen. Soweit infolge des zwischenmenschlichen Zusammenlebens Konflikte auftreten, soll sich nicht (mehr) das Recht des Stärkeren („Faustrecht“) durchsetzen8. Vielmehr wird ein staatlich geregeltes Verfahren zur Verfügung gestellt, dessen sich der Einzelne zur Durchsetzung seiner Rechtspositionen bedienen kann, aber auch muss. Ein Zustand des Rechtsfriedens herrscht dann, wenn für den Einzelnen und die Rechtsgemeinschaft kein Grund oder keine Möglichkeit mehr besteht, eine einmal eingetretene Rechtslage zu ändern. Die (Verfolgungs-)Verjährung im Strafrecht schließt die Ahndung der Tat endgültig aus, wobei Mord (§ 211 StGB) nie verjährt (§ 78 Abs. 2 StGB). Nach Eintritt der Rechtskraft eines zivilgerichtlichen Urteils (§§ 322 ff. ZPO) ist eine Änderung nur noch in ganz besonderen Ausnahmekonstellationen möglich9. Rechtsfrieden und Rechtssicherheit sind von so zentraler Bedeutung für die Rechtsstaatlichkeit (Art. 20 Abs. 3 GG), dass um ihretwillen die Möglichkeit einer im Einzelfall vielleicht unrichtigen Entscheidung in Kauf genommen werden muss10.
Bsp.: Nach Eintritt der Verjährung11 ist der Schuldner im Interesse des Rechtsfriedens und der Rechtssicherheit berechtigt, die Leistung zu verweigern (§ 214 Abs. 1)12.
2.Abgrenzungen
3 Nicht nur Normen des Rechts – Rechtsnormen – ordnen und regeln das Zusammenleben der Menschen. Das Recht ist abzugrenzen von Sitte und Moral (Sittlichkeit)13. Der Begriff „Sitte“ umschreibt dabei diejenigen Bräuche und Gewohnheiten, deren Einhaltung von der Mehrheit des maßgeblichen Ausschnitts der Gesellschaft als für ein geregeltes Zusammenleben erforderlich angesehen wird. Insoweit können große regionale Unterschiede bestehen.
Bsp.: Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB)14 geht in § 157 davon aus, dass eine „Verkehrssitte“15 bestehen kann. Im Handelsverkehr unter Kaufleuten ist nach § 346 HGB auf „Handelsbräuche“ Rücksicht zu nehmen.
4 Der maßgebliche Unterschied zwischen Recht und Sitte liegt in der Sanktionierung von Verstößen. Das Recht ist durch die Möglichkeit seiner zwangsweisen Durchsetzung mit Hilfe staatlicher Institutionen, insb. der staatlichen Gerichte, gekennzeichnet. Der Missachtung sittlicher Normen kann allenfalls gesellschaftlich-soziale Missachtung folgen, staatlicher Zwang findet keine Grundlage. Zu beachten ist, dass aus einer Sitte, einem Brauch, einer Gewohnheit unter bestimmten Voraussetzungen Gewohnheitsrecht entstehen kann16.
5 Auch die Moral (Sittlichkeit) kann dem Einzelnen eine bestimmte Verhaltensweise ge- oder verbieten, etwa aufgrund eines Gewissensentschlusses oder religiös-weltanschaulicher Vorgaben. Gleiches gilt für allgemeine Grundnormen der Sozialmoral, etwa das Gebot der Anständigkeit17.
Bsp.: Das von einer Person als für sich verbindlich erachtete Gebot „Du sollst nicht lügen“ kann einen religiös-weltanschaulichen (bspw. christlichen) Hintergrund haben, auf einer individuellen Gewissensbetätigung beruhen oder als allgemeine moralische Grundregel anerkannt worden sein.
6 Auch Normen der Moral (Sittlichkeit) fehlt – wie Normen der Sitte – der im Hinblick auf ihre Durchsetzbarkeit zwingende Charakter. Ein bloßer Verstoß gegen eine sittlich-moralische Vorgabe kann zwar zu einem „schlechten Gewissen“, zu „Gewissensbissen“, nicht aber zur zwangsweisen Durchsetzung der Moralvorstellung führen. Moral (Sittlichkeit) und Recht verfolgen darüber hinaus unterschiedliche Ziele. Die Normen der Moral (Sittlichkeit) verurteilen bereits den verwerflichen „unsittlichen“ Gedanken, während Rechtsnormen regelmäßig erst die nach außen in irgendeiner Form kundgemachte Betätigung einer verwerflichen Gesinnung sanktionieren.
Bsp.: Der bloße Gedanke, „diesen Idioten am liebsten umbringen“ zu wollen, mag unsittlich sein; durch Rechtsnormen sanktioniert ist erst eine dahingehende, nach außen gerichtete Willensbetätigung, etwa die Beleidigung, die vollendete oder versuchte Tötung, Körperverletzung sowie Beihilfe oder Anstiftung eines anderen hierzu18.
7 Recht ist damit gleichsam als „ethisches Minimum“ anzusehen19. Verbindungen zwischen Recht und Moral (Sittlichkeit) bestehen dabei in beiden Richtungen, etwa dergestalt, dass in bestimmten Rechtsnormen auf sittliche Vorstellungen im Sinne einer „Sozialmoral“ verwiesen wird.
Bsp. (1): Der Begriff der „guten Sitten“ i. S. v. § 826 und § 138 wird nach allg. M. ausgelegt20 als das „Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden“21.
Bsp. (2): Bereits das bloße Bestehen einer Strafandrohung, etwa § 218 StGB (Schwangerschaftsabbruch), hat „Einfluss auf die Wertvorstellungen und die Verhaltensweisen“ der rechtsunterworfenen Bevölkerung22. Rechtsnormen können aufgrund einer im Laufe der Zeit geänderten Sozialmoral ihrerseits Änderungen erfahren.
3.Recht im formellen und im materiellen Sinne
8 Rechtsnormen im formellen Sinne sind solche, die in einem gesetzlich geregelten förmlichen Gesetzgebungsverfahren von einem dazu legitimierten Gesetzgeber erlassen werden23. Hierzu gehören die im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren des Bundestages verabschiedeten Bundesgesetze ebenso wie die von den Landesparlamenten durch die Landesgesetzgeber geschaffenen Gesetze (formelle Gesetze).
9 Mit dem Begriff der Rechtsnormen im materiellen Sinne wird darauf abgestellt, dass Normen einen bestimmten Regelungsgehalt haben, der für eine unbestimmte Vielzahl von Lebenssachverhalten, insoweit abstrakt, und für eine unbestimmte Vielzahl von Personen, insoweit generell, gilt24. Zu den Rechtsnormen im materiellen Sinne gehören neben den meisten25 formellen Gesetzen Rechtsverordnungen26 und Satzungen von Körperschaften des öffentlichen Rechts27.
4.Zwingendes und nachgiebiges Recht
10 Insb. im Bereich des bürgerlichen Rechts28 von großer Wichtigkeit ist die Unterscheidung zwischen zwingendem (unnachgiebigem)29 und abdingbarem (dispositivem, nachgiebigem)30 Recht31. Zwingendes Recht ist unabdingbar, d. h. hiervon kann nicht abgewichen werden.
Bsp.: Die dem Dienstberechtigten nach den §§ 617, 618 obliegenden Verpflichtungen können nicht im Voraus durch Vertrag aufgehoben oder beschränkt werden (§ 619).
Demgegenüber sind mit nachgiebigem Recht solche gesetzlichen Regelungen gemeint, von denen z. B. in vertraglichen Vereinbarungen abgewichen werden kann. Eine Vielzahl von Vorschriften des bürgerlichen Rechts ist abdingbar.
Bsp.: Nach der gesetzlichen Grundvorstellung trifft den Vermieter die Verpflichtung zur Ausführung von Schönheitsreparaturen. Denn er hat gemäß § 535 Abs. 1 Satz 2 die Mietsache während der Mietzeit „… zu erhalten“. Nach ganz h. M. ist die in der Praxis vielfach übliche vertragliche Abwälzung dieser Pflicht auf den Mieter auch im Rahmen eines Formularvertrags im Grundsatz zulässig32.
Bestimmte gesetzliche Vorschriften sehen vor, dass hiervon nicht zum Nachteil einer hierdurch geschützten Person abgewichen werden darf. Insoweit handelt es sich um sog. halbseitig zwingende Vorschriften.
Bsp.: So kann im Reisevertragsrecht von den Regelungen der §§ 651a ff. gemäß § 651y grds. nicht zum Nachteil des Reisenden abgewichen werden.
5.Rechtsquellen
11 Bei der Frage nach den Rechtsquellen geht es um die Entstehung von Recht bzw. Rechtsnormen, d. h., auf welchem Wege und von wem Rechtsnormen geschaffen werden können33. Insoweit ist zwischen dem geschriebenen (positiven, gesetzten)34 und dem ungeschriebenen Recht zu unterscheiden.
a) Geschriebenes (positives, gesetztes) Recht
12 Hierzu zählen zunächst die vom (Bundes- oder Landes-)Gesetzgeber (Legislative) in einem Gesetzgebungsverfahren „förmlich“35 erlassenen (Bundes- oder Landes-)Gesetze36.
Bsp.: Das GG und das BGB sind ebenso geschriebenes Recht wie etwa das Gesetz über das Nachbarrecht (NRG) des Landes Baden-Württemberg.
13 Rechtsverordnungen sind Rechtsnormen im materiellen Sinne37, die von der Exekutive erlassen werden und einer besonderen – hinsichtlich Inhalt, Zweck und Ausmaß bestimmten – gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage (Rechtsgrundlage) bedürfen (Art. 80 GG)38. Ermächtigungen für den Bereich des bürgerlichen Rechts enthalten z. B. Art. 243 EGBGB betreffend die Festlegung von Versorgungs- und Entsorgungsbedingungen und Art. 244 EGBGB zur Regelung von Abschlagszahlungen beim Hausbau durch Rechtsverordnung.
14 Geschriebenes Recht stellen auch die (autonomen) Satzungen dar. Diese Rechtsnormen im materiellen Sinne sind dadurch gekennzeichnet, dass sie von einer (Selbstverwaltungs-)Körperschaft des öffentlichen Rechts, z. B. einer Universität oder einer Gemeinde39, für deren Mitglieder auf der Grundlage und im Rahmen der ihr vom Staat verliehenen40 Satzungsautonomie erlassen werden. Das Bestimmtheitserfordernis des Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG gilt nach h. M. für den Erlass von Satzungen analog41.
b) Ungeschriebenes Recht (Gewohnheitsrecht)
15 Gewohnheitsrecht entsteht durch jahrelang andauernde tatsächliche Übung42, die auf einer allgemeinen Rechtsüberzeugung43 der beteiligten Verkehrs- bzw. Personenkreise beruht44. Da immer mehr Bereiche durch geschriebenes Recht normiert sind, bleibt zunehmend weniger Raum für Gewohnheitsrecht. Zur Außerkraftsetzung einer Norm des Gewohnheitsrechts bedarf es nach h. M. eines Eingreifens des Gesetzgebers oder der Bildung von entgegenwirkendem Gewohnheitsrecht45.
16 Kein Gewohnheitsrecht und auch im Übrigen nicht als Rechtsquelle anzuerkennen ist die st. Rspr. oberster Gerichte zu einer bestimmten Frage, der sog. Gerichtsgebrauch. Doch kann sich aus einer st. Rspr. Gewohnheitsrecht entwickeln, wenn sie in das allgemeine Rechtsbewusstsein übergeht und von den Rechtsgenossen überwiegend als geltende Norm anerkannt wird.
Bsp. (1): Die jahrelange st. Rspr. des BAG zu den Zulässigkeitsvoraussetzungen für Arbeitskampfmaßnahmen (Streik, Aussperrung)46 hatte jedenfalls bis Ende der 1980er Jahre kein Gewohnheitsrecht erzeugt, da sie von Anfang an und auch noch zu diesem Zeitpunkt umstritten war47.
Bsp. (2): Aus der jahrelangen st. Rspr. des BAG zur Beschränkung der Haftung des Arbeitnehmers für Schäden aufgrund betrieblich veranlasster Tätigkeiten (früher: sog. gefahrgeneigte Arbeit) ist möglicherweise Gewohnheitsrecht entstanden48.
c) Konkurrenz von Rechtsnormen
17 Das Verhältnis von Rechtsvorschriften, die auf ein und denselben Sachverhalt Anwendung finden und aus verschiedenen Rechtsquellen stammen, ist ausgehend von der Rangordnung der Rechtsnormen nach den Prinzipien des sog. Geltungsvorrangs und des sog. Anwendungsvorrangs zu bestimmen49.
II.Privatrecht
1.Begriff
18 Die gesamte Rechtsordnung lässt sich in zwei große Bereiche einteilen, einerseits das Privatrecht, andererseits das Öffentliche Recht („Zweiteilung der Rechtsordnung“). Das Privatrecht ist derjenige Teil der Rechtsordnung, der die Rechtsbeziehungen zwischen den Privatpersonen untereinander betrifft und auf gleichgeordneter Ebene im Sinne einer privatautonomen50 Selbstbestimmung regelt. Das Öffentliche Recht betrifft die Rechtsbeziehungen innerhalb des Staats als Träger hoheitlicher Gewalt, die Organisation seiner Institutionen sowie die Rechtsbeziehungen zwischen Staat und Bürger51.
Aus Gründen der systematischen Klarheit wird zwischen dem allgemeinen und dem besonderen Privatrecht unterschieden. Das Privatrecht ist im Wesentlichen durch Gesetze, ferner durch eine Reihe von Rechtsverordnungen geregelt52.
2.Allgemeines Privatrecht – Bürgerliches Recht
19 Das allgemeine Privatrecht umfasst die Regelungen des Privatrechts, die für jeden Bürger gelten. Es wird auch als Bürgerliches Recht oder Zivilrecht bezeichnet, dessen Kernbereich vor allem im BGB53 mit seinen fünf Büchern (Allgemeiner Teil, Schuldrecht, Sachenrecht, Familienrecht, Erbrecht) geregelt ist54. Weiter gehören zum allgemeinen Privatrecht bzw. Bürgerlichen Recht außerhalb des BGB kodifizierte bürgerlich-rechtliche (Neben-)Gesetze und Verordnungen. Es handelt sich um gesondert geregelte Bereiche, die der Gesetzgeber aus verschiedenen Gründen nicht in das BGB aufgenommen hat. Beispielhaft hervorgehoben seien etwa das Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht (WEG), das Gesetz über die Haftung für fehlerhafte Produkte (ProdHaftG) und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG).
3.Besonderes Privatrecht
20 Das Besondere Privatrecht (Sonderprivatrecht) gilt nur für bestimmte Sachgebiete bzw. Sonderbereiche und richtet sich nur an bestimmte Personen- oder Berufsgruppen55. Hierzu gehören z. B. das Handelsrecht, das Immaterialgüterrecht wie auch das Arbeitsrecht.
Das Handelsrecht ist das Sonderprivatrecht der Kaufleute und Unternehmen, das vor allem im HGB geregelt ist. Dieses Gesetz enthält auf die Bedürfnisse des Handelsverkehrs zugeschnittenes Sonderrecht für die wirtschaftliche Betätigung von Kaufleuten und Handelsgesellschaften. Für verschiedene Unternehmensformen finden sich darüber hinaus besondere gesetzliche Regelungen wie z. B. im AktG oder im GmbHG.
21 Unter dem Begriff des Immaterialgüterrechts werden rechtliche Regelungen zum Schutz des sog. „geistigen Eigentums“ verstanden. Hierzu gehört z. B. das Urheberrechtsgesetz (UrhG). Gemäß § 1 UrhG genießen die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst für ihre Werke Schutz nach Maßgabe dieses Gesetzes. Auf der Grundlage des Markengesetzes (MarkenG) werden nach § 1 MarkenG Marken, geschäftliche Bezeichnungen und geographische Herkunftsangaben geschützt56. Nach dem Patentgesetz (PatG) genießen Erfinder den Schutz von Patenten, die gemäß § 1 Abs. 1 PatG für neue Erfindungen erteilt werden, wenn diese auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.
22 Das Arbeitsrecht ist das Sonderprivatrecht der Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Arbeitnehmer ist derjenige, der aufgrund eines privatrechtlichen Vertrags im Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet ist57. Die Vorschriften der §§ 611a ff. BGB, §§ 105 ff. GewO enthalten grundlegende Regelungen für den Bereich des Arbeitsvertragsrechts. Darüber hinaus sind eine Vielzahl von Gesetzen zum Schutz der Arbeitnehmer von Bedeutung. Hervorgehoben seien etwa das Kündigungsschutzgesetz (KSchG), das Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer (BUrlG) oder auch das Gesetz über die Zahlung des Arbeitsentgelts an Feiertagen und im Krankheitsfall (EFZG). Bedeutsame Gesetze für das Kollektivarbeitsrecht, wozu unter anderem und vor allem das Recht der Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und Betriebsräte gehört, sind etwa das Tarifvertragsgesetz (TVG) und das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG).
§ 2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Literatur:
Hönn, Zur Problematik der Privatautonomie, JURA 1984, 57; Musielak, Vertragsfreiheit und ihre Grenzen, JuS 2017, 949; Paulus/Zenker, Grenzen der Privatautonomie, JuS 2001, 1; Petersen, Die Privatautonomie und ihre Grenzen, JURA 2011, 184; Schulte-Noelke, Die schwere Geburt des Bürgerlichen Gesetzbuchs, NJW 1996, 1705.
Rechtsprechung:
BVerfGE 89, 214 – Bürgschaft Familienangehöriger (Sittenwidrigkeit von Mit-Verpflichtungen naher Angehöriger bei krasser finanzieller Überforderung, Einwirkung von Grundrechten bei der Auslegung zivilrechtlicher Generalklauseln; Art. 2 Abs. 1, 20 Abs. 1, 28 Abs. 1 GG, §§ 138, 242 BGB); BVerfGE 72, 155 – Elterliche Vertretungsmacht (Schutz Minderjähriger vor unbegrenzter finanzieller Verpflichtung durch die Eltern als gesetzliche Vertreter; Art. 2 Abs. 1 i. V. m. 1 Abs. 1 GG, §§ 1629 Abs. 1, 1643 Abs. 1, 1822 Nr. 3 BGB); BGHZ 123, 368 (Erbrechtsgarantie, Testierfreiheit, Sittenwidrigkeit eines Behindertentestaments, Pflichtteil,; Art. 14 Abs. 1 GG, §§ 138 Abs. 1, 2306 Abs. 1 Satz 2 BGB).
I.Entstehung des BGB
23 Die Entstehung des BGB ist vor dem Hintergrund der Kontroverse zwischen Anton Friedrich Justus Thibaut, der sich bereits 1814 nach dem Ende der napoleonischen Besatzung für ein einheitliches BGB aussprach58, und Friedrich Carl von Savigny, der zuvor rechtstheoretische Klarheit über den Inhalt des zu kodifizierenden Rechts gewinnen wollte59, zu sehen (sog. Kodifikationsstreit). Die seitens von Savigny in den folgenden Jahrzehnten verfasste siebenbändige Schrift „System des römischen Rechts“ wird als systembildend für das BGB angesehen. Im Hinblick auf das Gesetzgebungsverfahren musste zunächst die am 16.4.1871 in Kraft getretene Reichsverfassung im Jahr 1873 dahingehend geändert werden, dass dem am 18.1.1871 gegründeten Deutschen Reich die Gesetzgebungskompetenz für das bürgerliche Recht zugewiesen wurde („lex Miquel-Lasker“). Die daraufhin 1874 vom Bundesrat berufene sog. Erste Kommission60 legte 1888 den Ersten Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich mit den jeweiligen Begründungen der vorgeschlagenen Vorschriften, den sog. Motiven, vor. Eine wegen der Kritik61 am Ersten Entwurf 1890 einberufene sog. Zweite Kommission legte 1895 den Zweiten Entwurf mitsamt den die Begründungen enthaltenden sog. Protokollen vor, welcher 1896 vom Bundesrat beraten, anschließend als Reichstagsvorlage62 eingebracht, vom Reichstag inhaltlich nahezu unverändert angenommen und am 18.8.1896 von Kaiser Wilhelm II. ausgefertigt, unterschrieben und verkündet wurde63. Die sog. Materialien zum BGB (Motive, Protokolle)64 sind nach wie vor von großer Bedeutung für die Auslegung65 der Vorschriften des BGB. Am 1.1.1900 ist das BGB in Kraft getreten (Art. 1 Abs. 1 EGBGB).