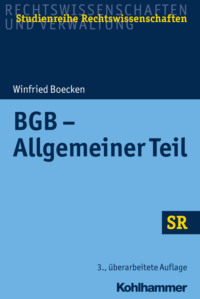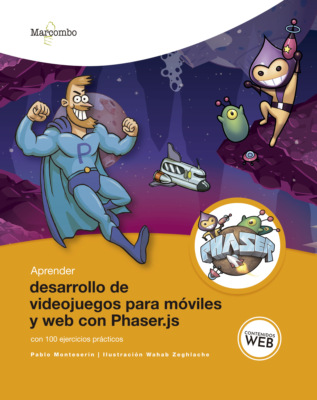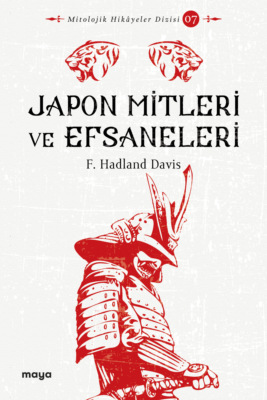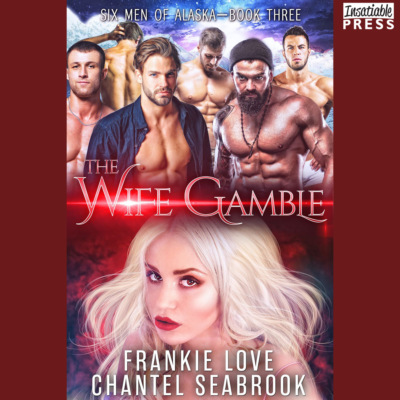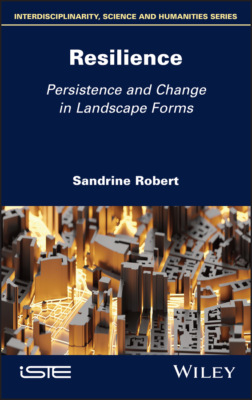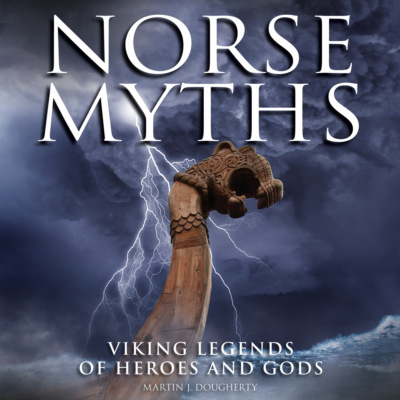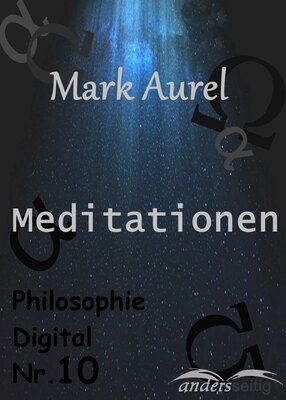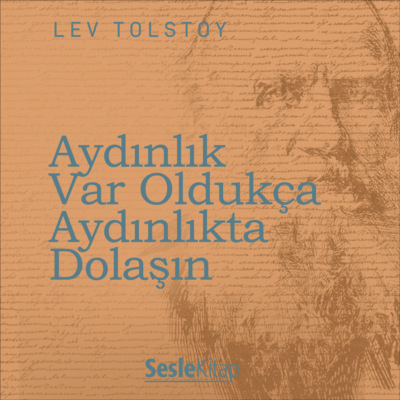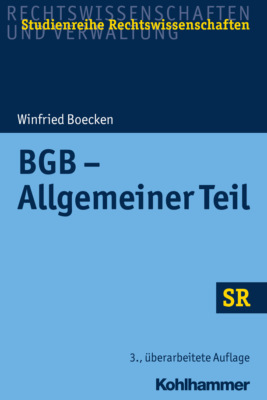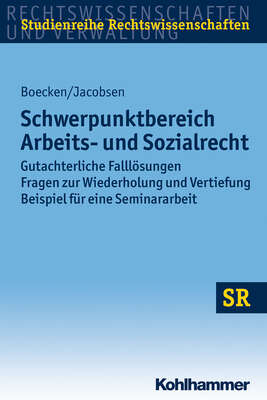Kitabı oku: «BGB – Allgemeiner Teil», sayfa 4
c) Legaldefinitionen
49 Auslegungsfragen und -schwierigkeiten ergeben sich insb. dann, wenn das Gesetz Begriffe nicht selbst – im Wege einer sog. Legaldefinition – definiert125. So stellt bspw. die Vorschrift des § 903 Satz 1 nicht klar, wann eine „Einwirkung“ i. S. d. Regelung vorliegt. In § 833 Satz 2 wird nicht ausdrücklich näher bestimmt, was unter dem abstrakt verwendeten Begriff „Haustier“ i. S. d. Vorschrift zu verstehen ist. An anderen Stellen erleichtert das Gesetz die Rechtsanwendung mitunter, indem es regelmäßig besonders wichtige und im Gesetz häufig verwendete Begriffe legaldefiniert, so etwa die Begriffe „Sache“ (§ 90)126, „unverzüglich“ (§ 121 Abs. 1 Satz 1), „kennen musste“ (§ 122 Abs. 2), „Einwilligung“ (§ 183 Satz 1), „Genehmigung“ (§ 184 Abs. 1), „Anspruch“ (§ 194 Abs. 1)127. Der Begriff „Unternehmer“ wird in § 14 legaldefiniert.
Bsp.: „Verbraucher“128 ist nach der Legaldefinition des § 13 jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können129.
d) Fiktionen
50 Mittels einer Fiktion wird das Vorliegen eines Tatbestands(merkmals) gesetzlich angeordnet, obwohl dessen tatsächliche Voraussetzungen nicht gegeben sind, oder im umgekehrten Fall ein Tatbestands(merkmal) als nicht einschlägig fingiert, obwohl seine Voraussetzungen eigentlich erfüllt sind130. Die Verwendung einer Fiktion wird deutlich, wenn im Gesetz von „gilt“131 oder „gelten“132 die Rede ist.
Bsp.: Nach § 1923 Abs. 1 kann nur Erbe werden, wer zur Zeit des Erbfalls lebt. Diese sog. Erbfähigkeit tritt als Teil der Rechtsfähigkeit bei natürlichen Personen mit der Vollendung der Geburt ein (s. § 1). Zum Schutz des Embryos enthält § 1923 Abs. 2 eine Fiktion: Wer zur Zeit des Erbfalls noch nicht lebte, aber bereits gezeugt war, gilt als vor dem Erbfall geboren.
e) Auslegungsregeln
51 An einigen Stellen stellt das BGB sog. Auslegungsregeln auf. Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass die Formulierung „im Zweifel“ herangezogen wird133. Besteht im konkreten Fall eine von der gesetzlichen Zweifelsregelung abweichende rechtsgeschäftliche Regelung, so gilt allein diese.
Bsp.: Ein Kostenanschlag ist nach der Auslegungsregel des § 632 Abs. 3 „im Zweifel“ nicht zu vergüten. Vereinbaren die Parteien des Werkvertrags indes eine Vergütung bereits für den Kostenanschlag, so gilt maßgeblich diese Vereinbarung und die Zweifelsregelung des § 632 Abs. 3 kommt nicht zur Anwendung.
f) Gesetzliche Vermutungen
52 Gesetzliche Vermutungen haben eine ähnliche Funktion wie Fiktionen. Gesetzliche Vermutungen sind entweder die gesetzgeberisch anerkannte Folge davon, dass bestimmte Geschehensabläufe mit einer gewissen Regelmäßigkeit, nicht aber Ausschließlichkeit erfolgen oder die Konsequenz dessen, dass bestimmte Umstände nicht mit vertretbarem Aufwand in letzter Gewissheit aufklärbar sind. Mitunter spricht das Gesetz selbst davon, dass etwas „vermutet“ wird134.
Bsp.: Zeigt sich innerhalb von sechs Monaten seit Gefahrübergang ein Sachmangel, so wird vermutet, dass die Sache bereits bei Gefahrübergang mangelhaft war, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar (§ 477, Beweislastumkehr135).
Zu unterscheiden sind widerlegbare und unwiderlegbare Vermutungen. Der Beweis des Gegenteils einer gesetzlich vermuteten Tatsache ist zulässig, sofern nicht das Gesetz selbst ausdrücklich ein anderes vorschreibt (§ 292 Satz 1 ZPO)136.
Bsp.: Es wird unwiderlegbar vermutet, dass die Ehe gescheitert ist, wenn die Ehegatten seit drei Jahren getrennt leben (§ 1566 Abs. 2).
g) Regelungen zur Verteilung der Beweislast
53 Als Beweislast wird diejenige rechtliche Last bezeichnet, die dem Beweispflichtigen obliegt, wenn er eine Tatsache zu beweisen hat, um sein Recht letztlich erfolgreich gerichtlich durchsetzen zu können. Im Zivilrecht gilt der allgemein anerkannte Grundsatz, dass derjenige, der sich auf eine für ihn günstige Rechtsfolge beruft, die Beweislast für die rechtsbegründenden Tatbestandsmerkmale trägt, während den Anspruchsgegner die Beweislast für die rechtsvernichtenden, rechtshindernden und rechtshemmenden Tatbestandsmerkmale trifft137. Kann eine Tatsache von dem Beweispflichtigen sowie ihr Gegenteil von der anderen Seite nicht bewiesen werden – non liquet138 –, so geht dies im Zivilrecht grds. zulasten des Beweispflichtigen. Das Gesetz ordnet mitunter ausdrücklich an, wer die Beweislast trägt139. In anderen Fällen muss der Gesetzesanwender aus der Formulierung der Norm erst den Schluss ziehen, dass eine bestimmte Verteilung der Beweislast aufgestellt wird.
Bsp. (1): Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen (§ 280 Abs. 1 Satz 1). Nach § 280 Abs. 1 Satz 2 gilt dies „nicht“, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung „nicht“ zu vertreten hat. Aus dieser doppelten Verneinung ergibt sich, dass das Verschulden kraft gesetzlicher Anordnung – widerlegbar – vermutet wird und der Schuldner die Beweislast für das Nichtvertretenmüssen trägt140.
Bsp. (2): Abweichend von § 280 Abs. 1 hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber Ersatz für den aus der Verletzung einer Pflicht aus dem Arbeitsverhältnis entstehenden Schaden nur zu leisten, wenn er die Pflichtverletzung zu vertreten hat (§ 619a). Hier hat der Arbeitgeber im Streitfall die Tatsachen darzulegen und zu beweisen, die ein Verschulden des Arbeitnehmers begründen.
§ 3 Grundlagen der Rechtsanwendung/Methode der Fallbearbeitung
Literatur:
Armbrüster/Leske, Hinweise zur Bearbeitung vertragsrechtlicher Klausurfälle, JA 2002, 130; Beck, JURA 2018, 330 ff.; Börsch, Die Planwidrigkeit der Lücke, JA 2000, 117; Brox, Zur Methode der Bearbeitung eines zivilrechtlichen Falles, JA 1987, 169; Byrd/Lehmann, Zitierfibel für Juristen, 2. Aufl. 2011; Drehsen, BRJ 2013, 106 ff. und 2014, 50 ff.; Dühn, Die 10 Gebote der Klausurbearbeitung, JA 2000, 765; Körber, Zivilrechtliche Fallbearbeitung in Klausur und Praxis, JuS 2008, 289; Leenen, JURA 2011, 723 ff.; Petersen, Die Auslegung von Rechtsgeschäften, JURA 2004, 536; Rüthers, JuS 2011, 865 ff.; Schapp, Einführung in das Bürgerliche Recht: Auslegung und Anwendung der Rechtssätze, JA 2002, 763.
Rechtsprechung:
BVerfGE 85, 69 – Eilversammlung (verfassungskonforme Auslegung; Art. 8 Abs. 1 GG, § 14 Abs. 1 VersG); BGHZ 179, 27 m. Anm. Faust, JuS 2009, 274 (richtlinienkonforme Auslegung, Verbrauchsgüterkauf, Nutzungsersatz; beachte nunmehr § 474 Abs. 2 S. 1); BGHZ 112, 122 (Gesetzesauslegung, Analogieschluss, § 656 analog bei Partnerschaftsvermittlungs-Dienstverträgen i. S. v. § 611); BGHZ 55, 153 – Fleet-Fall (Eigentumsverletzung i. S. v. § 823 Abs. 1 durch bloße Nutzungsbeeinträchtigung); BGHZ 46, 74 – Schallplatten (Kartellrecht, Methoden der Gesetzesauslegung und ihr Verhältnis zueinander; Art. 20 Abs. 3 GG, § 16 GWB a. F.); RGZ 158, 388 – Bienen-Fall (Gesetzesauslegung am Beispiel des Begriffs Haustier i. S. v. § 833 Satz 2).
I.Überblick
54 Die Hauptaufgabe des Juristen besteht darin, gesetzliche Bestimmungen auf einen konkreten Lebenssachverhalt anzuwenden. Das gilt insb. auch für den Richter, der bei seiner Recht sprechenden Tätigkeit „an Gesetz und Recht gebunden“ ist (Art. 20 Abs. 3 GG). Die Methoden der Anwendung und Auslegung des BGB haben sich im Laufe der Jahre vielfach gewandelt und weiter entwickelt141. Im Folgenden wird zunächst der Aufbau der (Anspruchs-)Norm erläutert142. Sodann wird auf die Methode der Gesetzesanwendung im Rahmen der juristischen Fallbearbeitung eingegangen143. Von großer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die weiter zu behandelnde Auslegung von Gesetzen144. Schließlich werden einige besondere Argumentationsformen bei der Gesetzesanwendung vorgestellt145.
II.Aufbau der Norm
55 Rechtsnormen (Rechtssätze) weisen eine bestimmte – logische – Struktur auf146. Von besonderer Bedeutung im Privatrecht ist die sog. Anspruchsnorm, welche die Anspruchsgrundlage für eine begehrte Rechtsfolge beinhaltet147. Anspruchsnorm ist jede Norm, die einem Rechtssubjekt148 als Anspruchsinhaber bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen einen Anspruch – also nach § 194 Abs. 1 das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen149 – gewährt.
Bsp.: Der Eigentümer kann gemäß § 985 von dem nicht berechtigten Besitzer die Herausgabe der Sache verlangen.
56 Umgekehrt betrachtet wird durch die Anspruchsnorm eine andere Person, und zwar der Anspruchsgegner, verpflichtet. Die Betrachtung von Berechtigung auf der einen, Verpflichtung auf der anderen Seite, ändert nichts am rechtlichen Ergebnis, sondern ist vielmehr Ausdruck ein und desselben rechtlichen Gebildes, nämlich des Anspruchs.
57 Anspruchsnormen bestehen aus zwei Teilen, dem Tatbestand und der Rechtsfolge. Dabei enthält der Tatbestand die Voraussetzungen (V1, V2, V3, … Vn), bei deren Vorliegen die Rechtsfolge (R) eintritt. Es gilt demnach: V1+V2+V3 + …Vn = R. Die Anzahl der Voraussetzungen ist davon abhängig, wie viele Voraussetzungen der Tatbestand der konkreten Anspruchsnorm enthält. Erst wenn alle Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sind, besteht auf der Rechtsfolgenseite das Recht, ein Tun oder Unterlassen zu verlangen (§ 194 Abs. 1), d. h., der Anspruch ist gegeben.
Bsp.: Die von der Anspruchsnorm § 823 Abs. 1 gewährte Rechtsfolge „Verpflichtung zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens“ tritt ein, wenn folgende Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sind:
– Verletzungserfolg (Verletzung eines der in § 823 Abs. 1 genannten Rechte oder Rechtsgüter),
– Verletzungshandlung (positives Tun oder Unterlassen),
– haftungsbegründende Kausalität (zwischen Verletzungshandlung und Verletzungserfolg),
– Rechtswidrigkeit des Verhaltens sowie
– Verschulden.
Liegen diese Voraussetzungen vor, so bestimmt § 823 Abs. 1 als Rechtsfolge, dass der Schädiger „dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet“ ist. Auf der Rechtsfolgenseite ist danach noch zu prüfen:
– Eintritt eines Schadens,
– haftungsausfüllende Kausalität (zwischen Verletzungserfolg und Schaden) sowie
– Art und Umfang des Schadens (richtet sich nach §§ 249 ff.).
58 Der Zusammenhang zwischen Tatbestand und Rechtsfolge wird als konditionale150 Struktur bezeichnet151. Nicht nur Anspruchsnormen weisen eine solche konditionale Struktur auf. Diese Struktur findet sich auch bei Bestimmungen, die als Rechtsfolge einen anderen Inhalt als die Gewährung eines Anspruchs regeln.
Bsp.: Mit der Vollendung der Geburt – Tatbestandsvoraussetzung – beginnt nach § 1 die Rechtsfähigkeit des Menschen (Rechtsfolge).
III.Methode der Gesetzesanwendung, Fallbearbeitung
59 Die Methode der Gesetzesanwendung beschreibt die Anwendung einer gesetzlichen Bestimmung – also einer abstrakten Norm152 – auf einen konkreten Lebensvorgang (Fall, Sachverhalt). Es wird geprüft, ob ein konkreter Lebenssachverhalt den Tatbestand einer Rechtsnorm erfüllt. Ist dies der Fall, so tritt die im Gesetz angeordnete Rechtsfolge ein. So gewährt die Anspruchsnorm ihrem Inhaber einen Anspruch (§ 194 Abs. 1) gegen den Anspruchsgegner153. Den Prüfvorgang im Rahmen der Bearbeitung eines juristischen Falls, ob ein Lebenssachverhalt dem gesetzlichen Tatbestand entspricht, also die einzelnen Tatbestandsvoraussetzungen der Rechtsnorm erfüllt, nennt man Subsumtion.
1.Vorgehensweise bei der Gesetzesanwendung
60 Die Methode der Gesetzesanwendung weist eine logische Struktur auf, den sog. Syllogismus154. Zwei Voraussetzungen (Prämissen) – genannt „Obersatz“ und „Untersatz“ – ergeben eine Schlussfolgerung (Konklusion) – genannt „Schlusssatz“155. Im Rahmen der juristischen Fallbearbeitung ist zunächst ein Obersatz zu bilden, bestehend aus Tatbestand und Rechtsfolge derjenigen Norm, aus welcher sich möglicherweise ein Anspruch ergibt. In einem zweiten Schritt – auf der Ebene des Untersatzes – ist zu prüfen, ob sich der konkrete Lebenssachverhalt dem Tatbestand der gesetzlichen Regelung unterordnen lässt, ob also die einzelnen Voraussetzungen des Tatbestands der Norm erfüllt sind. Dieser zweite Schritt im Rahmen der Gesetzesanwendung wird als Subsumtion bezeichnet. Schließlich wird als dritter und letzter Schritt ein Schlusssatz formuliert. Hier wird das Ergebnis der Prüfung mitgeteilt, das bei Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen in dem Eintritt der Rechtsfolge besteht.
Bsp.: V und K schließen einen Kaufvertrag über ein Kfz. K verlangt von V Übergabe des Kfz und Verschaffung des Eigentums gemäß § 433 Abs. 1 Satz 1.
– 1. Schritt (Obersatz):
Durch den Kaufvertrag über eine Sache (Tatbestand) wird der Verkäufer gemäß § 433 Abs. 1 Satz 1 verpflichtet, dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum zu verschaffen (Rechtsfolge).
– 2. Schritt (Untersatz):
Prüfung des Tatbestandsmerkmals „Kaufvertrag“:
Nach dem Sachverhalt haben V und K einen Kaufvertrag geschlossen. (Die Prüfung als solche ist deshalb hier unproblematisch.)
Prüfung des Tatbestandsmerkmals „Sache“:
Sachen i. S. d. BGB sind nach § 90 nur körperliche Gegenstände. Das Kfz ist ein körperlicher Gegenstand und damit eine Sache.
Die Voraussetzungen des Tatbestands des § 433 Abs. 1 Satz 1 sind gegeben.
– 3. Schritt (Schlusssatz):
Damit tritt die Rechtsfolge gemäß § 433 Abs. 1 Satz 1 ein: V ist verpflichtet, dem K das Kfz zu übergeben und Eigentum daran zu verschaffen. (Anders formuliert: K hat einen Anspruch gegen V auf Übergabe und Übereignung des Kfz gemäß § 433 Abs. 1 Satz 1)
2.Ermittlung des Anspruchsziels, Auffinden der Anspruchsgrundlage
→ Schema 1 Rn. 760
61 Der Subsumtion zwingend vorauszugehen haben die mitunter schwierig zu beantwortenden Fragen nach dem konkreten Begehren des Anspruchstellers, dem sog. Anspruchsziel, sowie danach, aus welcher Rechtsnorm bzw. welchen Rechtsnormen sich dieses Begehren ergeben kann. Hierbei geht es um das Auffinden der maßgeblichen Anspruchsgrundlage bzw. -grundlagen. Deshalb ist nach eingehender Lektüre des zu bearbeitenden Sachverhalts herauszufinden, was im konkreten Fall geltend gemacht wird, sprich, der Anspruchsteller tatsächlich begehrt. In Betracht kommt etwa das Verlangen nach Verschaffung einer Sache zu Eigentum, weil nach Ansicht des Anspruchstellers ein Kaufvertrag darüber abgeschlossen wurde, oder nach Schadensersatz, weil der Anspruchsgegner eine Körperverletzung begangen habe, oder nach Herausgabe einer Sache, weil sie dem Anspruchsteller weggenommen worden sei etc. Im Hinblick darauf, dass das tatsächliche Begehren des Anspruchstellers oftmals nicht in juristischen Termini zum Ausdruck gebracht wird, ist der Sachverhalt gleichsam aus der „Laiensprache“ in die juristische Fachsprache zu übersetzen.
Bsp.: Verlangt A von B, jener solle „gefälligst nachts nicht ständig so einen Lärm machen, dass man gar nicht mehr schlafen kann“, so ist das Begehren des A jedenfalls auf Unterlassung gerichtet, ggf. zusätzlich auf Schadensersatz, etwa wegen Gesundheitsbeeinträchtigung.
62 Nach Klärung des Anspruchsziels ist in einem nächsten Schritt nach einer Rechtsnorm zu suchen, die einen entsprechenden Anspruch156 als Rechtsfolge enthält, also nach der Anspruchsgrundlage. Als Hilfsmittel kann hierbei die Frage: „Wer will von wem was woraus?“ herangezogen werden. Das Fragewort „Wer“ betrifft die Person des Anspruchstellers, „wem“ die des Anspruchsgegners, „was“ meint das Anspruchsziel und „woraus“ fragt nach der Anspruchsgrundlage.
Bsp.: Verkäufer V („Wer“) will von Käufer K („wem“) Bezahlung des vereinbarten Kaufpreises („was“) aus § 433 Abs. 2 („woraus“).
63 Erst nach Klärung dieser Fragen kann die materielle Prüfung unter Berücksichtigung der Subsumtionstechnik (Syllogismus) beginnen.
3.Gutachtenstil
64 Im Rahmen der juristischen Fallbearbeitung im rechtswissenschaftlichen Studium wird regelmäßig gefordert, die Prüfung im sog. Gutachtenstil vorzunehmen. Das bedeutet, dass nicht bereits eingangs das Ergebnis der Prüfung mitgeteilt wird. Vielmehr ist im Obersatz157 zunächst die Möglichkeit eines Anspruchs auf der Grundlage einer bestimmten Norm zu formulieren. Empfehlenswert ist dabei die Verwendung des Modus des Konjunktivs.
Bsp.: Macht K einen Anspruch auf Lieferung eines Kfz aus einem Kaufvertrag geltend, so müsste der Obersatz im Gutachten wie folgt formuliert werden: K könnte gegen V einen Anspruch auf Eigentumsverschaffung und Übergabe des Kfz aus § 433 Abs. 1 Satz 1 haben158.
65 Nach der Formulierung des Obersatzes im Gutachtenstil sind zur weiteren Verdeutlichung die abstrakten Voraussetzungen des gesetzlichen Tatbestands, welche erfüllt sein müssen, damit die begehrte Rechtsfolge ausgelöst wird, aufzuführen. Auch insoweit ist der Modus Konjunktiv zu bemühen.
Bsp.: Dann müsste zwischen V und K ein Kaufvertrag über ein Kfz geschlossen worden sein.
66 Anschließend ist jede einzelne Tatbestandsvoraussetzung – ihrerseits wiederum im Gutachtenstil – „durchzuprüfen“, d. h., es ist im Untersatz159 zu ermitteln, ob das jeweilige Tatbestandsmerkmal aufgrund des vorliegenden Lebenssachverhalts erfüllt ist.
Bsp.: Zunächst ist zu prüfen, ob zwischen V und K ein Kaufvertrag zustande gekommen ist. Das ist nach dem Sachverhalt der Fall. Als weitere Voraussetzung ist zu prüfen, ob ein Kaufvertrag über eine Sache zustande gekommen ist. Gemäß § 90 sind Sachen i. S. d. Gesetzes nur körperliche Gegenstände160. Bei dem Kfz handelt es sich um einen körperlichen Gegenstand. Damit liegt ein Kaufvertrag über eine Sache vor. Die Tatbestandsvoraussetzungen des § 433 Abs. 1 Satz 1 sind gegeben.
67 Liegen alle Tatbestandsvoraussetzungen vor, greift die Rechtsfolge der Norm ein. Im Schlusssatz ist abschließend das Ergebnis der Prüfung im Modus des Indikativs zu formulieren.
Bsp.: Im Hinblick darauf, dass die Tatbestandsvoraussetzungen des § 433 Abs. 1 Satz 1 vorliegen, hat K einen Anspruch gegen V auf Übergabe des Kfz und Eigentumsverschaffung.
68 Im Gegensatz zum Gutachtenstil stellt der insb. in gerichtlichen Entscheidungen angewandte und zumeist im Zweiten Juristischen Staatsexamen zu bemühende sog. Urteilsstil das Ergebnis der Fallprüfung an den Anfang161.
Bsp.: K hat gegen V einen Anspruch auf Eigentumsverschaffung und Übergabe des Kfz aus § 433 Abs. 1 Satz 1. Denn die Parteien haben einen Kaufvertrag über das Kfz geschlossen. Das Angebot des V ist vorliegend darin zu sehen, dass (…).
IV.Gesetzesauslegung
1.Bedeutung
69 Will ein Rechtsanwender das Gesetz in inhaltlich zutreffender Weise anwenden, d. h., einen konkreten Lebenssachverhalt den in einer Rechtsnorm sowohl auf Tatbestands- als auch auf Rechtsfolgenseite genannten abstrakten und allgemeinen Begriffen im Wege der Subsumtion unterordnen162, so muss er sich zuvor Klarheit darüber verschaffen, was unter den im Gesetz verwendeten Begriffen zu verstehen ist. Angesichts der im Hinblick auf die zumindest potentielle Regelung unzähliger Fälle durch ein und dieselbe Norm notwendigen Allgemeinheit der abstrakt-generellen Regelungen besteht über den Aussagegehalt einzelner in der Norm verwendeter Begriffe nicht immer endgültige Gewissheit. Das regelmäßig hohe Abstraktionsniveau des BGB wird dadurch zu einem Problem der Rechtsanwendung, denn die Subsumtion eines Lebensvorgangs unter den Tatbestand einer Rechtsnorm verlangt, dass über die in der Norm verwendeten Begriffe Klarheit herrscht. Hier setzt die vor der Subsumtion vorzunehmende sog. Gesetzesauslegung an163. Ein Gesetz auszulegen heißt, seinen Sinn zu erforschen164.
Bsp.: Nach § 823 Abs. 1 ist u. a. derjenige zum Schadensersatz verpflichtet, der vorsätzlich oder fahrlässig das Eigentum eines anderen widerrechtlich verletzt. Ob eine Verletzung des Eigentums nur bei Beschädigung bzw. Zerstörung und Entziehung der Sache gegeben ist, oder auch bei einer bloßen, nicht die Substanz der Sache berührenden Beeinträchtigung ihrer Nutzung, wird aus § 823 Abs. 1 nicht ohne weiteres deutlich. Diese Frage muss durch Auslegung des Begriffs Eigentum ermittelt werden. In dem berühmten „Fleet-Fall“ hat der BGH erstmals die Verletzung des Eigentums auch durch eine reine, die Substanz der Sache selbst unberührt lassende Beeinträchtigung der Nutzung bejaht165.