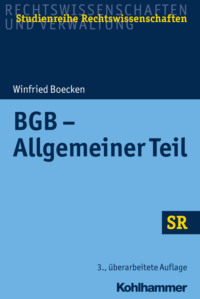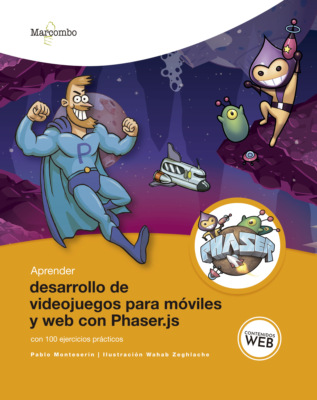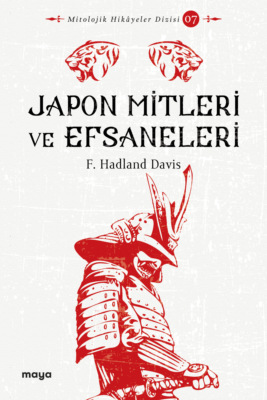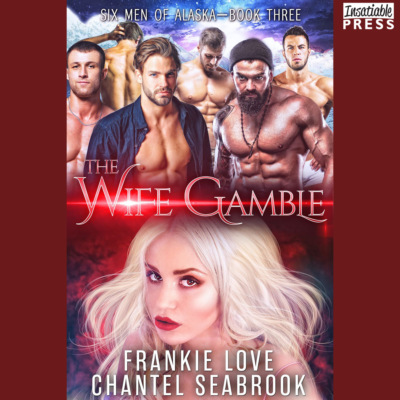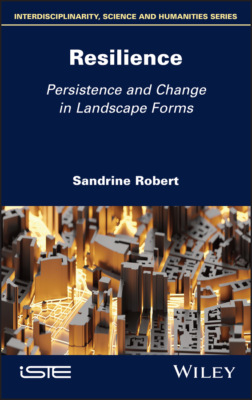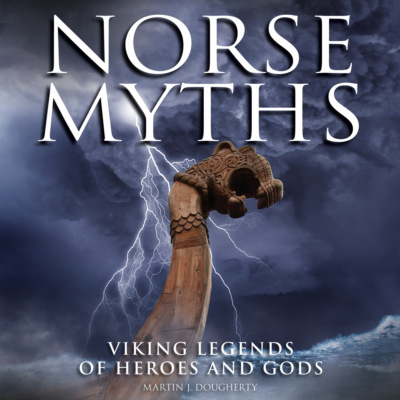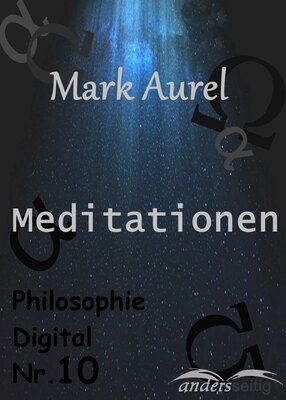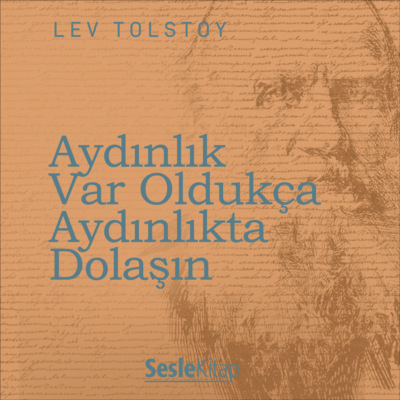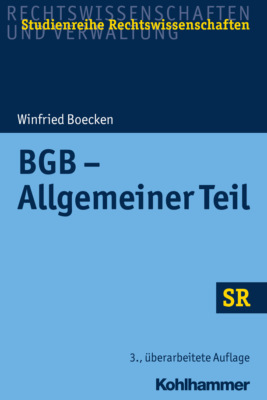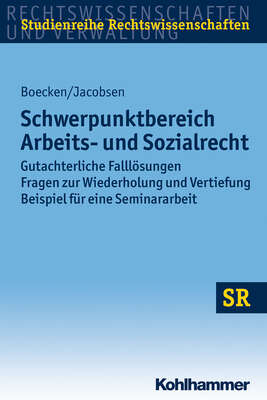Kitabı oku: «BGB – Allgemeiner Teil», sayfa 3
II.Gründe für die Schaffung des BGB
24 Das BGB war die erste einheitliche Kodifikation des bürgerlichen Rechts66 für das damalige deutsche Reich. Vor Inkrafttreten des BGB herrschte ein Zustand der Rechtszersplitterung67, d. h., in den einzelnen Ländern galt jeweils unterschiedliches Landesrecht (sog. Partikularrecht). In Preußen galt das Allgemeine Landrecht für die preußischen Staaten (ALR) von 1794, in Bayern der Codex Maximilianeus bavaricus civilis von 1756, in Sachsen das BGB für das Königreich Sachsen von 1863, in Baden das Badische Landrecht von 1809 und in einigen linksrheinischen Gebieten der aus dem französischen Rechtskreis stammende Code Civil (Code Napoléon) von 1804. Im übrigen Reichsgebiet galt subsidiär – soweit in einem Land eine eigene Kodifikation des bürgerlichen Rechts nicht existierte – das aus dem römischen Recht stammende und in Deutschland etwa ab dem 15./16. Jahrhundert rezipierte „Kaiserrecht“68, aus dem sich das gewohnheitsrechtlich69 anerkannte sog. Gemeine Recht (Pandektenrecht70) entwickelte. Damit hatte das römische Recht einen maßgeblichen Einfluss auf das deutsche Recht gewonnen. Die umfassende Rechtszersplitterung stand dem aufblühenden Handelsverkehr und dem Beginn der Industrialisierung im Wege. Bereits 1833/34 war der deutsche Zollverein gegründet worden. Somit bestand ein maßgebliches Interesse gerade auch der Wirtschaft an einem national einheitlich gültigen Bürgerlichen Gesetzbuch. Vor Inkrafttreten des BGB am 1.1.1900 war eine Rechtsvereinheitlichung im Wesentlichen nur im Bereich des Prozessrechts erreicht worden; seit 1.10.1879 galten die sog. Reichsjustizgesetze71, u. a. ZPO, StPO72 und GVG. Zugleich mit dem BGB traten zum 1.1.1900 das Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG), die Grundbuchordnung (GBO) und das Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)73 in Kraft (siehe Art. 1 Abs. 1 EGBGB). Ebenfalls zum 1.1.1900 trat für den Bereich des Handelsrechts das HGB in Kraft (Art. 1 Abs. 1 EGHGB)74.
III.Entwicklung des BGB
25 Das BGB ist seit seinem Inkrafttreten im Jahr 1900 in den wesentlichen Grundstrukturen unverändert geblieben. Daran haben auch die erheblichen politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen in Deutschland und Europa, etwa infolge der beiden Weltkriege, des Nationalsozialismus, der Wiedervereinigung Deutschlands wie auch des europäischen Einigungsprozesses nichts geändert. Der Grund für diese „Beständigkeit“ des BGB liegt unter anderem in der Abstraktheit der Konzeption des Gesetzbuchs, die sich wesentlich in der sog. Ausklammerungsmethode75 wie auch in der Verwendung von sog. Generalklauseln – z. B. § 242 (Treu und Glauben) und § 138 (gute Sitten) – widerspiegelt, was die Möglichkeit einer flexiblen Anpassung an die jeweils vorherrschenden politischen und gesellschaftlichen Zielvorstellungen eröffnete76.
26 Trotz der in der Gesamtheit festzustellenden Kontinuität in den wesentlichen Grundstrukturen hat das BGB seit dem Zeitpunkt seines Inkrafttretens zum Teil aber auch erhebliche gesetzliche Änderungen erfahren. So war in der Vergangenheit vor dem Hintergrund der in Art. 3 Abs. 2 GG niedergelegten Gleichberechtigung von Männern und Frauen insb. das Familienrecht Gegenstand zahlreicher gesetzgeberischer Eingriffe, um diesem verfassungsrechtlichen Gleichberechtigungsgebot im Rahmen des Bürgerlichen Rechts Rechnung zu tragen. Hervorgehoben sei weiter die Gleichstellung nichtehelicher Kinder mit ehelichen Kindern im Familienrecht und im Erbrecht, die ebenfalls verfassungsrechtlich durch den in Art. 6 Abs. 5 GG niedergelegten Gleichstellungsauftrag ausgelöst worden ist. Im Bereich des Schuldrechts sind Änderungen unter anderem im Hinblick auf in der Praxis neu entwickelte Vertragstypen77 wie auch zur Stärkung des Verbraucherschutzes, der zunächst wesentlich außerhalb des BGB punktuell in bürgerlich-rechtlichen Nebengesetzen geregelt war78, für notwendig erachtet worden. Vergleichsweise wenige Änderungen haben neben dem Allgemeinen Teil des BGB das Sachenrecht und das Erbrecht erfahren.
IV.Anwendungs- und Geltungsbereich
1.Zeitlicher Anwendungsbereich
27 Das BGB ist gemäß Art. 1 Abs. 1 EGBGB zum 1.1.1900 in Kraft getreten79. Übergangsvorschriften aus diesem Anlass enthalten die Art. 153 ff. EGBGB80, im Hinblick auf jüngere Änderungen die Art. 219 ff., 229 §§ 1 ff. EGBGB81 sowie aus Anlass der Wiedervereinigung Deutschlands die Art. 230 ff. EGBGB82.
2.Räumlicher Anwendungsbereich
28 Der räumliche Anwendungsbereich des BGB bestimmt sich in Fällen mit Auslandsberührung nach den kollisionsrechtlichen Regelungen insb. der Art. 3 ff. EGBGB83, der Rom I-VO für vertragliche Schuldverhältnisse, der Rom II-VO für außervertragliche Schuldverhältnisse, der Rom III-VO für die Ehescheidung und die Trennung ohne Auflösung des Ehebandes, sowie der Erbrechts-VO für die Rechtnachfolge von Todes wegen, denen sich ein eigenes Teil-Rechtsgebiet, das Internationale Privatrecht (IPR), widmet84.
3.Sachlicher Anwendungsbereich
29 Die im BGB enthaltenen Vorschriften gelten für Bereiche des Sonderprivatrechts nur, soweit dort keine Sonderregelungen bestehen (Subsidiaritätsprinzip). Mit Inkrafttreten des BGB blieb das übrige Bundesrecht („Reichsgesetze“) in Kraft, soweit nicht ein anderes bestimmt war (Art. 50 EGBGB). Einen Vorbehalt für Landesrecht enthält Art. 1 Abs. 2 EGBGB85. Das Verhältnis des BGB zu privatrechtlichen Vorschriften der Landesgesetze wird in Art. 55 ff. EGBGB näher geregelt86; die meisten Bundesländer haben hierzu Ausführungsgesetze zum BGB erlassen87.
V.Zentrale Prinzipien des BGB
1.Privatautonomie
30 Wesentliches Grundprinzip des BGB ist die sog. Privatautonomie. Dieser Grundsatz beinhaltet die Unabhängigkeit und Freiheit des Einzelnen bei der eigenverantwortlichen Gestaltung und Regelung seiner privaten Lebensverhältnisse88. Die wesentlichen Elemente der Privatautonomie sind die Vertrags-, Eigentums-, Testier- sowie Vereinigungsfreiheit89. Art. 2 Abs. 1 GG gewährleistet die Privatautonomie als Selbstbestimmung des Einzelnen im Rechtsleben. Die eigenbestimmte Gestaltung von Rechtsverhältnissen ist Teil der allgemeinen Handlungsfreiheit90, die ihre Grenzen in der Entfaltungsfreiheit Anderer findet. Die Privatautonomie bedarf deshalb der Ausgestaltung durch die Rechtsordnung, insb. im Vertragsrecht91. Die Betonung des Prinzips der Privatautonomie ist erklärbar vor dem politischen Hintergrund bei der Entstehung des BGB92 Ende des 19. Jahrhunderts, der wesentlich von der Idee des Altliberalismus93 sowie der wirtschaftsliberalistischen Einstellung des „laissez faire“94 geprägt war95. Man ging von der Vorstellung aus, dass jeder Mensch in der Lage ist, im freien Wettbewerb seine Lebensverhältnisse selbst – privatautonom – zu regeln. Der Staat sollte sich im Wesentlichen auf die Sozialgesetzgebung und die Schaffung sonstiger Schutzgesetze beschränken (etwa Arbeitnehmer-Schutzgesetze oder das soziale Mietrecht). Ihren rechtlichen Niederschlag hat diese (wirtschafts- und sozial-)politische Vorstellung der Privatautonomie vor allem in drei Rechtsinstituten gefunden: der Vertragsfreiheit (§ 311 Abs. 1), der Eigentumsfreiheit (§ 903) sowie der Testierfreiheit (§§ 1937, 2064 ff.)96. Nach allg. M. ist auch die Vereinigungsfreiheit (§§ 21 ff., 705 ff., Art. 9 Abs. 1 und 3 GG) als Bestandteil der Privatautonomie anzusehen.
a) Vertragsfreiheit
31 Der Grundsatz der Vertragsfreiheit (§ 311 Abs. 1) umfasst die Abschluss- und Beendigungsfreiheit sowie die Inhaltsfreiheit, gleichsam das „Ob“ und „Mit wem“ sowie das „Was“ des Vertrags97. Aufgrund der Vertragsfreiheit ist es grds. jedem Volljährigen98 unbenommen, in eigener Verantwortung Geschäfte abzuschließen und sich zu Leistungen, etwa im Rahmen von Darlehen, Schuldbeitritts- oder Bürgschaftsverträgen, zu verpflichten, selbst wenn diese ihn finanziell überfordern und von ihm notfalls nur unter dauernder Inanspruchnahme des pfändungsfreien Einkommens erbracht werden können99. Für den Bereich des Arbeitsvertragsrechts enthält § 105 Satz 1 GewO eine Spezialregelung des Grundsatzes der Vertragsfreiheit100.
b) Eigentumsfreiheit
32 Gemäß § 903 Satz 1 kann der Eigentümer einer Sache, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen. Gemäß § 903 Satz 2 sind darüber hinaus Belange des Tierschutzes zu beachten101. In den aufgezeigten Grenzen steht es damit grds. im Belieben des Eigentümers, ob er seine Sache bspw. veräußert, belastet, zur Produktion oder anderweitig nutzt oder gar zerstört. Verfassungsrechtlich ist das Eigentum in Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG gewährleistet. Im Unterschied zum BGB, das Eigentum nur an Sachen und Tieren kennt, fällt unter den Schutzbereich des Eigentums i. S. v. Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG grds. jedes vermögenswerte Recht. Erfasst werden also nicht nur Sachen und Tiere, sondern z. B. auch Forderungen, sonstige Rechte an Sachen wie z. B. Pfandrechte und Hypotheken und unter bestimmten Voraussetzungen auch öffentlich-rechtliche Positionen, soweit diese auf eigener (Beitrags-)Leistung des Berechtigten beruhen102.
c) Testierfreiheit
33 Nach § 1922 Abs. 1 geht mit dem Tode einer Person (Erbfall) deren Vermögen (Erbschaft) im Wege der Universalsukzession103 auf den oder die Erben über. Der Erblasser kann nach dem in § 1937 niedergelegten Grundsatz der Testierfreiheit durch einseitige Verfügung von Todes wegen – Testament (§§ 2064 ff., 2229 ff.), letztwillige Verfügung – seine(n) Erben bestimmen. Schranken werden der Testierfreiheit neben dem Pflichtteilsrecht (§§ 2303 ff.) durch die allgemeine Grenze der Sittenwidrigkeit (§ 138 Abs. 1) gezogen104. Verfassungsrechtlich wird die Testierfreiheit als Bestandteil der Institutsgarantie des Erbrechts durch Art. 14 Abs. 1 GG gewährleistet.
d) Vereinigungsfreiheit
34 Das Grundrecht des Art. 9 Abs. 1 GG gewährleistet allen Deutschen das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. Damit garantiert es dem einzelnen Bürger die Freiheit, sich aus privater Initiative mit anderen zu Vereinigungen irgendwelcher Art zusammenzufinden, sie zu gründen, ihnen beizutreten, aber auch ihnen fernzubleiben und aus ihnen wieder auszutreten105. Einfachgesetzlich wird die Vereinigungsfreiheit insb. im Rahmen der vereinsrechtlichen Vorschriften (§§ 21 ff.) sowie im Bereich des Gesellschaftsrechts (§§ 705 ff.) gewährleistet. Ihr ist im Zivilrecht durch die Auslegung der privatrechtlichen Vorschriften, insb. der Generalklauseln (§§ 138, 242), Rechnung zu tragen106. Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften sowie Arbeitnehmer und Arbeitgeber können sich auf den ausnahmsweise im Privatrecht unmittelbar geltenden Schutz der Koalitionsfreiheit aus Art. 9 Abs. 3 GG berufen107.
2.Weitere Prinzipien
35 Neben dem Kernprinzip der Privatautonomie finden sich im BGB weitere bedeutsame allgemeine Prinzipien, insb. der durch eine Vielzahl von Regelungsbereichen und Einzelvorschriften verwirklichte Schutz sozial schwacher Personen sowie der in jüngerer Zeit stetig an Bedeutung gewinnende privatrechtliche Verbraucherschutz.
36 Sozialer Schutz bzw. Ausgleich wird im BGB für den Bereich der Wohnraummietverhältnisse durch das sog. „soziale Mietrecht“ verwirklicht. Der Gesetzgeber hielt es für erforderlich, den im Verhältnis zum Vermieter bei der Vertragsgestaltung regelmäßig in einer schwächeren Position befindlichen Mieter von Wohnraum zu schützen. Auf vielfältige Weise wird diesem typisierend angenommenen Ungleichgewicht Rechnung getragen, vor allem durch zugunsten des Wohnraummieters einseitig zwingende108 „Preis-“109 und Bestandsschutzregelungen110.
Bsp.: Nach § 574 Abs. 1 Satz 1 kann der Mieter der Kündigung des Vermieters widersprechen und die Fortsetzung des Mietverhältnisses verlangen, wenn die Beendigung des Mietverhältnisses für den Mieter, seine Familie oder einen anderen Angehörigen seines Haushalts eine „Härte“ bedeuten würde, die auch unter Würdigung der berechtigten Interessen des Vermieters nicht zu rechtfertigen ist. Eine „Härte“ liegt gemäß § 574 Abs. 2 auch vor, wenn angemessener Ersatzwohnraum zu zumutbaren Bedingungen nicht beschafft werden kann. Eine zum Nachteil des Mieters von diesen Schutzvorschriften abweichende Vereinbarung ist nach § 574 Abs. 4 unwirksam.
37 Des Weiteren finden sich im BGB neben den Schutzvorschriften des sozialen Wohnraummietrechts vor allem auch für den Bereich des Dienst- bzw. Arbeitsvertragsrechts eine Reihe von Schutzvorschriften zugunsten des Dienst- bzw. Arbeitnehmers. Die privatrechtlichen Vorschriften des Arbeitnehmerschutzes im BGB111 sind mit dem Schutz der Mieter von Wohnraum vor dem Hintergrund vergleichbar, dass bezogen auf das Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber von einem sog. strukturellen Machtungleichgewicht zum Nachteil des Ersteren vor allem bei der Gestaltung der Arbeitsbedingungen ausgegangen und der Arbeitnehmer deshalb für schutzbedürftig erachtet wird. In diesem Zusammenhang sei auch auf den im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) als eines bürgerlich-rechtlichen Nebengesetzes geregelten Schutz unter anderem der Arbeitnehmer vor Benachteiligungen wegen eines der in § 1 AGG genannten Merkmale (z. B. wegen des Geschlechts, einer Behinderung oder des Alters) hingewiesen112.
38 Über den Schutz sozial schwacher Personen hinaus hat vor allem durch die Rechtsetzung der Eurpäischen Union als weiteres Prinzip der Schutz des Verbrauchers im Verhältnis zum Unternehmer Eingang in das BGB gefunden. Die insoweit für das Recht des Verbraucherschutzes im Ausgangspunkt maßgeblichen Definitionen der Begriffe „Verbraucher“ und „Unternehmer“ finden sich in den Vorschriften des Allgemeinen Teils. Gemäß § 13 ist Verbraucher jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 Abs. 1)113. Zum Verbraucherschutz gehören etwa die in den §§ 312 ff. getroffenen Regelungen zu besonderen Vertriebsformen, des Weiteren die in §§ 474 ff. niedergelegten Bestimmungen zum Verbrauchsgüterkauf wie auch die in §§ 491 ff. enthaltenen Vorschriften zum Verbraucherdarlehensvertrag sowie die Regelungen zu Finanzierungshilfen (§§ 506 ff.) und Ratenlieferungsverträgen (§ 510).
39 Abschließend sei noch auf den Schutz des Vertragspartners des Verwenders Allgemeiner Geschäftsbedingungen (AGB) vor „unangemessener Benachteiligung“ durch die Vorschriften des AGB-Rechts (§§ 305 ff.) hingewiesen, der nicht allein, aber auch einen Verbraucherschutz beinhaltet. Erforderlich ist insoweit zunächst das Vorliegen von AGB. Nach der Definition des § 305 Abs. 1 Satz 1 sind AGB „für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierte Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei (Verwender) der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrags stellt.“ Weiter ist die Eröffnung des persönlichen Anwendungsbereichs der AGB-Vorschriften nach § 310 erforderlich. Sind die vorformulierten Vertragsbedingungen zudem nach Maßgabe der §§ 305 Abs. 2, Abs. 3, 305a ff. wirksam in den Vertrag einbezogen worden, so werden sie schließlich der Inhaltskontrolle am Maßstab der §§ 309, 308, 307 unterzogen114.
VI.Inhalt und Regelungstechniken des BGB
1.Inhalt des BGB
a) Allgemeiner Teil (Buch 1)
40 Das Erste Buch des BGB, der in den Vorschriften der §§ 1–240 normierte Allgemeine Teil, enthält grundlegende allgemeine Regelungen, die vor allem für die anderen Bücher des BGB, darüber hinaus aber auch außerhalb des BGB von Bedeutung sind. Neben Bestimmungen u. a. über Personen (§§ 1 ff.) sowie Sachen und Tiere (§§ 90 ff.) finden sich hier als Kern dieses Buches die Normen über Rechtsgeschäfte (§§ 104 ff.)115.
b) Recht der Schuldverhältnisse (Buch 2)
41 Das im Zweiten Buch des BGB in den Vorschriften der §§ 241–853 niedergelegte Recht der Schuldverhältnisse (Schuldrecht) ist unterteilt in einen allgemeinen Teil (§§ 241–432) und einen besonderen Teil (§§ 433–853). Regelungsgegenstand des Schuldrechts sind wesentlich Vorschriften über Sonderverbindungen zwischen Personen, die auf vertraglicher oder gesetzlicher Grundlage beruhen und Ansprüche bzw. Verpflichtungen der Personen untereinander begründen.
c) Sachenrecht (Buch 3)
42 Das Sachenrecht als Drittes Buch des BGB regelt in den Bestimmungen der §§ 854–1296 die rechtlichen Beziehungen einer Person zu einer Sache. Zentraler Regelungsgegenstand des Sachenrechts ist das Eigentum als das umfassendste Recht an einer Sache (§§ 903 ff.). Darüber hinaus sind im Sachenrecht vor allem die gegenüber dem Eigentum sog. beschränkt dinglichen Rechte an Sachen normiert (z. B. die Hypothek an einem Grundstück, §§ 1113 ff., oder das Pfandrecht an beweglichen Sachen, §§ 1204 ff.).
d) Familienrecht (Buch 4)
43 Das Vierte Buch des BGB regelt das Familienrecht in den Vorschriften der §§ 1297–1921. Neben dem umfassend normierten Rechtsinstitut der bürgerlichen Ehe (§§ 1297 ff.) finden sich in diesem Buch Bestimmungen über die Verwandtschaft (§§ 1589 ff.) und Vormundschaft (§§ 1773 ff.), rechtliche Betreuung (§§ 1896 ff.) und Pflegschaft (§§ 1909 ff.).
e) Erbrecht (Buch 5)
44 Das im Fünften Buch des BGB geregelte Erbrecht (§§ 1922–2385) enthält Vorschriften über die vermögensrechtlichen Folgen des Todes eines Menschen, des sog. Erblassers. Neben Bestimmungen u. a. über die Erbfolge (§§ 1922 ff.) finden sich im Erbrecht Regelungen insb. zur rechtlichen Stellung des Erben (§§ 1942 ff.) sowie zum Testament (§§ 2064 ff.).
2.Regelungstechniken des BGB
a) Ausklammerungsmethode
45 Maßgebliche Bedeutung misst das BGB der sog. Ausklammerungsmethode (Abstraktionsmethode, Klammertechnik) bei, d. h., der Technik des Voranstellens des Allgemeinen vor das Besondere116. Dies zeigt sich zum einen daran, dass die im Allgemeinen Teil des BGB geregelten – gleichsam „vor die Klammer“ gezogenen – grundlegenden allgemeinen Vorschriften insb. über Personen, Sachen und Rechtsgeschäfte grds. auch für alle anderen Bücher des BGB Geltung beanspruchen, soweit dort keine bereichsspezifischen Sonderregelungen bestehen117. Dieses gesetzestechnische Vorgehen erfordert einen hohen Grad an Abstraktion118.
Bsp.: Die allgemeinen Regeln der §§ 104 ff., 145 ff. über das Zustandekommen und die Wirksamkeit von Verträgen finden grds. auf alle Vertragsarten Anwendung119, etwa auch auf den Ehevertrag (§§ 1408 ff.)120 und den Erbvertrag (§§ 2274 ff.)121, unter Berücksichtigung der dort ggf. vorgesehenen Modifikationen bzw. Sonderregelungen.
46 Des Weiteren wird die Ausklammerungstechnik auch innerhalb der einzelnen Bücher des BGB angewendet. So werden im Zweiten Buch des BGB, dem Schuldrecht, zunächst die Schuldverhältnisse allgemein geregelt – Allgemeines Schuldrecht (Abschnitte 1–7: §§ 241–432) –, gefolgt von besonderen Vorschriften für einzelne typische Schuldverhältnisse – Besonderes Schuldrecht (Abschnitt 8: §§ 433–853) –, etwa betreffend den Reisevertrag (§§ 651a–651y).
Bsp. (1): Im Rahmen der nach § 651p Abs. 1 durch Vereinbarung zulässigen Haftungsbeschränkung des Reiseveranstalters für solche Schäden auf den dreifachen Reisepreis, die keine Körperschäden sind und nicht schuldhaft herbeigeführt werden, ist für die Frage des Verschuldens die allgemeine schuldrechtliche Regelung des § 276 Abs. 1 zu beachten. Danach hat der Schuldner grds. Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten.
Bsp. (2): Die Vorschrift des § 362 Abs. 1 regelt die Rechtsfolge des Bewirkens der geschuldeten Leistung an den Gläubiger dahingehend, dass das Schuldverhältnis durch Erfüllung erlischt. Diese allgemein angeordnete Rechtsfolge gilt grds. für alle besonderen Schuldverhältnisse, u. a. Kaufvertrag (§ 433), Schenkungsvertrag (§ 516), Werkvertrag (§ 631) etc.
b) Verweisungstechnik
47 Dem abstrahierenden Stil verpflichtet finden sich im BGB zahlreiche Verweisungen auf einzelne Vorschriften oder gesamte Regelungskomplexe innerhalb wie außerhalb des BGB.
Bsp.: Für Arbeitsverträge, die auf bestimmte Zeit abgeschlossen werden, gilt gemäß § 620 Abs. 3 das Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG)122. Nach § 27 Abs. 3 Satz 1 finden auf die Geschäftsführung des Vorstands eines Vereins die für den Auftrag geltenden Vorschriften der §§ 664–670 entsprechende Anwendung. Die Vorschriften des § 164 Abs. 1 finden entsprechende Anwendung auf die sog. Passivvertretung (§ 164 Abs. 3).
48 Wird auf eine Rechtsnorm sowohl hinsichtlich ihres Tatbestands wie auch ihrer Rechtsfolge verwiesen, so wird von einer sog. Rechtsgrundverweisung123 gesprochen. Nimmt die verweisende Norm lediglich die Rechtsfolge einer anderen Norm in Bezug, so handelt es sich um eine sog. Rechtsfolgenverweisung124.