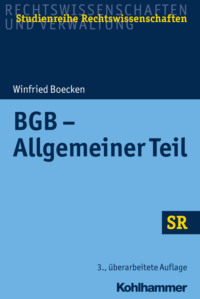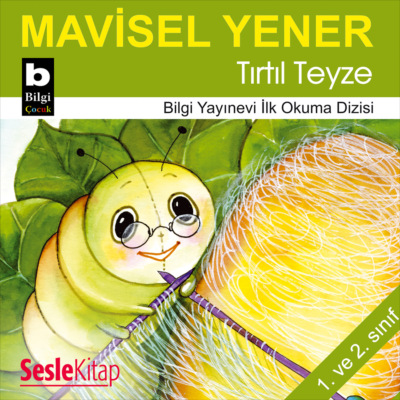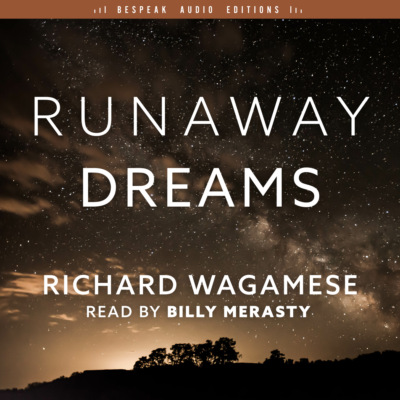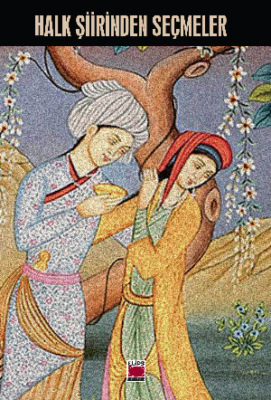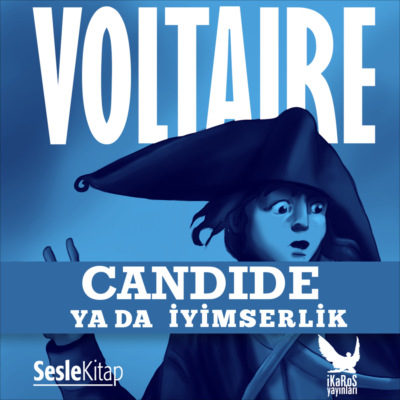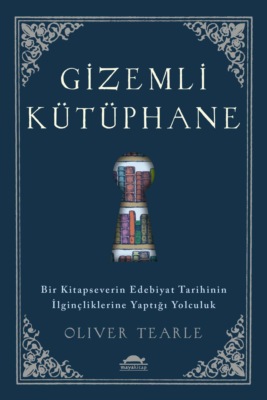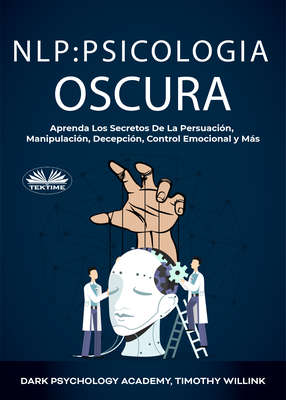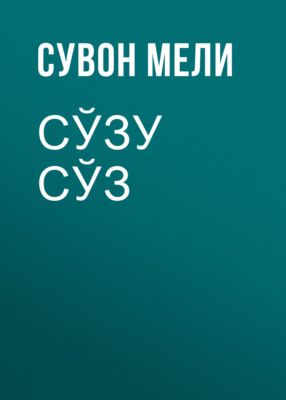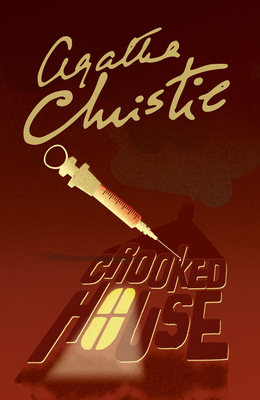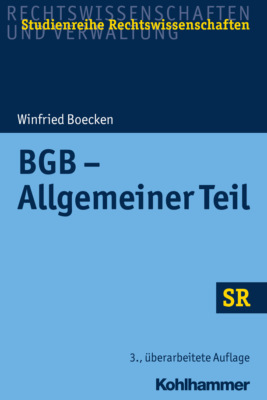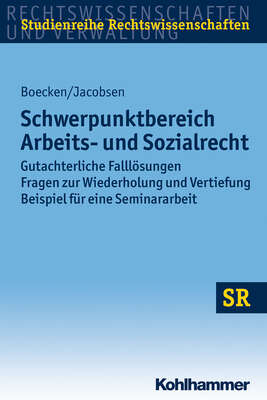Kitabı oku: «BGB – Allgemeiner Teil», sayfa 5
2.Auslegungsmethoden
70 Im Wege der Gesetzesauslegung wird zur näheren Bestimmung des Inhalts eines Begriffs zunächst auf vier nebeneinander anzuwendende Methoden bzw. Kriterien der Auslegung zurückgegriffen. Neben diesem sog. Viererkanon der „klassischen“ Auslegungsmethoden166 – die grammatikalische, systematische, historische und teleologische Auslegung167 – können ggf. weitere Prinzipien der Auslegung Beachtung finden.
a) „Viererkanon“ der Auslegung
71 Es ist i. d. R. sinnvoll, die vier klassischen Auslegungsmethoden in der nachfolgenden Reihenfolge – grammatikalische, systematische, historische und teleologische Auslegung – zu prüfen168. In dem sog. Bienen-Fall169 hat das RG vorbildlich die vorgenannten Auslegungsmethoden zur Klärung der Frage, ob es sich bei der Biene um ein Haustier i. S. d. § 833 Satz 2 handelt, herangezogen.
Bsp.: Auf einem Truppenübungsplatz wurde ein Pferdegespann des Militärs von einem Bienenschwarm überfallen, der einem Imker auf dem benachbarten Grundstück gehörte. Vier Pferde verendeten. Das Militär nahm den Imker wegen der verendeten Pferde auf Schadensersatz in Anspruch. – Nach § 833 Satz 1 ist derjenige, der ein Tier hält, u. a. dann zum Schadensersatz verpflichtet, wenn durch das Tier eine Sache (oder ein Tier, s. § 90a Satz 3) beschädigt wird. Diese, von einem Verschulden unabhängige Gefährdungshaftung tritt nach § 833 Satz 2 nicht ein, wenn der Schaden durch ein Haustier verursacht wird, das dem Beruf, der Erwerbstätigkeit oder dem Unterhalt des Tierhalters zu dienen bestimmt ist, und entweder der Tierhalter bei der Beaufsichtigung des Tieres die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde. Die in dem RG-Fall durch Auslegung zu klärende Frage war die, ob es sich bei Bienen um Haustiere i. S. d. § 833 Satz 2 handelt mit der Folge, dass der vom Militär auf Schadensersatz wegen der Verendung der Pferde in Anspruch genommene Imker nicht gehaftet hätte, sofern er bei der Beaufsichtigung der Bienen die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet hat oder der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre.
72 Diezunächst heranzuziehende grammatikalische Auslegungsmethode geht von dem Wortlaut der Norm aus und fragt nach dem Sinn des verwendeten Begriffs unter Heranziehung des allgemeinen oder, sofern gegeben, des juristischen Sprachgebrauchs. Existiert keine juristische Definition des verwendeten Begriffs, so ist eine endgültige Klärung des Inhalts eines im Gesetz verwendeten Begriffs mit der grammatikalischen Auslegungsmethode in kritischen Fällen selten möglich.
Bsp.: Allein aus dem in § 833 Satz 2 verwendeten Begriff Haustier lässt sich nicht entnehmen, ob darunter auch Bienen zu verstehen sind. Zwar kann davon ausgegangen werden, dass hierzu typischerweise zahme Tiere wie Hunde, Katzen, Pferde, Schweine gehören, die der Mensch in seiner Nähe hält. Damit ist aber nicht auszuschließen, dass hierunter auch die von Menschen in Bienenstöcken gehaltenen Bienen fallen können. In seiner Entscheidung hat das RG zur Auslegung nach dem Wortsinn ausgeführt, dass § 833 Satz 2 „… keine ausdrückliche Angabe darüber (enthält), welche Tiere Haustiere sind.“170.
73 Bei dieser Methode der Auslegung nach dem Gesetzes- bzw. Bedeutungszusammenhang wird darauf abgestellt, in welchem gesetzlichen Zusammenhang eine Norm steht und ob sich daraus weiterführende Hinweise auf den Bedeutungsgehalt des verwendeten Begriffs ergeben. Der Rechtsanwender hat also eine Betrachtung des Gesetzesumfelds vorzunehmen, mithin auf den systematischen Kontext der Norm abzustellen.
Bsp.: Bezogen auf den Bienen-Fall des RG ist im Rahmen der systematischen Auslegung zu berücksichtigen, dass sich in den Vorschriften der §§ 961–964 ausführliche Regelungen über die Eigentumsverhältnisse an Bienenschwärmen finden. Allerdings lässt sich aus diesen Bestimmungen nichts zur Beantwortung der Frage entnehmen, ob es sich bei Bienen um Haustiere i. S. d. § 833 Satz 2 handelt.
Die Methode der systematischen Auslegung ist vor dem Hintergrund der Grund- und Zielvorstellung der „Einheit der Rechtsordnung“ zu sehen. Eine Vorschrift oder ein einzelnes in ihr enthaltenes Tatbestandsmerkmal soll idealerweise nicht im Widerspruch zu anderen Regelungen oder Gesetzen ausgelegt und angewendet werden.
74 Im Rahmen dieser Auslegungsmethode wird nach dem Willen des historischen Gesetzgebers und der Entstehungsgeschichte der Norm gefragt171, also gleichsam darauf abgestellt, welche Gedanken die Gesetzesverfasser bei Schaffung der Regelung angestellt haben. Heranzuziehen sind insoweit vor allem die Gesetzesbegründungen, die bei heutigen Gesetzen aus den Drucksachen des Bundestages (BT-Drucks.)172 und des Bundesrates (BR-Drucks.)173 entnommen werden können174. Bezogen auf das BGB geben zusätzlich zu den Reichstags-Drucksachen die Motive und Protokolle der Ersten und Zweiten Kommission Auskunft über Grund und Zielsetzung der jeweiligen Regelungen, soweit sie bereits zum 1.1.1900 in Kraft getreten sind175.
Bsp.: Im Bienen-Fall hat das RG auch die historische Auslegungsmethode herangezogen und festgestellt, dass im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens zur Änderung des § 833 nach Inkrafttreten des BGB „… Anträge, die Biene in der neuen Fassung des § 833 ausdrücklich zu erwähnen und als Haustier zu bezeichnen, abgelehnt worden“ sind176. Hiernach spricht die historische Auslegungsmethode dagegen, Bienen die Haustiereigenschaft i. S. d. § 833 Satz 2 zuzusprechen.
75 Die letztlich oftmals entscheidende Auslegungsmethode der teleologischen177 Auslegung fragt danach, welcher Sinn und Zweck178, welches Ziel mit einer Rechtsnorm verfolgt wird, also was erreicht oder vermieden werden soll179. Es ist davon auszugehen, dass das Gesetz eine zweckmäßige, vernünftige und gerechte Regelung treffen will180. Die heutige Zielvorstellung ist dabei zwar regelmäßig, aber nicht notwendig deckungsgleich mit dem, was der historische Gesetzgeber zum Zeitpunkt der Schaffung der Norm intendierte. Denn der Inhalt und Anwendungsbereich einer Norm bzw. eines in der Norm verwendeten Begriffs kann sich im Laufe der Zeit mit Änderung der gesellschaftlichen Wirklichkeit ebenfalls verändern.
Bsp.: Unter Heranziehung der teleologischen Auslegungsmethode ist im Bienen-Fall den Bienen die Eigenschaft als Haustier abzusprechen. Das folgt daraus, dass die in § 833 Satz 2 gegenüber der Gefährdungshaftung nach § 833 Satz 1 normierte Haftungsprivilegierung impliziert, dass ein Tierhalter sein Haustier beaufsichtigen kann unter Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt. Nur dann soll die Haftung des Tierhalters für durch das Haustier verursachte Schäden durch das zusätzliche Erfordernis des Verschuldens begrenzt werden. Im Hinblick darauf, dass Bienen bzw. Bienenschwärme außerhalb von Bienenstöcken nicht beaufsichtigt werden können, um einen Schadenseintritt zu vermeiden, spricht der Zweck von § 833 Satz 2 entscheidend dagegen, die Bienen als Haustiere i. S. dieser Vorschrift einzuordnen181.
b) Sonstige Prinzipien der Auslegung
76 Unter Berücksichtigung der insb. im Bereich des öffentlichen Rechts vorzunehmenden verfassungskonformen Auslegung182 ist im Hinblick auf den gebotenen Respekt vor der gesetzgebenden Gewalt (arg. Art. 100 Abs. 1 GG) im Zweifel demjenigen Ergebnis der Auslegung einer einfach-gesetzlichen Norm der Vorrang zu geben, das mit der Verfassung (GG) am weitesten im Einklang steht183.
Bsp.: § 14 Abs. 1 VersG ist mit Blick auf Art. 8 GG (Versammlungsfreiheit) verfassungskonform dahin auszulegen, dass Eilversammlungen anzumelden sind, sobald die Möglichkeit dazu besteht184.
Die verfassungskonforme Auslegung ist dabei nicht als „Methode“ der Auslegung185, sondern als „Vorzugsregel“ zu verstehen, die erst dann zum Einsatz kommt, wenn die Auslegung anhand der klassischen Methoden zu mehreren gleichrangigen Ergebnissen geführt hat. Sie findet ihre Grenzen dort, wo sie zu dem Wortlaut und dem klar erkennbaren Willen des Gesetzgebers in Widerspruch treten würde186. Der Richter darf einem nach Wortlaut und Sinn eindeutigen Gesetz nicht durch „verfassungskonforme“ Auslegung einen entgegengesetzten Sinn geben187.
77 Die zunehmend an Bedeutung gewinnende Methode der unionsrechtskonformen Auslegung versucht, im Rahmen der Auslegung nationaler Vorschriften Widersprüche zum gesamten europäischen Unionsrecht (früher: Gemeinschaftsrecht) – entweder dem sog. Primärrecht (insb. EUV, AEUV) oder dem Sekundärrecht (insb. Richtlinien, Verordnungen)188 – zu vermeiden189. Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Tätigkeit der Union die Angleichung („Harmonisierung“) der innerstaatlichen Rechtsvorschriften umfasst, soweit dies für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes (sog. Binnenmarkt) erforderlich ist190. Von der unionsrechtskonformen Auslegung im Hinblick auf ihren Prüfungsmaßstab zu unterscheiden ist die Auslegungsmethode der richtlinienkonformen Auslegung191, nach welcher demjenigen Ergebnis der Auslegung nationaler (Umsetzungs-)Vorschriften der Vorzug zu geben ist, das mit der jeweiligen Richtlinie (Art. 288 Abs. 3 AEUV), auf der die Vorschrift beruht, am meisten übereinstimmt192. Die vorgenannten Auslegungsmethoden dienen der Umsetzung des europarechtlichen Grundsatzes des sog. effet utile, also des Erfordernisses der Gewährleistung und Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts mit der größtmöglichen praktischen Wirksamkeit193.
V.Besondere Methoden der Rechtsanwendung
78 Es gibt eine Vielzahl von Formen juristischer Argumentation194. Jedenfalls die nachfolgend vorgestellten Formen sollten zum Standardrepertoire eines Juristen gehören. Die Entscheidung für ein bestimmtes Argumentationsmuster legt regelmäßig bereits das Ergebnis fest, etwa im Rahmen der Auslegung195.
1.Analogieschluss
79 Der Analogieschluss (argumentum per analogiam) – auch genannt Ähnlichkeitsargument oder schlicht Analogie – ist der Schluss von einem gesetzlich geregelten auf einen gleichgelagerten, rechtsähnlichen, aber gesetzlich nicht geregelten Fall196. Er ist nur zulässig, wenn kumulativ zwei Voraussetzungen erfüllt sind. Erforderlich ist zunächst eine planwidrige, d. h. vom Gesetzgeber nicht erkannte oder beabsichtigte Regelungslücke197, des Weiteren die wertungsmäßige Vergleichbarkeit der Interessenlagen198.
Bsp.: Beeinträchtigungen, die von einer Mietwohnung innerhalb desselben Grundstückseigentums auf eine andere Mietwohnung einwirken, berechtigen den Mieter der von den Beeinträchtigungen betroffenen Wohnung sowohl mangels planwidriger Regelungslücke als auch im Hinblick auf die fehlende Vergleichbarkeit der Interessenlagen nicht zu einem verschuldensunabhängigen nachbarrechtlichen Ausgleichsanspruch analog § 906 Abs. 2 Satz 2 gegen den Mieter der anderen Wohnung199.
Liegt eine Regelungslücke vor, so kann diese dann nicht als Grundlage einer Analogie dienen, wenn dem Gesetzeszusammenhang und dem Wortlaut ein „beredtes Schweigen“ des Gesetzgebers zu entnehmen ist, also das planmäßige, gewollte Offenlassen der Gesetzeslücke200.
Bsp.: Die Vorschrift des § 56 HGB, nach der der Ladenangestellte zu den in einem derartigen Laden gewöhnlich erfolgenden Verkäufen als ermächtigt gilt, ist auf Ankäufe auch nicht entsprechend anwendbar201.
Der Frage nach der Zulässigkeit eines Analogieschlusses hat regelmäßig die Gesetzesauslegung voranzugehen, da erst danach Klarheit über das Vorliegen einer planwidrigen gesetzgeberischen Regelungslücke sowie über den begrifflichen Inhalt der analog anzuwendenden Vorschrift herrscht202. Der Analogieschluss ist im Zivilrecht von Verfassungs wegen grds. nicht zu beanstanden203. Im Strafrecht steht das Analogieverbot zulasten des Täters nach Art. 103 Abs. 2 GG entgegen204. Den Grundsatz „Keine Strafe ohne Gesetz“ (nulla poena sine lege) gibt § 1 StGB auf einfachgesetzlicher Ebene wieder.
2.Umkehrschluss
80 Als Umkehrschluss (argumentum e contrario) wird der Schluss von einem gesetzlich geregelten auf einen nicht geregelten Fall bezeichnet205. Analogie und Umkehrschluss stehen in einem Spannungsverhältnis, sie konkurrieren miteinander206.
Bsp.: Nach § 7 Abs. 2 kann eine natürliche Person den Wohnsitz an mehreren Orten haben. Für Vereine bestimmt § 24, dass, wenn nicht ein anderes bestimmt ist, als Sitz der Ort gilt, an welchem die Verwaltung geführt wird. § 24 sagt nichts darüber, ob ein Verein einen Doppelsitz (Zweitsitz) haben kann. Kann nun § 7 Abs. 2 auf den Verein analog angewendet werden? Oder ist vielmehr – mit der wohl h. M.207 – der Umkehrschluss aus § 24 dahingehend geboten, dass ein Verein nur einen Sitz haben kann?
3.Erst-recht-Schluss
81 Der Erst-recht-Schluss (argumentum a fortiori) ist der „Schluss vom Stärkeren her“. Dieser Oberbegriff umfasst zwei Formen, den „Schluss vom Größeren zum Geringeren“ (argumentum a maiori ad minus)208 und den „Schluss vom Kleineren zum Größeren“ (argumentum a minori ad maius).
Bsp.: Ist für rechtmäßige Enteignungen eine Entschädigung zu zahlen (Art. 14 Abs. 3 S. 2 GG), so ist dies erst recht bei rechtswidrigen, sog. enteignungsgleichen Eingriffen geboten209.
4.Teleologische Reduktion
82 Im Wege der teleologischen210 Reduktion wird im Hinblick auf den Sinn und Zweck einer Vorschrift deren Anwendungsbereich entgegen dem Wortlaut eingeschränkt. Es wird die Anwendbarkeit der Norm verneint, obwohl sie ihrem Wortlaut nach einschlägig wäre. Die teleologische Reduktion von Vorschriften gehört zu den anerkannten, verfassungsrechtlich nicht zu beanstandenden Auslegungsgrundsätzen211.
Bsp.: Das bei der Stellvertretung bedeutsame „Geschäft für den, den es angeht“212 ist ein durch teleologische Reduktion des Offenkundigkeitsprinzips (§ 164 Abs. 2)213 entwickeltes Rechtsinstitut bei Bargeschäften des täglichen Lebens, und zwar vor allem beim dinglichen Rechtserwerb214.
2. Teil: Subjekte, subjektive Rechte und Rechtsobjekte
§ 4Subjekte: Natürliche und juristische Personen
Literatur:
Dreier, Stufungen des vorgeburtlichen Lebensschutzes, ZRP 2002, 377; Götting, Sanktionen bei Verletzungen des postmortalen Persönlichkeitsrechts, GRUR 2004, 801; Hattenhauer, „Person“ – Zur Geschichte eines Begriffs, JuS 1982, 405; Hetterich, Mensch und „Person“ – Probleme einer allgemeinen Rechtsfähigkeit, 2016; Heyers, Wann ist der Mensch tot?, Juristische Ausbildung 2016, 709 ff.; Kellermann, Die BGB-Gesellschaft in ihrer Ausgestaltung durch die neuere Rechtsprechung, JA 2003, 640; Krumm, Die Stiftung bürgerlichen Rechts, JA 2010, 849; Obergfell, Tiere als Mitgeschöpfe im Zivilrecht, RW 2016, 388 ff.; Petersen, Die rechtsfähige Personengesellschaft, JURA 2004, 683; K. Schmidt, Die BGB-Außengesellschaft: rechts- und parteifähig – Besprechung des Grundlagenurteils II ZR 331/00 vom 29.1.2001, NJW 2001, 993; Schwab, Personenname und Recht, Das Standesamt 2015, 354 ff.; Staudinger/Melestean, Das Persönlichkeitsrecht im Zivilrecht – zugleich Anmerkung zu BGH, Urteil vom 29.4.2014, Az. VI ZR 246/12; Wellenhofer, Grundstücksgeschäfte mit der BGB-Gesellschaft, JuS 2010, 1048; Stöber/Otto, Handbuch zum Vereinsrecht, 11. Aufl. 2016.
Rechtsprechung:
BVerfGE 50, 290 – Mitbestimmungs-Urteil (Gewerkschaften, Koalitionsfreiheit, juristische Personen, Sozialbindung des Eigentums u. a.; Art. 2 Abs. 1, 9 Abs. 1, Abs. 3, 12 Abs. 1, 14 Abs. 1 GG); BGHZ 149, 191 – shell.de (Ansprüche bei Verwendung einer berühmten Marke als Internet-Domain durch einen gleichnamigen Nichtberechtigten; §§ 14 f. MarkenG, § 12); BGHZ 146, 341 – ARGE Weißes Ross I (Rechtsfähigkeit der Außen-GbR, Parteifähigkeit im Zivilprozess, akzessorische Haftung der Gesellschafter; §§ 14 Abs. 2, 705, § 50 Abs. 1 ZPO, § 128 HGB); BGHZ 109, 327 (Arglistiges Verschweigen eines Mangels der Kaufsache, Wissenszurechnung eines Organvertreters; §§ 31, 89 Abs. 1, § 463 Satz 2 a. F.); BGHZ 70, 313 (Ehegatten-Stiftung durch Erbvertrag; Art. 3 GG, §§ 80 ff. BGB); BGHZ 50, 133 – Mephisto (Persönlichkeitsschutz Verstorbener; Art. 1, 2, 5 GG, §§ 823, 1004 BGB); BGHZ 29, 33 (Ärztlicher Heileingriff als tatbestandliche Körperverletzung, Einwilligung des Minderjährigen in eine Operation; §§ 107, 823 Abs. 1, 1626); BGHZ 8, 243 (Luesinfektion einer Schwangeren, kausale Gesundheitsverletzung des Kindes, Verschuldens-Zurechnung; §§ 31, 823 Abs. 1, 831); BGH LM Nr. 11 zu § 31 BGB (Idealverein, Haftung für nicht rechtsfähigen Verein, Handelndenhaftung; §§ 31, 54 Satz 2, 276, 831); BVerwGE 71, 309 (Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, Wohnsitz, Begründung und Aufhebung, Doppel- bzw. Zweitwohnsitz; § 7 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3); OLG Frankfurt a. M. NJW 1997, 3099 (Eintritt des Erbfalls im Zeitpunkt des Hirntods, Erbrecht, §§ 1, 1371 Abs. 1, 1922, 1931, 1933).
I.Begriff des Rechtssubjekts
83 Bei dem im BGB nicht definierten Begriff des Rechtssubjekts bzw. der Rechtssubjekte handelt es sich um die Adressaten der Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches, d. h. diejenigen, die Rechte und Verpflichtungen haben können. Bei den Rechten kann es sich z. B. um den Anspruch auf Kaufpreiszahlung (§ 433 Abs. 2) oder den Anspruch des Arbeitnehmers auf Gewährung der vereinbarten Vergütung (§ 611 Abs. 1) handeln. Zu den Verpflichtungen gehören etwa die Verpflichtung des Käufers zur Kaufpreiszahlung (§ 433 Abs. 2), die Verpflichtung zur Leistung von Schadensersatz (§ 823 Abs. 1) oder etwa auch die Verpflichtung zur Unterhaltsgewährung zwischen Verwandten in gerader Linie (§ 1601). Rechtssubjekte sind danach Träger von Rechten und Pflichten. Diese Fähigkeit wird als Rechtsfähigkeit bezeichnet215. Nach dem Gesetz kommt die Rechtsfähigkeit und damit die Eigenschaft, Rechtssubjekt sein zu können, nur Personen zu, nicht hingegen Sachen, Tieren oder anderen Rechtsobjekten216.
Bsp.: Ein Tier kann nicht testamentarisch als Erbe eingesetzt werden, weil es mangels Rechtsfähigkeit nicht Träger eines Erbrechts sein kann.
Das BGB unterscheidet zwei Arten von Personen, und zwar die natürlichen Personen (§§ 1 ff.)217 und die juristischen Personen (§§ 21 ff.)218.
II.Natürliche Personen
1.Beginn und Ende der Rechtsfähigkeit
84 Natürliche Personen i. S. d. BGB sind, wie die Vorschriften der §§ 1 ff. deutlich machen, die Menschen. Rechtsfähigkeit erlangt jeder Mensch, eine Unterscheidung nach irgendwelchen Merkmalen wie z. B. Herkunft, Rasse, Geschlecht oder Religion ist dem BGB fremd und wäre auch verfassungsrechtlich wegen Verstoßes gegen die durch Art. 1 GG geschützte Menschenwürde unzulässig.
85 Gemäß der Regelung des § 1 beginnt die Rechtsfähigkeit des Menschen mit der Vollendung der Geburt219. Die Geburt ist mit dem vollständigen Austritt aus dem Mutterleib vollendet, ohne dass es darauf ankommt, ob die Nabelschnur durchtrennt ist oder nicht220. Lebt das Kind in diesem Moment, so hat es Rechtsfähigkeit erlangt, auch wenn es kurz darauf verstirbt221.
86 Im BGB nicht ausdrücklich geregelt ist das Ende der Rechtsfähigkeit. Im Hinblick darauf, dass der natürlichen Person Rechtsfähigkeit aufgrund ihrer Existenz als solchen zukommt, kann das Ende der Rechtsfähigkeit nur durch Tod222 eintreten223. Als maßgebender Zeitpunkt für den Eintritt des Todes wird heute nach allgemeiner Auffassung der sog. Gesamthirntod angesehen224, hingegen nicht der Herz- und Kreislaufstillstand225. Unter dem Gesamthirntod wird der vollständige und irreversible Zusammenbruch der Gesamtfunktion des Gehirns verstanden, mögen Kreislauf und Atmung auch noch künstlich aufrechterhalten werden können226.
87 Der genaue Todeszeitpunkt ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil mit dem Tod einer Person rechtlich erhebliche Folgen verbunden sind. So tritt mit dem Tod gemäß § 1922 Abs. 1 die sog. Gesamtrechtsnachfolge ein, d. h., mit dem Tod einer Person (Erbfall) geht deren Vermögen als Ganzes auf eine oder mehrere Personen über. Der Erbe oder die Erben treten also im Todeszeitpunkt kraft gesetzlicher Anordnung in die gesamte Rechtsstellung des Verstorbenen (Erblassers) ein. Rechtliche Relevanz hat der Todeszeitpunkt z. B. auch im Rahmen des Transplantationsgesetzes für die Zulässigkeit der Organentnahme227. Des Weiteren haben der Tod und der Todeszeitpunkt Bedeutung für die nach § 1353 Abs. 1 Satz 1 auf Lebenszeit geschlossene Ehe, die dadurch aufgelöst wird.
88 Die Feststellung des Todes und damit des Todeszeitpunkts ist nicht möglich, wenn ungewiss ist, ob eine Person noch lebt oder nicht.
Bsp.: Infolge der Tsunami-Katastrophe in Südostasien im Dezember 2004 werden auch viele deutsche Staatsangehörige vermisst.
In diesen Fällen kann wegen der erheblichen rechtlichen Folgen des Todes und der damit unvereinbaren Ungewissheit über den Eintritt desselben auf der Grundlage des Verschollenheitsgesetzes eine verschollene Person228 durch gerichtlichen Beschluss für tot erklärt werden. Aufgrund der Todeserklärung wird widerlegbar vermutet, dass der Verschollene zu dem in dem Beschluss festgestellten Zeitpunkt gestorben ist229. Die Todeserklärung hat bis zur Widerlegung der Vermutung dieselben rechtlichen Folgen, die im Falle des (feststehenden) tatsächlichen Todes einer Person eintreten, also z. B. erbrechtlich die Gesamtrechtsnachfolge (§ 1922 Abs. 1) oder eherechtlich das Ende der Ehe230.
89 Auch wenn die Rechtsfähigkeit des Menschen mit seinem Tod erlischt, der Verstorbene mithin nicht mehr Träger von Rechten und Pflichten sein kann, so ist anerkannt, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht, d. h. das Recht des Einzelnen gegenüber jedem auf Achtung seiner Menschenwürde und Entfaltung seiner individuellen Persönlichkeit231, und auch besondere Ausprägungen dieses Rechts wie etwa das Recht am eigenen Bild gemäß §§ 22 ff. KunstUrhG über den Tod des ursprünglichen Rechtsträgers hinaus fortwirken232. Der insb. verfassungsrechtlich durch Art. 1 und Art. 2 GG begründete Schutz der Persönlichkeit des Menschen zu Lebzeiten233 wäre unvollständig, wenn das Persönlichkeitsrecht im obigen Sinne mit dem Tode in vollem Umfang wegfallen würde. Deshalb besteht der allgemeine Wert- und Achtungsanspruch weiter, so dass das über den Tod hinaus fortwirkende Lebensbild eines Verstorbenen jedenfalls gegen schwerwiegende Entstellungen geschützt wird234. Die Eigenschaft des Persönlichkeitsrechts als eines höchstpersönlichen und damit unübertragbaren und unvererblichen Rechts steht dessen Fortwirkung aus Schutzgründen nicht entgegen235. Unter Anlehnung an spezielle gesetzliche Regelungen wie etwa § 22 KunstUrhG ist anerkannt, dass zumindest nahe Angehörige236 den Schutz des fortwirkenden Persönlichkeitsrechts insb. durch die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen gegen Beeinträchtigungen wahrnehmen können237.
Bsp.: In einem Roman wird die Hauptfigur, die das Publikum an einen im Dritten Reich erfolgreichen Schauspieler und Intendanten erinnert, sehr negativ gezeichnet. Nach dem Tod des Schauspielers will dessen Adoptivsohn das Erscheinen bzw. die Verbreitung des Buchs verhindern (BGHZ 50, 133 ff., Mephisto-Fall).