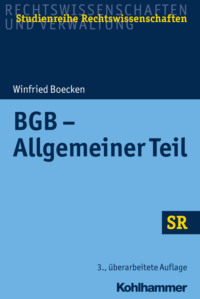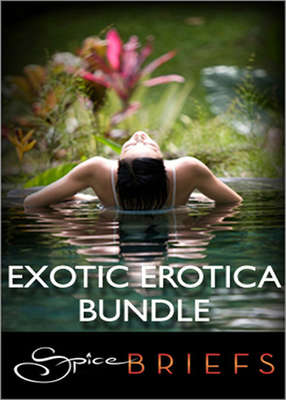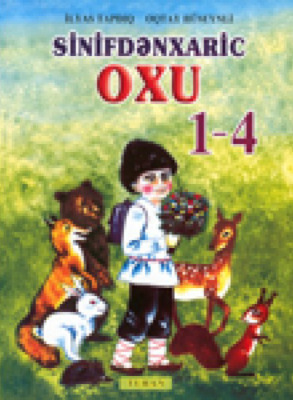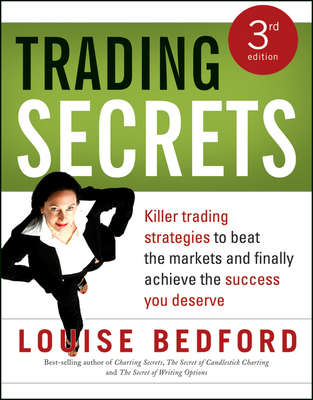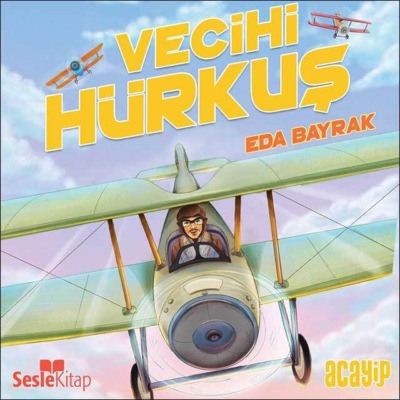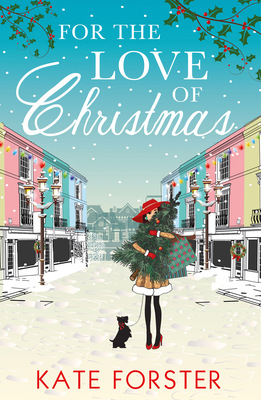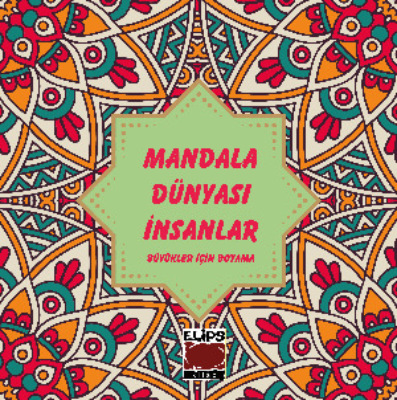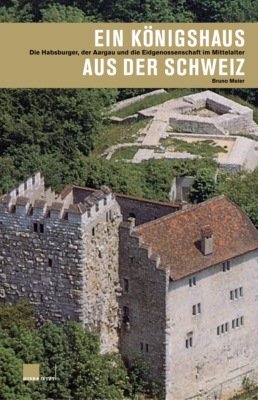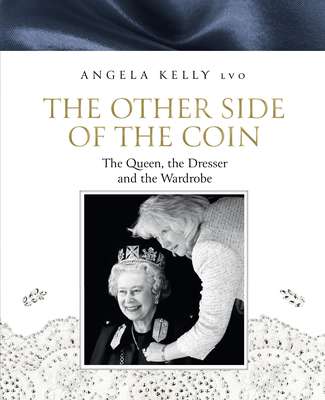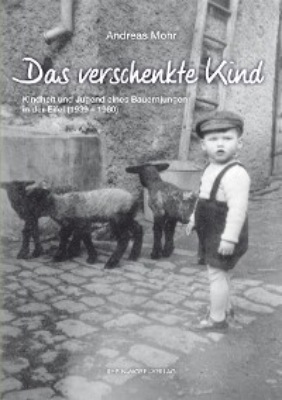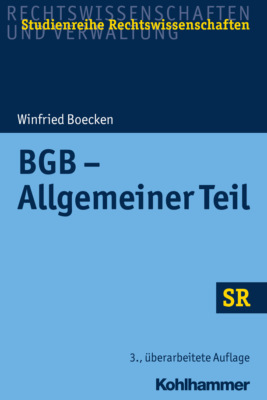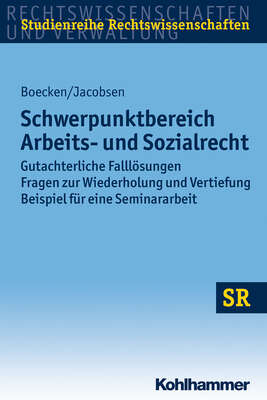Kitabı oku: «BGB – Allgemeiner Teil», sayfa 6
2.Rechtsstellung des werdenden Menschen – nasciturus
90 Die Anknüpfung der Rechtsfähigkeit an die Vollendung der Geburt hat zur Folge, dass der nasciturus, also das gezeugte, aber noch nicht geborene Kind, als solcher keine Rechtsfähigkeit besitzt, mithin nicht Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Gleichwohl wird der nasciturus über den strafrechtlichen Schutz238 hinaus bürgerlich-rechtlich in Einzelfällen durch besondere Vorschriften wie eine rechtsfähige Person behandelt.
91 So hat im Falle der Tötung einer aufgrund Gesetzes zum Unterhalt verpflichteten Person mit der Folge, dass dem Unterhaltsberechtigten der Anspruch auf Unterhalt entzogen wird, dieser gegen den Schädiger nach § 844 Abs. 2 Satz 1 einen Anspruch auf Schadensersatz wegen entgangenen Unterhalts. Dieses Recht auf Schadensersatz setzt allerdings genauso wie das weggefallene Recht auf Unterhalt grds. voraus, dass der Berechtigte im Zeitpunkt der Tötung des Unterhaltsverpflichteten bereits gelebt hat. Denn nur dann kann er rechtsfähig, mithin Träger von Rechten – hier Ansprüche auf Unterhalt bzw. Schadensersatz – sein. Der nasciturus hätte deshalb im Falle der Tötung des Vaters vor der Geburt keinen Schadensersatzanspruch wegen der Entziehung des nach der Geburt an sich gegebenen Anspruchs auf Unterhalt. Hier hilft die Regelung des § 844 Abs. 2 Satz 2: Danach tritt die Ersatzpflicht auch dann ein, wenn der Dritte zur Zeit der Verletzung gezeugt, aber noch nicht geboren war. Diese Vorschrift zielt auf die finanzielle Absicherung des Kindes, das bereits vor seiner Geburt den Vater verliert.
Bsp.: V, dessen Ehefrau F im vierten Monat schwanger ist, wird durch Verschulden des S bei einem Verkehrsunfall getötet. Das später lebend geborene Kind K hat wegen entgangenen Unterhalts gemäß § 844 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Satz 2 einen eigenen Schadensersatzanspruch gegen S, obwohl es im Zeitpunkt der Tötung noch nicht geboren war.
92 Eine weitere bedeutsame Vorschrift zum Schutz des nasciturus findet sich im Erbrecht. In Übereinstimmung mit der Anknüpfung der Rechtsfähigkeit an die Vollendung der Geburt (§ 1) bestimmt die Regelung des § 1923 Abs. 1, dass nur derjenige Erbe werden kann, der zur Zeit des Erbfalls lebt (sog. Erbfähigkeit). Verstirbt der Erblasser vor der Geburt seines Kindes, so könnte das Kind, auch wenn es später lebend geboren wird, wegen der im Zeitpunkt des Todes fehlenden Rechts- und Erbfähigkeit nicht Erbe sein. Zum Schutze des nasciturus erweitert das Gesetz in § 1923 Abs. 2 die Erbfähigkeit durch eine Fiktion239. Wer zur Zeit des Erbfalls noch nicht lebte, aber bereits gezeugt war, gilt als vor dem Erbfall geboren. Wird der nasciturus später lebend geboren, so wirkt sich die Fiktion des § 1923 Abs. 2 dahin aus, dass er Erbe sein kann, obwohl er im Zeitpunkt des Todes noch nicht geboren war und deshalb auch noch keine Rechtsfähigkeit erlangt hatte.
Bsp.: Der 31-jährige E verstirbt infolge eines Autounfalls. Er hat keine Verwandten, die einzige persönliche Beziehung bestand zu seiner Lebensgefährtin L, die im Zeitpunkt seines Todes ein Kind von ihm erwartete. Kommt das Kind lebend zur Welt, so wird es gemäß §§ 1922 Abs. 1, 1923 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 und § 1924 Abs. 1 Alleinerbe des E.
93 Schließlich ist der unter dem Gesichtspunkt der Rechtsfähigkeit unproblematische Fall hervorzuheben, dass ein nasciturus z. B. infolge eines durch einen Dritten herbeigeführten Unfalls verletzt und später mit einem Gesundheitsschaden geboren wird240. Der Schadensersatzanspruch aus § 823 Abs. 1 setzt u. a. die Verletzung des Körpers oder der Gesundheit eines anderen voraus, d. h., einer Person, also eines Trägers von Rechten und Pflichten241. Die Rechtsfähigkeit beginnt jedoch erst mit der Vollendung der Geburt. Allerdings ist zu beachten, dass der nasciturus und das später lebend geborene Kind identische Wesen sind, so dass sich Verletzungen der Leibesfrucht mit der Folge einer dauernden Schädigung nach der Geburt als Körper- bzw. Gesundheitsverletzung des Menschen darstellen242. Aus diesem Grunde ist die Tatsache, dass die Verletzung vorgeburtlich zugefügt wurde, kein Hinderungsgrund für die Anwendung des § 823 Abs. 1: Die Körper- bzw. Gesundheitsverletzung vermittelt sich auch am geborenen Menschen, der deshalb bei Vorliegen der maßgebenden Voraussetzungen wegen der vorgeburtlichen Schädigung Ansprüche auf Schadensersatz gemäß § 823 Abs. 1 haben kann.
Bsp.: S verursacht schuldhaft einen Unfall, bei dem die M schwer verletzt wird und u. a. eine Gehirnerschütterung erleidet, die dazu führt, dass M für mehrere Stunden das Bewusstsein verliert. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die M schwanger. Als das Kind geboren wird, stellt sich heraus, dass es aufgrund des Unfalls einen Gehirnschaden erlitten hat, der spastische Lähmungen verursacht243. Trotz der vorgeburtlich eingetretenen Körper- bzw. Gesundheitsverletzung hat das Kind gegen S eigene Ansprüche auf materiellen Schadensersatz aus § 823 Abs. 1 und auf immateriellen Schadensersatz (Schmerzensgeld) aus § 253 Abs. 2.
3.Unterscheidung zwischen Rechtsfähigkeit und Handlungsfähigkeit
94 Die Erlangung der Rechtsfähigkeit mit der Vollendung der Geburt bedeutet nicht, dass der Mensch ab diesem Zeitpunkt auch rechtlich wirksam handeln, z. B. Verträge abschließen oder für angerichtete Schäden verantwortlich gemacht werden kann. Insoweit ist über die Rechtsfähigkeit hinaus die sog. Handlungsfähigkeit erforderlich. Darunter wird die Fähigkeit, rechtlich wirksam handeln zu können, verstanden244. Zur Handlungsfähigkeit gehören insb. die Geschäftsfähigkeit und die Deliktsfähigkeit245.
95 Unter dem Begriff der Geschäftsfähigkeit ist die Fähigkeit einer Person zu verstehen, im Rechtsverkehr selbständig auftreten und rechtsverbindliche Erklärungen abgeben und empfangen zu können, sprich durch eigenes Handeln wirksam Rechtsgeschäfte vorzunehmen246. Das BGB unterscheidet zwischen geschäftsunfähigen Personen, beschränkt geschäftsfähigen Personen und geschäftsfähigen Personen247. Geschäftsunfähig sind nach § 104 Personen, die noch nicht das siebente Lebensjahr vollendet haben, und solche, die sich in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit befinden, sofern der Zustand seiner Natur nach nicht ein vorübergehender ist248. Beschränkt geschäftsfähig sind gemäß § 106 Minderjährige, die das siebente Lebensjahr, aber noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben. Unbeschränkt geschäftsfähig sind Personen mit Eintritt der Volljährigkeit, d. h. mit Vollendung des 18. Lebensjahrs249. Der Eintritt der Volljährigkeit hat bürgerlich-rechtlich große Bedeutung. Neben der Erlangung der unbeschränkten Geschäftsfähigkeit ist das Erreichen der Volljährigkeit z. B. Anknüpfungspunkt für das Ende der elterlichen Sorge (§ 1626 Abs. 1) oder auch für den Eintritt der Ehemündigkeit (§ 1303 Abs. 1).
96 Deliktsfähigkeit meint die Fähigkeit, für schadenstiftende Ereignisse durch unerlaubte Handlungen (§§ 823 ff.) verantwortlich gemacht werden zu können250. Das Gesetz regelt in § 827 und § 828, wann Deliktsfähigkeit nicht gegeben ist. Über die Verweisung in § 276 Abs. 1 Satz 2 gelten diese Regelungen auch außerhalb des Deliktsrechts im Rahmen sonstiger, insb. vertraglich begründeter Schuldverhältnisse, wenn es um die Verantwortlichkeit des Schuldners für zugefügte Schäden geht.
Nach § 827 Satz 1 ist derjenige nicht deliktsfähig, der im Zustand der Bewusstlosigkeit oder in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit einem anderen einen Schaden zufügt. Das Gesetz knüpft also hier für die Deliktsunfähigkeit an einen bestimmten Zustand einer Person an251. Sofern der Zustand der Bewusstlosigkeit oder der Ausschluss der freien Willensbestimmung durch geistige Getränke oder ähnliche Mittel herbeigeführt wurde, ordnet das Gesetz in § 827 Satz 2 eine Fahrlässigkeitshaftung an, die nur dann ausgeschlossen ist, wenn der Täter ohne Verschulden in den Zustand der Unzurechnungsfähigkeit geraten ist (§ 827 Satz 2 Halbsatz 2). Der innere Grund für die Fahrlässigkeitshaftung nach § 827 Satz 2 liegt darin, dass sich der Schädiger in den Zustand versetzt hat.
§ 828 regelt die Deliktsfähigkeit minderjähriger Personen. Gemäß § 828 Abs. 1 sind Personen, die das siebente Lebensjahr noch nicht vollendet haben, für den einem anderen zugefügten Schaden nicht verantwortlich. Nach Vollendung des siebenten bis zur Vollendung des zehnten Lebensjahres haften Kinder nicht für Schäden, die bei einem Unfall mit einem Kraftfahrzeug, einer Schienenbahn oder einer Schwebebahn einem anderen zugefügt werden, es sei denn, die Schadenszufügung erfolgte vorsätzlich (§ 828 Abs. 2). Mit diesem, erst 2002 eingeführten Haftungsprivileg soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass Kinder i. d. R. erst ab Vollendung des 10. Lebensjahres im Stande sind, die besonderen Gefahren des motorisierten Straßenverkehrs zu erkennen, insb. Entfernungen und Geschwindigkeiten richtig einzuschätzen, und sich den Gefahren entsprechend zu verhalten252. Dieses Haftungsprivileg greift deshalb nur ein, wenn sich in einem Schadensfall die typische Überforderungssituation des Kinds aufgrund der spezifischen Gefahren des motorisierten Verkehrs realisiert253.
Bsp.: Der neunjährige M veranstaltet mit seinem Zwillingsbruder auf der Fahrbahn einer Straße ein Wettrennen mit Kickboards. Obgleich M im Umgang mit einem Kickboard geübt ist, stürzt er. Das Kickboard prallt gegen einen ordnungsgemäß am rechten Straßenrand geparkten Pkw und beschädigt diesen. – Hier kann das Haftungsprivileg des § 828 Abs. 2 nicht eingreifen, weil sich bei der Schadenszufügung nicht die besonderen Gefahren des motorisierten Verkehrs verwirklicht haben254.
Die Vorschrift des § 828 Abs. 3 regelt die beschränkte Deliktsfähigkeit. Danach ist derjenige, der das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und dessen Verantwortlichkeit nicht nach § 828 Abs. 1 oder Abs. 2 ausgeschlossen ist, dann für einen Schaden nicht verantwortlich, wenn er bei der Begehung der schädigenden Handlung nicht die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hat. Für die Frage, ob diese Einsicht gegeben ist, wird allein auf die intellektuelle Fähigkeit, die Gefährlichkeit eines Tuns zu erkennen, abgestellt255. Irrelevant ist hingegen, ob der Minderjährige auch die Fähigkeit hat, sich dieser Einsicht gemäß zu verhalten, sprich, sein Verhalten entsprechend seiner intellektuellen Einsichtsfähigkeit zu steuern256.
97 Über die Geschäftsfähigkeit und die Deliktsfähigkeit hinaus kennt das BGB weitere Fälle, in denen die Rechtsfähigkeit nicht ausreicht, um rechtlich wirksam handeln zu können. Neben der schon erwähnten Ehefähigkeit257 sei auf die Testierfähigkeit hingewiesen. Nach § 2229 Abs. 1 kann ein Minderjähriger ein Testament erst errichten, wenn er das 16. Lebensjahr vollendet hat. Personen, die wegen krankhafter Störung der Geistestätigkeit, wegen Geistesschwäche oder wegen Bewusstseinsstörungen nicht mehr in der Lage sind, die Bedeutung einer von ihnen abgegebenen Willenserklärung einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln, können nach § 2229 Abs. 4 ein Testament nicht errichten.
98 Im Zusammenhang mit der Unterscheidung zwischen Rechtsfähigkeit und Handlungsfähigkeit spielt, bezogen auf den Bereich ärztlicher Heileingriffe, die Einwilligungsfähigkeit des Patienten eine Rolle. Ärztliche Heileingriffe stellen nur dann keine rechtswidrige Körperverletzung i. S. d. § 823 Abs. 1 dar, wenn der Patient wirksam in die Behandlung eingewilligt hat258. Eine wirksame Einwilligung setzt Einwilligungsfähigkeit voraus, d. h., dass der Einwilligende seiner geistigen Veranlagung und Entwicklung sowie seiner sittlichen Reife nach fähig war, die Erheblichkeit und möglichen Folgen des Eingriffs zu beurteilen259.
4.Wohnsitz und Name der natürlichen Person
99 Die Vorschriften des BGB über natürliche Personen (§§ 1 ff.) enthalten in den §§ 7–11 Regelungen über den Wohnsitz und in § 12 eine Bestimmung über das Namensrecht. Sowohl der Wohnsitz wie auch der Name eines Menschen haben (u. a.) die Funktion, den Menschen im Rechtsverkehr zu individualisieren260, d. h., unterscheidbar und identifizierbar zu machen. Von daher sind die Regelungen über den Wohnsitz und das Namensrecht systematisch zutreffend den bürgerlich-rechtlichen Vorschriften über die natürlichen Personen zugeordnet.
a) Wohnsitz
100 Der Wohnsitz stellt neben anderen Merkmalen ein bedeutsames Individualisierungskriterium des Menschen dar. So fällt insb. die Unterscheidung zwischen mehreren Personen mit Namensidentität leichter, wenn sie nach ihrem jeweiligen Wohnsitz zugeordnet werden können. Neben dieser tatsächlichen Bedeutung erlangt der Wohnsitz durch eine Vielzahl gesetzlicher Regelungen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen an den Wohnsitz anknüpfen, rechtliche Relevanz. So bestimmt z. B. § 132 Abs. 2 Satz 2 für die öffentliche Zustellung einer Willenserklärung das Amtsgericht für zuständig, in dessen Bezirk der Erklärende seinen Wohnsitz hat. Des Weiteren ist auf § 269 Abs. 1 hinzuweisen, wonach Leistungsort der Wohnsitz des Schuldners zur Zeit der Entstehung des Schuldverhältnisses ist, sofern über den Leistungsort keine Parteivereinbarung getroffen worden ist und sich dieser auch nicht aus der Natur des Schuldverhältnisses ergibt. Außerhalb des BGB wird z. B. in §§ 12, 13 ZPO zur Bestimmung des allgemeinen Gerichtsstands, das ist das Gericht, das für alle gegen eine Person zu erhebenden Klagen vorbehaltlich von Sonderregelungen zuständig ist, an den Wohnsitz angeknüpft.
Gemäß § 7 Abs. 1 wird der Wohnsitz eines Menschen261 dadurch begründet, dass er sich an einem Ort ständig niederlässt (gewillkürte Wohnsitzbegründung). Wohnsitz ist der räumliche Mittelpunkt der Lebensbeziehungen, wobei nicht die Wohnung als solche, sondern der Ort, in welcher eine Wohnung liegt, gemeint ist262. Die Begründung des Wohnsitzes erfolgt durch einen Willensakt, indem sich eine Person kraft eigener Entscheidung an einem Ort – wie § 7 Abs. 1 formuliert – ständig niederlässt, d. h., den Willen hat, den Schwerpunkt der Lebensverhältnisse dort dauernd beizubehalten263. Dieser Willensakt stellt keine Willenserklärung im Rechtssinne dar, weil er nicht auf die Herbeiführung einer Rechtsfolge gerichtet ist264, sondern auf die Schaffung einer tatsächlichen Situation, an welche dann das Gesetz Rechtsfolgen knüpft265. Von dem Begriff des Wohnsitzes zu unterscheiden ist der Aufenthaltsort. Hierunter versteht man den Ort, der von einer Person nur im Hinblick auf einen eng begrenzten Teil ihrer gesamten Lebensverhältnisse genommen wird266.
Bsp.: Ein Montagearbeiter, der mit seiner Familie in Stuttgart wohnt und für mehrere Monate auf einer Baustelle in Berlin arbeitet, hat dort seinen Aufenthaltsort, der Wohnsitz bleibt jedoch Stuttgart.
Nach § 7 Abs. 2 kann der Wohnsitz gleichzeitig an mehreren Orten bestehen. Das ist allerdings nur der Fall, wenn der Schwerpunkt der Lebensverhältnisse etwa gleichmäßig auf die jeweiligen Orte verteilt ist, wobei der Aufenthalt auch zwischen den Orten wechseln kann, wenn nur von jedem Ort aus die gesamten Lebensverhältnisse schwerpunktmäßig bestimmt werden267. Der gewillkürte Wohnsitz kann nach § 7 Abs. 3 aufgehoben werden, wenn die Niederlassung mit dem Willen beendet wird, sie aufzugeben. Hierfür ist neben der tatsächlichen Aufgabe der Willensakt erforderlich, den Ort nicht mehr als Schwerpunkt der Lebensverhältnisse beizubehalten268. Der Aufgabewille ist aus den konkreten Umständen zu ermitteln und kann häufig aus der Tatsache hergeleitet werden, dass die bisherige Niederlassung für lange Dauer verlassen und ein neuer Wohnsitz begründet worden ist269. Obwohl es sich bei der gewillkürten Wohnsitzbegründung oder -aufhebung nicht um Willenserklärungen handelt, können Geschäftsunfähige oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Personen nach § 8 nicht ohne den Willen des gesetzlichen Vertreters einen Wohnsitz begründen oder aufheben. Für Soldaten wird in § 9 Abs. 1 ein vom Willen unabhängiger Wohnsitz gesetzlich festgelegt. Hiernach hat ein Soldat seinen Wohnsitz grds. am Standort (§ 9 Abs. 1 Satz 1)270. Gesetzlicher Wohnsitz des minderjährigen Kindes ist nach § 11 Satz 1 Halbsatz 1 der Wohnsitz der Eltern. Das gilt allerdings nur, wenn nicht nach Maßgabe der §§ 7, 8 ein gewillkürter Wohnsitz festgelegt wird.
b) Name und Namensschutz
101 Der Name einer Person dient zu ihrer Kennzeichnung und Individualisierung. Damit können die gesellschaftlich und rechtlich relevanten Lebensäußerungen einer Person von denen anderer unterschieden werden271. Der Bedeutung des Namens als Individualisierungs- und Persönlichkeitsmerkmal trägt das BGB in § 12 durch den Schutz des Namens Rechnung272. Hiernach kann jeder im Falle der Namensbestreitung oder des unbefugten Gebrauchs seines Namens Beseitigung der Beeinträchtigung und u. U. auch Unterlassung verlangen. Das Namensrecht beinhaltet demzufolge für den Namensträger das Recht zum Gebrauch seines Namens wie auch zur Abwehr von Beeinträchtigungen gegenüber jedermann. Insoweit handelt es sich um ein subjektives Recht273 im Sinne eines ausschließlichen Persönlichkeitsrechts des Namensträgers274. Es vermittelt diesem ein absolutes Recht275, weil er die damit zugewiesenen Befugnisse allein ausüben und alle anderen Personen davon ausschließen kann. Das im BGB von Anfang an normierte Namensrecht stellt eine besondere Form des erst nach Inkrafttreten des Grundgesetzes anerkannten allgemeinen Persönlichkeitsrechts dar276. Ebenso wie dieses dient das Namensrecht in erster Linie dem Schutz ideeller Interessen, vor allem dem Schutz des Wert- und Achtungsanspruchs der Persönlichkeit277. Neben ideellen Interessen schützt das Namensrecht auch vermögenswerte Interessen der Person278. Dem Namen als besonders bedeutsames Persönlichkeitsmerkmal kann erheblicher wirtschaftlicher Wert zukommen, der im Allgemeinen auf der Bekanntheit und dem Ansehen der Person in der Öffentlichkeit beruht279. Soweit das Namensrecht dem Schutz ideeller Interessen dient, ist es unauflöslich mit der Person seines Trägers verbunden und als solches ein höchstpersönliches Recht, über das nicht verfügt werden kann, etwa durch Übertragung auf eine andere Person280. Das Namensrecht erlischt mit dem Tod einer Person281, es ist als höchstpersönliches Recht auch nicht vererblich282. Hingegen ist inzwischen in der Rspr. des BGH anerkannt, dass die vermögensrechtlichen Bestandteile des Namensrechts wie auch des allgemeinen Persönlichkeitsrechts jedenfalls vererblich sind, um den Schutz gegenüber einer kommerziellen Nutzung des Namens eines Verstorbenen durch nichtberechtigte Personen zu gewährleisten, indem der Erbe die Rolle des verstorbenen Namensträgers übernimmt und wie dieser gegen eine unbefugte Nutzung vorgehen kann283. Dieser Schutz ist in entsprechender Anwendung von § 22 Satz 3 KunstUrhG auf zehn Jahre nach dem Tod begrenzt284.
102 Gegenstand des Namensschutzes nach § 12 ist zunächst der bürgerliche Name einer natürlichen Person, der sich aus dem Vor- und Familiennamen zusammensetzt285. Adelsprädikate wie z. B. Graf oder Fürstin sind Bestandteile des Nachnamens286. Namensrechtlich geschützt ist auch das Pseudonym, unter dem eine Person in der Öffentlichkeit aus beruflichen oder sonstigen Gründen auftritt und bekannt ist, z. B. der Künstlername287. Einen eigenständigen namensrechtlichen Schutz kann auch der Vorname genießen, wenn die für diesen Schutz erforderliche Individualisierung aufgrund einer überragenden Bekanntheit der betreffenden Person oder einer erheblichen Kennzeichnungskraft des Vornamens gegeben ist288. Über den Schutz des bürgerlichen Namens und von Pseudonymen natürlicher Personen hinaus, auf den § 12 seiner systematischen Einordnung nach in den Vorschriften der §§ 1 ff. über natürliche Personen primär bezogen ist, besteht der Namensschutz auch für die Firma als Name eines Kaufmanns, unter der er im Handelsverkehr auftritt289, für den Namen juristischer Personen des Privatrechts290 und des öffentlichen Rechts291 wie auch für nicht rechtsfähige Personenvereinigungen292.