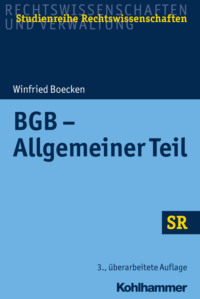Kitabı oku: «BGB – Allgemeiner Teil», sayfa 7
103 Gemäß § 12 Satz 1 kann das Namensrecht auf zweifache Weise verletzt werden. Zum einen kann das Recht zum Gebrauch eines Namens durch einen Dritten bestritten werden (Namensleugnung). Zum anderen kann das Interesse des Namensträgers dadurch verletzt werden, dass ein anderer unbefugt den gleichen Namen gebraucht (Namensanmaßung). Die Namensleugnung als Bestreiten des Rechts zum Gebrauch eines Namens kann ausdrücklich oder stillschweigend geschehen. Letzteres ist etwa dann der Fall, wenn eine Person von einer anderen dauernd mit einem falschen Namen angesprochen wird293. Bei dem praktisch bedeutsameren Fall der Namensanmaßung besteht die Verletzung des Namensrechts darin, dass ein Dritter unbefugt den gleichen Namen gebraucht, dadurch eine Zuordnungsverwirrung auslöst und schutzwürdige Interessen des Namensträgers verletzt294. Hiernach ist die Verwendung eines fremden Namens nur dann ein Gebrauchen i. S. d. § 12, wenn sie geeignet ist, eine namensmäßige Zuordnungsverwirrung hervorzurufen295. Der Grund für diese Beschränkung liegt darin, dass die Vorschrift des § 12 nur den Schutz des Namens in seiner Funktion als Identitätsbezeichnung der Person seines Trägers zum Ziel hat296. Der Namensschutz nach § 12 erfasst nur den unbefugten Gebrauch eines Namens. Mit dem Begriff unbefugt ist die rechtswidrige Verwendung des Namens gemeint, d. h. der Gebrauch muss in Widerspruch zur Rechtsordnung stehen297. Das ist der Fall, wenn der Namensträger als der Alleinberechtigte der Verwendung seines Namens durch Dritte nicht zugestimmt hat. Schließlich müssen, damit der Namensschutz des § 12 eingreifen kann, durch den zuordnungswidrigen Gebrauch schutzwürdige Interessen des Namensträgers verletzt sein298.
104 Der in seinem Namensrecht verletzte Namensträger kann in erster Linie Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen (§ 12 Satz 1). Die Beseitigung einer bestehenden Beeinträchtigung ist allerdings nicht ausreichend, wenn der Namensträger auch für die Zukunft Beeinträchtigungen zu befürchten hat. In diesem Fall steht ihm gemäß § 12 Satz 2 ein Anspruch auf Unterlassung künftiger Beeinträchtigungen zu. Obwohl das Gesetz in dieser Regelung von „weiteren“ Beeinträchtigungen spricht, ist allgemeiner Auffassung nach die Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs bereits zur Verhinderung einer erstmaligen Beeinträchtigung möglich299. Über Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche als sog. Abwehransprüche hinaus kann die Verletzung des Namensrechts auch Ansprüche auf Ersatz materieller und immaterieller Schäden auslösen300. Ein Anspruch auf materiellen Schadensersatz kann sich im Falle der Verletzung des Namensrechts aus § 823 Abs. 1 ergeben. Der Ersatz immaterieller Schäden wird unter Rückgriff auf Art. 1, 2 GG begründet301. Über die in § 12 bezeichneten Abwehransprüche sowie Ansprüche auf materiellen und immateriellen Schadensersatz hinaus kann der in seinem Namensrecht Verletzte bei Vorliegen der maßgebenden Voraussetzungen auch einen Bereicherungsanspruch aus § 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 (Eingriffskondiktion) geltend machen.
III.Juristische Personen
1.Begriff und Formen
105 Neben den natürlichen Personen kennt das BGB juristische Personen. Diese besitzen genauso wie die natürlichen Personen Rechtsfähigkeit, d. h., wie Letztere können sie Träger von Rechten und Pflichten sein302. Die juristische Person hat damit eine eigene Rechtspersönlichkeit303, aufgrund derer sie nicht nur gegenüber den sie schaffenden natürlichen Personen rechtlich verselbständigt ist304, sondern als solche wie die natürlichen Personen am Rechtsverkehr teilnehmen kann. Sie ist deshalb fähig, Rechte zu haben, wie z. B. das Eigentum an Grundstücken oder einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung, sowie Verpflichtungen einzugehen, wie z. B. die Rückzahlung eines Darlehens aufgrund eines Darlehensvertrags. Die Anerkennung der Rechtsfähigkeit ist das rechtliche Mittel zur Ermöglichung einer eigenen Teilnahme am Rechtsverkehr, die allerdings – weil die juristische Person als solche nur ein gedankliches Konstrukt ist – durch sog. Organe in Gestalt natürlicher Personen wahrgenommen werden muss. Deren Handeln wird der juristischen Person rechtsverbindlich zugerechnet.
106 Das BGB selbst kennt und regelt nur zwei Formen der juristischen Person. Es handelt sich zum einen um den rechtsfähigen Verein (§§ 21 ff.) und zum anderen um die rechtsfähige Stiftung (§§ 80 ff.). Der rechtsfähige Verein ist eine mit Rechtsfähigkeit ausgestattete, auf Dauer angelegte Vereinigung von Personen zur Verfolgung eines gemeinsamen Zwecks, die durch eine körperschaftliche Organisationsstruktur gekennzeichnet ist305. Die rechtsfähige Stiftung ist eine mit Rechtsfähigkeit ausgestattete Organisation, die einen bestimmten Zweck mit Hilfe eines Vermögens verfolgt, das der Erreichung dieses Zwecks dauernd gewidmet ist306. Außerhalb des BGB sind im Privatrecht weitere Formen juristischer Personen anerkannt. Hierzu gehört die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), die im GmbHG geregelt ist. § 13 Abs. 1 GmbHG weist der GmbH Rechtsfähigkeit zu. Des Weiteren ist die im Aktiengesetz normierte Aktiengesellschaft nach § 1 Abs. 1 S. 1 AktG juristische Person, dasselbe gilt für die in §§ 278 ff. AktG geregelte Kommanditgesellschaft auf Aktien (§ 278 Abs. 1 AktG). Weitere juristische Personen des Privatrechts sind die eingetragene Genossenschaft nach § 17 Abs. 1 GenG und der im Versicherungsaufsichtsgesetz geregelte Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, dem nach § 171 VAG Rechtsfähigkeit zugewiesen ist.
107 Von den vorgenannten juristischen Personen des Privatrechts zu unterscheiden sind die juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die gleichermaßen wie jene Rechtsfähigkeit besitzen, deren Rechtssubjektivität aber im öffentlichen Recht begründet ist307. Zu den juristischen Personen des öffentlichen Rechts zählen die rechtsfähigen Körperschaften,Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts308. Das BGB spricht die Trias der juristischen Personen des öffentlichen Rechts lediglich in der Vorschrift des § 89 an und erklärt die Regelung des § 31 über die Haftung des Vereins für seine Organe auf die juristischen Personen des öffentlichen Rechts für entsprechend anwendbar (§ 89 Abs. 1). Soweit juristische Personen des öffentlichen Rechts insolvenzfähig sind, d. h. über ihr Vermögen das Insolvenzverfahren nach den Vorschriften der Insolvenzordnung durchgeführt werden kann309, findet § 42 Abs. 2 über die persönliche Verantwortlichkeit des Vorstands eines Vereins für den Fall der Verzögerung des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens entsprechende Anwendung (§ 89 Abs. 2).
2.Gründe für die Anerkennung von juristischen Personen
108 Die Gründe für die gesetzliche Anerkennung einer eigenen Rechtspersönlichkeit bestimmter Organisationseinheiten im Privatrecht sind wesentlich praktischer Natur. Im Kern soll damit für die natürlichen Personen, die letztlich hinter der juristischen Person stehen, die Teilnahme am Rechtsverkehr erleichtert werden. Insoweit spielen vor allem zwei Gesichtspunkte eine Rolle. Zum einen ermöglicht die eigene Rechtspersönlichkeit der juristischen Person, dass diese im Rechtsverkehr als solche auftritt und durch das Handeln ihrer Organe z. B. Verträge, aus denen nur sie berechtigt und verpflichtet wird, schließen oder Eigentum etwa an einem Grundstück erwerben kann. Tatsächlich und rechtlich wäre es ohne Anerkennung der Figur der juristischen Person sehr aufwendig, wenn sich mehrere Personen zur Verfolgung eines bestimmten Zwecks zusammenschließen wollen, dies aber nur derart könnten, dass jede z. B. am Abschluss von Verträgen beteiligt werden müsste.
Bsp.: Wollen mehrere Personen einen Sportclub gründen, so empfiehlt es sich, für die Personenvereinigung die Rechtsform des rechtsfähigen Vereins zu wählen. Der Verein selbst tritt dann als juristische Person im Rechtsverkehr auf, d. h., er wird als solcher z. B. Vertragspartner eines Kaufvertrags über Trikots oder Eigentümer des Grundstücks, auf dem das Club-Gebäude errichtet werden soll. Stünde die Möglichkeit der Bildung eines rechtsfähigen Vereins nicht zur Verfügung, dann müssten die Mitglieder selbst als natürliche Personen gemeinsam etwa Kaufverträge schließen oder sonstige Rechtsgeschäfte310 tätigen. Zusätzliche Probleme, insb. auch für die Vertragspartner, würden sich daraus ergeben, dass die Mitglieder eines Clubs i. d. R. wechseln und damit z. B. die Frage aufgeworfen würde, ob neu eintretende Mitglieder auch aus schon vorher geschlossenen Verträgen berechtigt oder verpflichtet werden.
Zum anderen bedeutet die Anerkennung der juristischen Person eine Risikoverminderung für die dahinter stehenden natürlichen Personen, weil aufgrund der rechtlichen Selbständigkeit und der damit eigenständigen Teilnahme am Rechtsverkehr für Verbindlichkeiten, etwa aufgrund eines Kaufvertrags für die Kaufpreiszahlung, nur die juristische Person selbst einzustehen und mit ihrem Vermögen zu haften hat. Die hinter der juristischen Person stehenden natürlichen Personen haften grds. nicht für deren Schulden311.
Bsp.: Hat der in der Rechtsform eines rechtsfähigen Vereins bestehende Sportclub ein Vereinsgebäude bauen lassen, so kann der Bauunternehmer B seine Werklohnforderung aus § 631 Abs. 1 nur gegenüber dem Verein geltend machen, der hierfür auch mit seinem Vermögen haftet. Die Vereinsmitglieder selbst müssen nicht mit ihrem persönlichen Vermögen für die Verbindlichkeiten des Vereins einstehen.
Die grds. zu beachtende rechtliche Verschiedenheit zwischen juristischer Person und den dahinter stehenden natürlichen Personen (Trennungsprinzip)312 ist allerdings dann irrelevant, wenn die Rechtsfigur der juristischen Person rechtsmissbräuchlich ausgenutzt wird. In diesem Fall kommt bzgl. der Verbindlichkeiten der juristischen Person eine sog. Durchgriffshaftung auf das persönliche Vermögen der die juristische Person tragenden natürlichen Personen in Betracht.
Bsp.: Mitglieder eines rechtsfähigen Siedlungsvereins sorgen nicht durch Beiträge und die Bildung von Rücklagen dafür, dass dieser den Pachtzins an den Verpächter zahlen kann313.
3.Teilrechtsfähigkeit juristischer Personen
109 Die Rechtsfähigkeit juristischer Personen ist im Vergleich mit derjenigen natürlicher Personen nur eine Teilrechtsfähigkeit. Rechte und Pflichten können juristische Personen vor allem dort nicht haben, wo jene an die Existenz der natürlichen Person als solche anknüpfen. Das gilt etwa für familienrechtliche Berechtigungen und Verpflichtungen, von der Eheschließung bis zum Unterhalt, die juristischen Personen nicht zustehen können. Auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht314 und seine besonderen Erscheinungsformen, etwa das Namensrecht315 oder das Recht am eigenen Bild316, sind in erster Linie auf den Schutz der natürlichen Person ausgerichtet. Gleichwohl sind das allgemeine Persönlichkeitsrecht und dessen besondere Erscheinungsformen juristischen Personen nicht gänzlich versagt. Die Anwendbarkeit des Namensrechts und damit die Geltung auch des Namensschutzes für juristische Personen ist seit langem anerkannt, weil auch diese im Rechtsverkehr ein Interesse an Identitätswahrung und Schutz vor Identitätsverwirrung haben317. Darüber hinaus können sich juristische Personen auch auf ein ihnen zustehendes allgemeines Persönlichkeitsrecht berufen, allerdings nur insoweit, als sie durch Dritte in ihrem sozialen Geltungsanspruch als Arbeitgeber oder als Wirtschaftsunternehmen betroffen werden318. Das kann etwa der Fall sein, wenn ein Unternehmen durch eine ehrverletzende Kritik an der Qualität seiner Produkte in der Öffentlichkeit herabgesetzt wird319.
Die im Vergleich mit der natürlichen Person nur beschränkte Rechtsfähigkeit gelangt auch im Grundgesetz bzgl. der Frage der Grundrechtsfähigkeit zum Ausdruck. Nach der Bestimmung des Art. 19 Abs. 3 GG gelten die Grundrechte auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind. Diese Grundrechtsnorm erklärt sich vor dem Hintergrund, dass das Wertesystem der Grundrechte von der Würde und Freiheit des einzelnen Menschen als natürlicher Person ausgeht320. Sinnmitte ist der Schutz der privaten natürlichen Person gegen hoheitliche Übergriffe, gleichzeitig sollen sie die Voraussetzungen und Möglichkeiten für eine freie Mitwirkung und Mitgestaltung im Gemeinwesen sichern321. Auf Grundrechte können sich juristische Personen deshalb nur dort berufen, wo jene nicht allein auf den Schutz natürlicher Personen ausgerichtet sind und sofern ein Schutzbedürfnis besteht. Das gilt z. B. für den Schutz des Eigentums gemäß Art. 14 GG, über den auch der vermögensrechtliche Bereich einer juristischen Person gegenüber staatlichen Eingriffen abgesichert wird322.
4.Entstehung juristischer Personen
110 Anders als der Mensch, der mit der Geburt kraft seiner Existenz Rechtsfähigkeit erlangt, müssen juristische Personen als mit Rechtsfähigkeit ausgestattete künstliche Rechtsgebilde erst „ins Leben gerufen“ werden. Hierzu bedarf es zum einen eines rechtsgeschäftlichen Gründungsakts der hinter der juristischen Person stehenden natürlichen Personen. Bei einem Verein ist das der sog. Gründungsvertrag323, die Stiftung beruht rechtsgeschäftlich auf dem sog. Stiftungsgeschäft324. Zum anderen ist für die Erlangung der Rechtsfähigkeit zusätzlich ein staatlicher Akt erforderlich, wobei insoweit nach dem Gesetz zwei Systeme unterschieden werden. Nach dem sog. System der Normativbestimmungen ist gesetzlich im Einzelnen statuiert, welche Voraussetzungen für den Erwerb der Rechtsfähigkeit gegeben sein müssen. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen wird durch eine staatliche Stelle überprüft. Sind die Voraussetzungen gegeben, wird die Rechtsfähigkeit durch die Eintragung in ein öffentliches Register erworben. Dieses System gilt etwa für den sog. Idealverein325, der nach § 21 Rechtsfähigkeit durch Eintragung in das Vereinsregister des zuständigen Amtsgerichts erlangt. Von diesem System zu unterscheiden ist das sog. Konzessionssystem, auf dessen Grundlage die Rechtsfähigkeit durch staatliche Verleihung bzw. Genehmigung erworben wird. Der wesentliche Unterschied zum System der Normativbestimmungen liegt darin, dass über die Erteilung der staatlichen Konzession nach pflichtgemäßem Ermessen326 entschieden wird, d. h., die Verwaltung hat entsprechend dem Zweck der maßgebenden Regelungen darüber zu entscheiden, ob die Konzession erteilt wird. Nach dem Konzessionssystem erlangen der wirtschaftliche Verein gemäß § 22 und die Stiftung327 Rechtsfähigkeit.
5.Abgrenzung zur Gesellschaft bürgerlichen Rechts und zum nichtrechtsfähigen Verein
111 Die Vorschriften der §§ 705 ff. regeln die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Hierbei handelt es sich nach § 705 um einen Zusammenschluss mehrerer, mindestens von zwei Personen, die sich als Gesellschafter auf der Grundlage eines Vertrags gegenseitig verpflichten, die Erreichung eines gemeinsamen Zwecks in der durch den Vertrag festgelegten Weise zu fördern, insb. die vereinbarten Beiträge zu leisten328. Die GbR ist die Grundform der Personengesellschaften, was gesetzlich in den Verweisungen des § 105 Abs. 3 HGB und des § 161 Abs. 2 i. V. m. § 105 Abs. 3 HGB sowie des § 1 Abs. 4 PartGG für die Personengesellschaften des Handelsrechts (OHG, KG) und die Partnerschaftsgesellschaft für Angehörige freier Berufe auf das Recht der GbR zum Ausdruck gelangt. § 54 erwähnt den nichtrechtsfähigen Verein, auf den gemäß § 54 Satz 1 die Bestimmungen über die GbR für anwendbar erklärt werden329. Bezüglich beider Personenvereinigungen hat eine Rechtsentwicklung stattgefunden, die entgegen den Vorstellungen des BGB-Gesetzgebers zu einer heute weithin anerkannten „Rechtssubjektivierung“ dieser Vereinigungen geführt hat330.
§ 5Subjektive Rechte
Literatur:
Frommeyer, Persönlichkeitsschutz nach dem Tode und Schadensersatz – BGHZ 143, 214 ff. („Marlene Dietrich“) und BGH, NJW 2000, 2201 f. („Der blaue Engel“), JuS 2002, 13; Lettmaier, Das allgemeine Persönlichkeitsrecht in der zivilrechtlichen Fallbearbeitung – zugleich ein Spiegel der neueren Rechtsprechung JA 2008, 566; Schapp, Einführung in das Bürgerliche Recht: Die Anspruchsnormen und ihre Anwendung, JA 2002, 939; Schreiber, Haftung bei Gefälligkeiten, JURA 2001, 810; Wüstenbekker, Die subjektiven Privatrechte, JA 1984, 227.
Rechtsprechung:
BGH NJW 2004, 762 (Allgemeines Persönlichkeitsrecht, Privatsphäre, Intimsphäre, Veröffentlichung der Luftbildaufnahmen von Feriendomizilen Prominenter ohne deren Zustimmung; Art. 1, 2, 5 GG, §§ 823 Abs. 1, 1004 BGB); BGHZ 143, 214 – Marlene Dietrich (Schadensersatzanspruch bei Verletzung der vermögenswerten Bestandteile des postmortalen Persönlichkeitsrechts; § 823 Abs. 1 BGB; §§ 22 f. KunstUrhG); BGH NJW 1992, 2084 (Allgemeines Persönlichkeitsrecht, Recht am eigenen Bild, Schadensersatz- und Bereicherungsansprüche bei ungenehmigter Veröffentlichung zu Werbezwecken, Bemessung der Entschädigung; §§ 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2, 823 Abs. 1 BGB; § 287 Abs. 2 ZPO).
I.Begriff und Bedeutung
112 DerBegriff der subjektiven Rechte bzw. des subjektiven Rechts bildet einen Gegenpol zum Begriff des objektiven Rechts (Recht im objektiven Sinne). Mit Letzterem wird die Rechtsordnung als Ganzes oder die Gesamtheit der abstrakt-generellen Regelungen einzelner Teilbereiche der Gesamtrechtsordnung, z. B. des Privatrechts, des Bürgerlichen Rechts, des Sachenrechts oder auch des Familienrechts bezeichnet. Im Unterschied dazu ist unter dem Begriff des subjektiven Rechts (Recht im subjektiven Sinne) die einer bestimmten Person331 auf der Grundlage des objektiven Rechts verliehene und von der Rechtsordnung anerkannte Rechtsmacht zu verstehen332. Subjektive Rechte sind danach die einer einzelnen Person zustehenden Rechte bzw. Rechtspositionen, es handelt sich somit um die Zuweisung individueller Rechts- und Willensmacht333. Auch wenn die subjektiven Rechte begrifflich den Gegenpol zum Begriff des objektiven Rechts bilden, kann es ohne objektives Recht kein subjektives Recht geben. Die Rechtsordnung stellt gleichsam den Rahmen dar, innerhalb dessen subjektive Rechte erst entstehen und ausgeübt werden können. Subjektive Rechte dienen in erster Linie der Sicherung einer individuellen, selbstbestimmten Freiheitssphäre und damit der individuellen Befriedigung menschlicher Interessen und Bedürfnisse334. Die Selbstbestimmung des Menschen über seine Rechtsgüter bzw. Rechtspositionen ist Ausfluss des Grundsatzes der Privatautonomie und insofern Grundelement der Privatrechtsordnung335.
II.Unterscheidung subjektiver Rechte
113 Subjektive Rechte werden nach verschiedenen Kriterien unterschieden. Im Vordergrund stehen zum einen die Unterscheidung nach dem Inhalt des Rechts, sprich der Art der durch das Recht verliehenen Rechtsmacht336, zum anderen die Differenzierung nach der Person des Verpflichteten337.
1.Unterscheidung nach dem Inhalt
114 Unter Anknüpfung an den Inhalt des subjektiven Rechts wird unterschieden zwischen Persönlichkeitsrechten, Herrschaftsrechten, Familienrechten, Anteils- und Mitgliedschaftsrechten, Gestaltungsrechten und Ansprüchen.
a) Persönlichkeitsrechte
115 Unter Persönlichkeitsrechten sind solche Rechte bzw. Rechtsgüter zu verstehen, die unmittelbar mit dem Menschen als Person bzw. seiner Persönlichkeit verbunden sind. Hierzu gehören zunächst die in § 823 Abs. 1 genannten und absolut, sprich gegenüber jedermann338 gegen Eingriffe geschützten Rechtsgüter Leben, Körper, Gesundheit und Freiheit. Über diese ausdrücklich genannten Rechtsgüter hinaus hat die Rspr. unter der Geltung des Grundgesetzes mit Rückgriff auf Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG das sog. allgemeine Persönlichkeitsrecht339 entwickelt, das über § 823 Abs. 1 als sonstiges Recht geschützt wird. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist das Recht des Einzelnen gegenüber jedermann auf Achtung seiner Menschenwürde und Entfaltung seiner individuellen Persönlichkeit. Schutzgut im Einzelnen sind die Individual-, die Privat- und die Intimsphäre340.
Eine besondere Form des erst nach Inkrafttreten des Grundgesetzes anerkannten allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist das im BGB von Anfang an in § 12 normierte Namensrecht341. Ebenso wie das allgemeine Persönlichkeitsrecht dient das Namensrecht in erster Linie dem Schutz ideeller Interessen, vor allem dem Schutz des Wert- und Achtungsanspruchs der Persönlichkeit342. Darüber hinaus schützt das Namensrecht aber auch vermögenswerte Interessen der Person343. Der Schutz des Namensrechts wird nach § 12 dadurch geleistet, dass jeder im Falle der Namensbestreitung oder des unbefugten Gebrauchs seines Namens Beseitigung der Beeinträchtigung und u. U. auch Unterlassung verlangen kann344.
Ebenso wie das Namensrecht stellt auch das sog. Recht am eigenen Bild, das nach Maßgabe der §§ 22 ff. KunstUrhG geschützt wird, eine besondere Erscheinungsform des allgemeinen Persönlichkeitsrechts dar345. Nach § 22 KunstUrhG dürfen Bildnisse einer Person grds. nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden346. Allein dem Abgebildeten steht das Recht zu, darüber zu entscheiden, ob und auf welche Weise er der Öffentlichkeit im Bild vorgestellt wird347. Ausnahmen hiervon regeln die Vorschriften der §§ 23 und 24 KunstUrhG. So dürfen z. B. nach § 23 Abs. 1 Nr. 1 Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte ohne die erforderliche Einwilligung der abgebildeten Person verbreitet und zur Schau gestellt werden. § 24 bestimmt, dass für Zwecke der Rechtspflege und der öffentlichen Sicherheit von Behörden Bildnisse ohne Einwilligung des Berechtigten sowie des Abgebildeten oder seiner Angehörigen vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zur Schau gestellt werden dürfen, so etwa wenn Polizeibeamte zur Ermittlung von Straftätern einen Demonstrationszug fotografieren348.