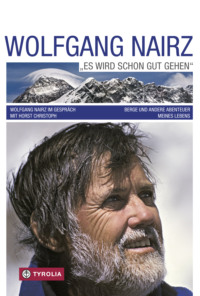Kitabı oku: «Wolfgang Nairz - Es wird schon gut gehen», sayfa 3
„IM STRASSENGRABEN SCHLAFEN WIR, DANN RENNEN WIR ZUM EINSTIEG“
Die erste Winterbegehung der Nordwand des Lyskamms in den Walliser Alpen zusammen mit Andi Schlick und Franz Jäger war zweifelsohne ein Meilenstein deiner Kletterkarriere. Das wird schon klar an der Intensität, mit der du dieses Unternehmen beschreibst. Da ist nichts mehr von der Unbekümmertheit deines Berichts über den Bazanellapfeiler, jetzt geht’s um Ernsteres. Was ist dazwischen geschehen?
Eine Zeitlang hat sich am Stil meiner Bergfahrten nicht viel geändert, außer dass sie immer schwerer wurden. Immer noch sind wir beispielsweise bei Dunkelheit um vier Uhr früh mit dem Fahrrad von Innsbruck in den Wilden Kaiser gefahren, bis auf die Wochenbrunner Alm. Über die Gaudeamushütte sind wir aufs Stripsenjoch und weiter zum Einstieg der Fleischbank oder des Predigtstuhls gerannt. Nach der Tour ging sich noch ein schnelles Bier aus, bevor wir uns wieder aufs Rad geschwungen haben und beim Dunkelwerden in Innsbruck ankamen. Müde, aber glücklich.
1966 steht die Direkte Nordwand der Lalidererspitze, die Rebitsch-Spiegl-Route im Karwendel, in meinem Tourenbuch, die damals zu den ganz schwierigen Touren zählte. Mein Partner ist Gernot Wersin vom Akademischen Alpenklub Innsbruck, der schon ein Auto hatte. Wir fahren am Nachmittag in die Eng, schlafen bis drei Uhr früh im Straßengraben und rennen dann zum Einstieg. Um sieben Uhr steigen wir ein, nach zwölf Stunden Kletterzeit haben wir die Wand geschafft. „Bis jetzt meine schwerste und vor allem gefährlichste Tour. Abstieg und langer Hatscher nach Scharnitz“ steht in meinem Tourenbuch.
Apropos „gefährlichste Tour“: Bist du von Unfällen verschont geblieben?
1969, bei einem 40-Meter-Sturz in der Goldkappl-Südwand, hatte ich – ähnlich wie Hias Rebitsch mehr als 30 Jahre zuvor – Glück im Unglück. Andi Schlick und ich gingen das erste Mal mit Doppelseil. Beim Sturz riss ein Seil, das zweite war zwar auch angeschlagen, aber es hielt. Glücklicherweise konnten wir noch aussteigen.
Du warst inzwischen auch mit neuen Partnern unterwegs.

Lalidererwände (Standort Mahnkopf), Öl auf Leinwand, 50 × 70 cm (Foto Maria Peters)
Mit den Innsbruckern Georg Wurm und Sepp Strickner gelangen schwerste Dolomitentouren. Mit Georg und Günter Wurm habe ich in nur acht Stunden die Matterhorn-Nordwand durchstiegen.
Du hast in der Zwischenzeit die Bergführerprüfung gemacht. Wolltest du dir tatsächlich als Bergführer deinen Lebensunterhalt verdienen?
Nein. Es hat mich einfach interessiert und ich konnte dabei viel lernen. Kursleiter waren Kuno Rainer, Ernst Senn und der legendäre Rudl Steinlechner. Die Ausbildung, die ich 1967 abschloss, war höchst anspruchsvoll, von ganz Österreich kamen die besten Bergsteiger, die Stars darunter waren Walter Almberger und Kurt Diemberger. Von Anfang an verstand ich mich bestens mit Andi Schlick, Franz Jäger und Hansjörg Hochfilzer, meinen späteren Partnern im Himalaya. Dieses Einverständnis betraf nicht nur das Bergsteigerische. Auch abends beim Glasl Wein, beim Singen und Gitarrespielen waren wir auf einer Wellenlänge. Manchmal sind wir erst in der Früh vom Hüttentisch aufgestanden und gleich auf Tour gegangen. Die Lehrer haben das toleriert, weil wir konditionell immer gut mithalten konnten.

Habt ihr damals schon an den Himalaya gedacht?
Zwangsläufig. Wir haben natürlich erfahren, dass Reinhold Messner und sein Bruder Günther zu einer Nanga-Parbat-Expedition eingeladen waren, ebenso die beiden Tiroler Felix Kuen und Werner Haim. Waren die um so viel besser? So reifte im Hinterkopf von Andi, Franz, Hansjörg und mir der Gedanke, das Glück in den Weltbergen einmal selbst zu versuchen. Dazu brauchten wir aber noch Erfahrung.
Nach der Bergführerausbildung arbeiteten wir für eine Bergsteigerschule, von der wir uns in die Westalpen einteilen ließen, sodass wir durchgehend sechs Wochen in Zermatt und Chamonix verbrachten. Am Sonntag trafen wir unsere Gäste, die wir eine Woche betreuen sollten. Von Anfang an legten wir ein solches Tempo vor, dass das Wochenprogramm schon am Mittwoch erledigt war und die Gäste, erschöpft, aber glücklich, am Donnerstag heimfuhren. Wir aber hatten ein überlanges Wochenende ganz für uns zur Verfügung.
Wie war zu dieser Zeit dein Kontakt zu Hias Rebitsch?
Der hat uns immer bestärkt, uns höchste Ziele zu setzen, wir haben aber gewusst, dass uns noch einiges fehlte, nämlich schwere Winterbegehungen in den Westalpen, und so kam es zur Lyskamm-Nordwand.
Die hat in Bergsteigerkreisen, aber auch in den Medien ein großes Echo ausgelöst. Hat sie auch für euch Folgen gehabt?
Zunächst hat sie körperliche Spuren hinterlassen. Franz hatte sich die Zehen erfroren, ein paar davon mussten amputiert werden. Im Innsbrucker Krankenhaus lag zur gleichen Zeit Reinhold Messner mit seinen Erfrierungen von der Rupalwand des Nanga Parbat. Bald waren wir uns einig, gemeinsam auf eine Expedition zu gehen. Josl Knoll und Horst Fankhauser sollten ebenfalls dabei sein, und Oswald Oelz war als Expeditionsarzt vorgesehen.
Warum war gerade der Manaslu das Ziel?
Das hat wieder mit Hias Rebitsch zu tun. Der hat uns einerseits eine Schiene gelegt zu Paul Bauer, dem legendären, politisch nicht unumstrittenen Expeditionsleiter der 1930er-Jahre, der während des Nationalsozialismus die zentrale Figur des organisierten Bergsports war, und andererseits zum Alpenvereinskartografen Erwin Schneider, der wiederum den Nazis offen ablehnend gegenüberstand und – was besonders wichtig war – gute Beziehungen zur Regierung des Königreichs Nepal hatte.
So kam es, dass wir zuerst eine Genehmigung für den Kangchendzönga erhielten, die aber aufgrund des Indisch-Pakistanischen Kriegs wieder gestrichen wurde, und dann, wieder mit Hilfe von Erwin Schneider, eine Bewilligung für den Manaslu. Allerdings nur von der Südseite, von der niemand wusste, wie sie aussah, wie man dort hingelangte und welche Schwierigkeiten uns erwarteten. Wir studierten die einschlägige Literatur und besuchten voller Respekt den legendären „Himalayaprofessor“ Günter Oskar Dyhrenfurth in der Schweiz. Ein einziges Foto und eine Kammverlaufsskizze kramte er aus seiner Schublade hervor, das war alles, was wir von der Südseite des Manaslu zu sehen bekamen.

Vor der Laliderer-Nordwand: Wolfgang Nairz, Hias Rebitsch, Darshano L. Rieser, Reinhard Schiestl
BARA SAHIB WOLFI
Von Reinhold Messner
26 Jahre alt, entschied Wolfgang Nairz 1970, eine Expedition in den Himalaya zu führen, und schon zwei Jahre danach ging es zum Manaslu, einem Achttausender in Nepal. Der Berg, erst zweimal – von Nordosten und von Westen – bestiegen, sollte von Süden angegangen werden.
Es gab damals weder Fotos noch Karten von der Südseite dieses achthöchsten Gipfels der Erde, keine Satellitenbilder und auch keine Trekkingrouten in unmittelbarer Nähe. Nach der Eroberung der Achttausender-Gipfel zwischen 1950 und 1964 ging es jetzt um neue Zugänge zu den höchsten Bergen der Welt, um neue Routen und einen anderen Stil als noch zehn Jahre zuvor. Hatten bei der Erkundung und Erstbesteigung der Achttausender noch nationale Emotionen und daher auch nationales Back-up eine wichtige Rolle gespielt, sah sich Wolfgang Nairz jetzt als Organisator einer Expedition ins Ungewisse. Weder die zu erwartenden Schwierigkeiten und Gefahren waren voraussehbar, und schon gar nicht das Zusammenspiel der Mannschaft, die aus lauter eigenständigen Persönlichkeiten bestand.
Wolfi führte seine Expedition nicht autoritär, alle wichtigen Entscheidungen wurden in der kleinen Gruppe diskutiert und wenn auch nicht demokratisch abgestimmt, so doch nach der Haltung der Mehrheit umgesetzt. So trugen wir alle Wolfis Leadership mit und respektierten ihn als Expeditionsleiter. Ich hatte das Glück, als Südtiroler bei der vornehmlich aus Tiroler Bergführern zusammengesetzten Mannschaft dabei zu sein und mit ihnen zwei Monate „am Ende der Welt“ zu operieren.
Das Expeditionsbergsteigen im deutschen Sprachraum unterlag damals großteils noch den Prämissen aus der Zwischenkriegszeit – Führerprinzip und militärisch geprägtes Kameradschaftsideal. Die Skepsis in Alpenvereinskreisen zu der so ganz anderen Nairz-Expedition war unüberhörbar: vor der Abreise zwar leise, nach der Tragödie am Gipfelplateau des Manaslu, bei der Franz Jäger und Andi Schlick zu Tode kamen, aber umso anklägerischer und lauter. Wolfi aber stand fest zum Geschehen am Berg und zu seiner Mannschaft.
Meine Erfahrungen beim Expeditionsbergsteigen – ich hatte nach der Erstbegehung der Rupalwand am Nanga Parbat meinen Bruder in einer Lawine verloren – waren bis dahin mehr als traurige gewesen. Der Expeditionsleiter Herrligkoffer hatte uns Teilnehmern bei diesem Unternehmen 1970 nicht nur Verträge unterschreiben lassen, die jede eigene Berichterstattung unmöglich machen sollten, er hatte auch alle eingespielten Seilschaften nach dem Prinzip „divide et impera“ auseinanderdividiert. Er war als Nichtbergsteiger zwar nicht in der Lage, vernünftige Entscheidungen für das Fortkommen am Berg zu treffen, formte aber jenen unmöglichen Satz, „wer sich meinen Befehlen entzieht, entzieht sich auch meiner Verantwortung“, der mich für alle weiteren Zeiten von autoritären Expeditionen fernhalten sollte.
Leadership hat mit Einfühlungsvermögen in die Mannschaft, mit Verantwortungsgefühl und mit der Fähigkeit zu tun, sich auf eine Stufe mit seinen Mitstreitern zu stellen. Für diese Leadership stand Wolfi.
Die Hilfe der Sherpas, die 1972 auf eine mehr als 50-jährige Trägerkultur aufbaute, war auch bei unseren Expeditionen eine Basis für den Erfolg. Obwohl wir Sahibs alle Absicherungsarbeiten beim Aufbau der Hochlager selbst erledigten, bewältigten sie auch über die schwierigen Passagen den Nachschub.
Es waren die Sherpas, die dem jungen Wolfgang Nairz den Titel Bara Sahib – übersetzt der große weiße Mann – gaben, und ihn damit adelten: für seine überlegte und überlegene Führung, für seine bergsteigerische Leistung, für sein Einfühlungsvermögen. Kurz für seine Leadership. Seit damals ist Wolfi unser Bara Sahib. Ich habe mit ihm ein halbes Dutzend Expeditionen zu den Bergen der Welt – Manaslu, Makalu, Mount Everest, Ama Dablam, Dhaulagiri – mitgemacht, und immer hat er seine Leadership bewiesen. Nicht immer waren wir erfolgreich, immer aber sind wir in Frieden nach Hause gekommen.
„EIN HUND NAMENS KARL MARIA“
An der Spitze der beiden sehr erfolgreichen Himalaya-Expeditionen von 1953, die du als Kind sehr bewusst wahrgenommen hast, standen zwei starke Expeditionsleiter, am Everest der britische Armeeoffizier John Hunt und am Nanga Parbat der deutsche Arzt Karl Maria Herrligkoffer. Wann wurde dir die Bedeutung des Expeditionsleiters für eine Expedition bewusst?
Sehr früh. Nicht nur durch die beiden genannten Expeditionen, sondern auch durch die Literatur. Ich habe alles gelesen, von einem Paul Bauer oder einem Norman Dyhrenfurth, bei denen die Wichtigkeit eines starken Expeditionsleiters betont wird. Ich wollte ja anfangs nicht selbst Expeditionsleiter sein, aber dann hat mich vor allem Hias Rebitsch darin sehr bestärkt, diese Rolle selbst zu übernehmen. Ich wollte einfach in die Weltberge hinausfahren, aber der Hias hat gesagt, du musst das selbst machen, einer muss die Entscheidungen treffen, und einer muss die Verantwortung haben, und einer muss schließlich auch die ganze Organisation machen, also „spiele“ den Expeditionsleiter!
Hast du als Expeditionsleiter Vorbilder gehabt?
Diese 1930er-Jahre-Expeditionen, die ich aus der Literatur gekannt habe, waren natürlich völlig anders geführt worden als dann unsere Expeditionen, auch die 1953er-Everest- und Nanga-Parbat-Expeditionen waren andere. Bei den Briten und bei den Deutschen ist es um den Nationalstolz gegangen. Bei den Engländern ist es darum gegangen, den „dritten Pol“, also den höchsten Punkt der Erde zu erreichen, nachdem sie am Nord- und Südpol gescheitert waren. Und der Nanga Parbat war eben der deutsche Schicksalsberg, wie man ihn immer bezeichnet hat.
Hias Rebitsch hat das dann später relativiert, indem er vom sogenannten deutschen Schicksalsberg gesprochen hat. Hermann Buhl ist ja gegen den Befehl Herrligkoffers zum Gipfel gegangen. Weißt du, ob er nach seiner Rückkehr darüber gesprochen hat?
Ich kann mich daran nicht erinnern, ich glaube nein.
Du hast später ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu Edmund Hillary, dem Erstbesteiger des Everest, gehabt. Hat er über seinen Expeditionsleiter John Hunt und über dessen Führungsstil gesprochen?

Treffen der Legenden: Edmund Hillary (links) und John Hunt 40 Jahre nach der Everest-Erstbesteigung im Gespräch mit Wolfgang Nairz
Ja. Und ich habe auch Hunt selbst kennengelernt. 1993, zum vierzigjährigen Jubiläum der Erstbesteigung, haben die alten Herren Hunt, Hillary und Lowe einen Ausflug zum Everest gemacht, und ich durfte sie teilweise begleiten. Manfred Gabrielli vom ORF sollte nämlich einen Film drehen, ist aber leider höhenkrank geworden. So habe ich die ganzen Interviews mit Hillary, Hunt und dem Kameramann George Lowe geführt. Und da ist sehr wohl dieses Verhältnis Hunt–Hillary spürbar gewesen. Und man hat gemerkt, dass der Offizier Hunt schon ein sehr bestimmender Mann war. Das hat man auch nach 40 Jahren noch herausgehört, wenn Hillary immer gefragt hat: „John, what do you say to this?“ Oder „John, what would you say to that?“
Und wie war das bei euren Expeditionen?
Ich habe immer gesagt, bei einer Expedition muss Demokratur herrschen – also Demokratie und Diktatur gemeinsam: Die Meinung der Mannschaft zählt, aber das letzte Wort hat immer der Expeditionsleiter. Wir haben versucht, alles gemeinsam zu diskutieren und eine Lösung zu finden. Aber wenn es keinen Konsens gibt, dann muss jemand entscheiden, und das ist der Expeditionsleiter. Und das hat bei meinen Expeditionen funktioniert und es hat sich jeder daran gehalten.
Hast du von Herrligkoffer und Hunt etwas gelernt?
Von Herrligkoffer sicher nicht. Der Stil von Herrligkoffer – alles, was ich darüber gelesen habe und dann in weiterer Folge auch von Leuten wie Reinhold Messner gehört habe, vor allem wie es am Nanga Parbat 1970 zugegangen ist – war mir zutiefst zuwider. Allein die Expeditionsverträge, die damals die Mitglieder unterschreiben mussten, würden wahrscheinlich bei keinem Gerichtshof standhalten. Das waren Knebelverträge – das war ja beim Buhl auch schon so. Wenn Buhl nicht 1957 an der Chogolisa abgestürzt wäre, dann wäre das Verhältnis zu Herrligkoffer vermutlich genauso eskaliert wie später bei Reinhold Messner. Also von Herrligkoffer habe ich sicher nichts übernehmen können. Von Hunt hingegen schon. Ich hab die Bücher von der 1953er-Expedition verschlungen. Da waren beispielsweise die Ausrüstungslisten genau wiedergegeben, also was man alles mitnehmen muss. Das ging ja bis zur Rolle Klopapier, die man damals in Nepal nicht kaufen konnte. Da habe ich organisatorisch von der britischen Expedition sehr viel profitiert und mir einiges abgeschaut.
Von Hunt ist überliefert, dass er nach dem Gipfelsieg den Schweizern, die ein Jahr davor am Everest gescheitert waren, geschrieben hat: „To you a good half of the glory.“ Also euch, eurer Vorarbeit, gebührt die Hälfte unseres Ruhmes. Das war so ein Statement von britisch sportlicher Fairness. Wäre das Herrligkoffer zuzutrauen gewesen?
Nein. Sicher nicht.
Euch hat Herrligkoffer einmal mit einem Prozess gedroht – eine lustige Geschichte.
Ja. 1972, als wir am Manaslu waren, war eine Expedition Herrligkoffers in der Südwestwand des Everests am Weg. Uns ist im Basislager ein kleiner Hund zugelaufen, den haben wir Karl Maria getauft. Und als man uns gefragt hat, warum der Hund Karl Maria heißt, haben wir gesagt, weil er nicht übers Basislager hinausgeht. Herrligkoffer war ja kein Bergsteiger, er war ein Expeditionsleiter, der sein großes Messezelt im Basislager gehabt und von dort agiert hat und nie in größere Höhen hinaufgegangen ist. Als Herrligkoffer die Geschichte mit dem Namen des Hundes zu Ohren bekommen hat – im Buch „Sturm am Manaslu“ von Reinhold Messner ist sie ja auch beschrieben –, wollte er uns spontan klagen. Aber es war ihm dann doch zu blöd.

Franz Jäger im Manaslu-Basislager mit unserem Hund Karl Maria
Die Anekdote wirft aber ein bezeichnendes Licht auf eure Unbekümmertheit und damit auch ein wenig auf euren Expeditionsstil. Ihr wart schon – wenn ich es einmal so sagen darf – rotzfreche Typen, oder?
Ja, es hat sich – auf Deutsch gesagt – „koana was gschissn“ (Lachen). Es war ja die Zeit der Nach-Achtundsechziger. Deshalb habe ich mein vorhergehendes Buch ja auch „Die wilden siebziger Jahre im Himalaya“ genannt.
Ein Schlüsselwort jener Zeit war das „Aussteigen“. Wart ihr Aussteiger? Sind vielleicht Bergsteiger generell Aussteiger?
Aussteiger waren wir nicht und wollten es auch nicht sein. Wir wollten vor allem so viel Zeit wie nur irgendwie möglich neben dem Beruf oder Studium in den Bergen verbringen. Aber wichtig war, bei aller Unbekümmertheit und aller Frechheit, dass wir alle gute Bergsteiger waren. Und dass wir uns gut kannten. Beides zusammen war die Voraussetzung für die Erfolge. Mit guten Bergsteigern etwas zu tun, ist einfacher, wenn sich diese kennen, wenn sie befreundet sind, bevor sie irgendwo in die Weltberge hinausziehen. Es ist schwieriger, wenn sich eine international zusammengewürfelte Expedition erst am Berg trifft und dann Top-Bergsteiger aus verschiedensten Nationen erstmals zusammenarbeiten sollen. Da zählt dann oft vor allem persönlicher Ehrgeiz und weniger das Gemeinsame.

Kathmandu, Frühjahr 1982: Wolfgang Nairz lauscht den Erzählungen Herbert Tichys über die Erstbesteigung des Cho Oyu.
In dem Buch, das vor ein paar Jahren zum 100. Geburtstag des Cho-Oyu-Erstbesteigers Herbert Tichy erschienen ist, hast du ein Kapitel geschrieben. Und da beschreibst du den Expeditionsstil Tichys als sehr unterschiedlich zu dem der Expeditionen Herrligkoffers und Hunts, deren Berichte – und jetzt zitierst du Tichy – „fast wie Kriegsmeldungen klangen und deren Teilnehmer wie Soldaten einen feierlichen Eid der Kameradschaft schworen“. Im Gegensatz dazu war Tichys Expedition bescheiden, was das Budget und die Zahl der Teilnehmer betraf. Und er hat damit – wie du schreibst – das Himalaya-Bergsteigen revolutioniert. War er ein Vorbild für den Expeditionsleiter Nairz?
In einem hohen Maß. Dazu trug bei, dass mit Herbert Tichy, den ich ja erst viel später kennengelernt habe, auch der Tiroler Sepp Jöchler unterwegs war. Und Jöchler war – wie Buhl – ein „Karwendler“ und ist auch bei uns zu Hause ein und aus gegangen. Ihn habe ich also auch früh als Vorbild gehabt. Und Tichys Buch „Cho Oyu – Gnade der Götter“ war für mich prägend, auch für den Stil unserer Expeditionen.
In deinem Buch „Die wilden siebziger Jahre im Himalaya“ beschreibst du eine Situation am Cho Oyu. Da heißt es: „Im Basislager setzten wir uns mit allen Sherpas zusammen. Ich machte ihnen klar, dass wir alle gemeinsam hart arbeiten müssen, wenn wir den Gipfel erreichen wollen, und dass es keinen Unterschied zwischen Sherpas und Sahibs gibt.“ „Wenn wir alle zusammenarbeiten“ – das war die Botschaft –, „hat auch jeder eine Chance auf den Gipfel“. War das der große Unterschied zu dem Stil der vorhergehenden Generation, dass man auch mit den Sherpas gemeinsam plante?
Klar, das brachte uns auch Vorteile. Wir profitierten ja von den Erfahrungen der Sherpas. Und da war eben Tichy ein Vorreiter, der am Cho Oyu seinen Sherpa Pasang Dawa Lama als gleichberechtigtes Expeditionsmitglied ansah.