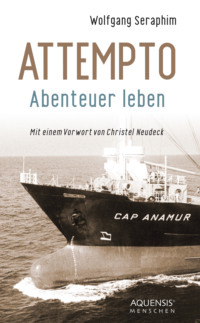Kitabı oku: «Attempto», sayfa 4
1945
Auf der Flucht
Dann stapften drei vermummte Gestalten mit ihren Rucksäcken die Hessestraße hinunter, Richtung Bahnhof. Nach wenigen Metern ging die Mutter noch einmal in das Haus zurück. Die Schwester lief langsam weiter Richtung Bahnhof, ich sollte warten. Es dünkte eine Ewigkeit, bis die Mutter endlich zurückkam. Zum ersten Mal seit Vaters Tod sah ich wieder Tränen in ihren Augen. Sie hatte wohl vergeblich nach irgendwelchen Dokumenten gesucht. Auf dem Bahnhof gab es keinen Personenzug, sondern ausschließlich einen Güterzug mit unter Dampf stehender Lok. „Der geht Richtung Westen“, so der Stationsvorsteher. Mehr wusste auch er nicht; weder Abfahrtszeit, geschweige denn sein Ziel im Westen. Also kletterte man mit vielen anderen Freystädtern in die mit Stroh ausgelegten Viehwaggons und harrte dort, auf dem Boden sitzend, der Dinge, die da kommen sollten.
Langsam setzte sich der Zug ruckelnd in Bewegung. Die Türe des Waggons war einen Spalt weit offen geblieben. Der Blick schweifte über die im Sonnenlicht vorbeifliegende, glitzernde Schneelandschaft. Ich fand alles nur noch spannend. Mit einem Personenzug war man ja schon oft unterwegs gewesen. Aber ein Viehwaggon mit während der Fahrt halb geöffneter Tür, das hatte schon was Besonderes, war Abenteuer pur. Immer wieder wurde, oft auf freier Strecke, angehalten und somit das Problem des „Spatenganges“ gelöst. Man schlug sich seitwärts in die Büsche, ehe der Transport nach ausgedehntem Pfeifkonzert des Lokführers wieder Fahrt aufnahm. Irgendwann war dann an einem Bahnhof Endstation. Es begann die Zeit des Wartens. Die Züge schienen alle nur noch Richtung Westen programmiert. Als ob man gewiss sein dürfte, was dort zu erwarten sei. Aber es galt wohl als Ausdruck stiller Übereinstimmung: alles, nur nicht den Russen in die Hände fallen! Auf den Bahnsteigen herrschte atemberaubendes Gedränge, gepaart mit Ungewissheit. Wann fährt welcher Zug wohin? Wenn es überhaupt Lautsprecherdurchsagen gab, waren sie in dem Tumult kaum zu verstehen und obendrein sehr vage. Im Bahnhof stehende Züge waren bis auf die Trittbretter völlig überfüllt, Mütter riefen verzweifelt die Namen ihrer abhandengekommenen Kinder. Wenn ein leerer Zug einlief, wurde dieser nach allen Regeln der Kunst gestürmt. Koffer blieben zunächst auf dem Bahnsteig stehen und wurden anschließend durchs offene Fenster nachgereicht, ehe man auf gleichem Weg folgte.
Irgendwann bei Kattowitz tauchte ein Mädchen, ca. 14 Jahre alt, im Zugabteil auf. Ihre Augen flackerten in tief liegenden Höhlen und mit zittriger Stimme bat sie um ein Stück Brot. Dabei schwankten die Hände weit ausgestreckt flehentlich von einem Mitreisenden zum nächsten. Die Mutter griff in ihren Rucksack, zauberte einen Brotlaib hervor, schnitt einen Ranken ab und legte ihn wortlos in die Hände des Mädchens. Das blasse Gesichtchen verschwand fast vollkommen hinter dem Brot. Vor meinen staunenden Augen war das Brot nach wenigen Minuten mit beiden Händen gierig in den Mund geschoben und herunter geschlungen. Eine Mitreisende murmelte betroffen: „Mein Gott, wir wissen ja selber nicht, wann wir uns irgendwo wieder etwas zu essen besorgen können.“ Damit traf sie den Nagel auf den Kopf. Die Mutter war die einzige geblieben, die sich von einem Teil der Notration für sich und die Kinder getrennt hatte. Ich spürte instinktiv: Was bisher als spannendes Abenteuer erlebt wurde, barg auch bedrohliche Aspekte, die ich bisher gnädig aus meinem kindlichen Gemüt verdrängt hatte. Gleichzeitig damit verbunden geriet die Mutter neben mir zum unerschütterlichen Fels in der Brandung. Vorsorgend gegen alle Gefahren gewappnet.
In Leipzig war vorübergehend wieder Endstation. Die Rumpffamilie – der Bruder befand sich ja noch in Breslau – landete in einem Bunker. Hier kampierten, wieder in drangvoller Enge, auf Notliegen Hunderte von Flüchtlingen in gespenstischem Halbdunkel. Die Luft zum Schneiden dick. Angstschweiß entwickelt eine besondere Duftnote. Hier geriet sie zu unverkennbarer Dominanz. Das Rote Kreuz sorgte für Nudelsuppe. Sie wurde von der Mutter vorsorglich, nach dem Motto: „Zucker sparen grundverkehrt, der Körper braucht ihn, Zucker nährt“, mit diesem Kräfte spendenden Zaubermittel aus ihrer Notration angereichert. Diese Kombination war gewöhnungsbedürftig. Aber es gab zu jener Zeit noch ganz andere Dinge, an die sich zu gewöhnen erheblich mehr Überwindung kostete … Bis auf den heutigen Tag keine Nudelsuppe, ohne den Gedanken an diesen Zuckergeschmack auf der Zunge und an diesen Bunker in Leipzig. Für ein Kind geriet dieses Szenarium bald zu einer ätzend langweiligen Komponente seines Abenteuers. Für mich nicht mehr erinnerlich, wie lange sich dieser Abschnitt der Flucht hinzog. Auf jeden Fall war ich der Mutter sehr dankbar, als sie eine innere Unruhe ergriff, uns Kinder bei der Hand nahm, um wieder dem Abenteuer Bahnhof zuzustreben.
Der Rest der Reise ist im Gedächtnis nicht mehr abrufbar. Ich erinnere mich aber noch sehr deutlich daran, plötzlich energisch wach gerüttelt worden zu sein. Es war stockdunkel. Immer noch hundemüde stolperte ich an der Hand der Mutter durch die bitterkalte Februarnacht. Ein vor Heißhunger brennendes Feuer in der Magengegend. Da standen wir, frühmorgens gegen vier Uhr vor einem Haus neben dem Marktplatz in dem kleinen schwäbischen Städtchen Murrhardt bei Backnang. Die Mutter drückte auf eine der zahlreichen Klingelknöpfe eines großen Hauses. Schlotternd vor Kälte spähte man gebannt in die Nacht. Rührt sich was? Noch heute sehe ich beim Blick in einen klaren Sternenhimmel die Giebelumrisse dieses Hauses unter den in der Kälte flimmernden Sternen. Wer um alles in der Welt nimmt zu nachtschlafender Zeit eine unbekannte Mutter mit zwei Kindern bei sich auf!? Am liebsten hätte ich mich auf der Stelle hingelegt. Schlafen und nicht mehr aufwachen, der einzige Wunsch. Dann kam alles ganz anders. Die Mutter rief zu einem sich oben öffnenden Fenster hinauf. Es schloss sich, nachdem von dort nur ein einziges Wort zu hören war: „Allmächtiger!“ Lichter gingen an, und eine Stunde später lagen die drei Wanderer zwischen den Welten mit einer großen Portion Grießbrei im Bauch in den noch warmen Betten zweier mir völlig unbekannter alter Damen. Ein Erlebnis, das in der Seele eines achtjährigen kleinen Jungen tiefe Spuren hinterlässt. Gerührt von so viel Hilfsbereitschaft beschloss ich: Sollte ich später einmal zu Geld und Einfluss kommen, will ich notleidenden Menschen wieder ein wenig von dem zurückgeben, was eben dankbar empfangen wurde. Erst am nächsten Tag wird realisiert, dass die zwei alten Damen der Mutter gar nicht so unbekannt waren. Die beiden Schwestern, Edith und Marta Horn, waren der Mutter in ihrer jugendbewegten Wandervogelzeit begegnet. Damals, so erfuhr ich später, hatten sich die beiden Schwestern Horn in den Bruder der Mutter unglücklich verliebt. Es war ein meine Zukunft prägendes Erlebnis. Ich konnte nicht ahnen, zu welchen Ufern dies später noch tragen sollte. Auf jeden Fall stand ich an der Schwelle eines völlig neuen Lebensabschnitts.
Willkommen in Schwaben
Wir waren bei den Schwestern Martha und Edith Horn in einer recht abgelegenen Ecke des Schwabenlandes, dem kleinen verträumten Murrhardt mit ein paar tausend Einwohnern gestrandet. Inhaber eines geradezu klassischen Tante-Emma-Ladens. Damals noch ein nicht wegzudenkender Anker des täglichen Bedarfs in einem Ozean des Mangels. In dem Geschäft „Horn am Markt“ lagerten neben einem bescheidenen Fundus an Grundnahrungsmitteln wie Mehl und Zucker für die Einwohner auf Lebensmittelkarten, Reste von Stoffballen, Häkeldecken, Nähseide, Wolle, Stricknadeln, Reinigungsmittel für den Haushalt. Unter anderem ein Pulver zur Zahnreinigung in kleinen Pappschachteln, auf dem ein Tiger mit grellweiß blitzenden Zähnen um die Gunst des Kunden buhlte. Dieser Tiger mit der Pappschachtel hatte es mir besonders angetan. Schon nach wenigen Tagen machte ich mir zur Aufgabe, den etwas schleppenden Umsatz dieses Wohltäters der Zahngesundheit anzukurbeln. Sobald ich durch das Fenster der Ladentüre einen Kunden erblickte, öffnete ich von innen und hieß ihn mit freundlichem Diener willkommen. In den ersten Tagen sorgte das für einen meist dankbar registrierten Überraschungseffekt. Später begegnete man sich mit einem freundlichen Lächeln des Wiedererkennens. Beim Verlassen des Ladens kam der Moment der Bewährung: Noch ehe ich erneut die Ladentüre öffnete, fragte ich mit einem Lächeln, das mindestens ebenso viel Zahn zeigte wie der Tiger auf der Schachtel: „Haben der Herr/die Dame auch noch einen Vorrat dieses vorzüglichen Zahnreinigungsmittels?“ Neben dem nicht zu leugnenden Klein-Jungen-Charme verfehlte das Wörtchen „Vorrat“ in einer Zeit des Hamsterns nicht seine Wirkung. Der Verkauf florierte, eine telefonische Zusatzbestellung beim Großhändler wurde fällig und ich sah mich schon als den großen Zampano, der den Laden zu ungeahnten Höhenflügen führt. Leider währte dieses Glück der Selbstbestätigung nicht lange: Entweder putzten sich Murrhardts Bürger zu selten die Zähne, oder der Schachtelinhalt war vom Hersteller zu großzügig bemessen. Vielleicht krankte es auch an der geringen Einwohnerzahl. An der Konkurrenz konnte es nicht liegen – „Horn am Markt“ war konkurrenzlos! Wie auch immer, der Umsatz stagnierte alsbald deutlich. Für mich das Signal, sich nach einer anderweitigen Spielwiese umzusehen.
Gegenüber vom Wohn-Geschäftshaus, in dem man Obhut gefunden hatte, stand die Volksschule, aus der die Schüler – immer wenn die Sirenen „akute Luftgefahr“ signalisierten, in Scharen herausströmten. Dabei ertönte aus Dutzenden von Kehlen ein „sauet, sauet!“, worauf ich mir keinen Reim machen konnte. „Des hoißt so viel wie reufla“, wurde ich von den Geschwistern Horn beschieden, was den Tatbestand nicht transparenter machte. Die Mutter half nach: „Lauft schnell“ war die Devise und die wurde zu damaliger Zeit fast täglich ausgegeben.
Wann immer sich feindliche Flugzeuge Murrhardt näherten, wurde dieser Mechanismus in Gang gesetzt. Sehr sinnvoll war das nicht, denn es handelte sich immer um Bomberverbände, die mittlere Großstädte mit nennenswerten Industrie- und Rüstungsanlagen zum Ziel hatten. Mit beiden Attributen konnte Murrhardt erfreulicherweise nicht dienen. So geriet die häufige Unterbrechung des Unterrichts zu einer Art Happening, was die Schüler freute. Der Rest der Bevölkerung nahm das Sirenengeheul gar nicht mehr zur Kenntnis.
Diese Sorglosigkeit sollte sich eines Tages als trügerisch erweisen. Es war zur Zeit der Schlüsselblumen, als ich zusammen mit einem Spielkameraden, auf einer Wiese oberhalb von Murrhardt, sogenannte „Judenstrickle“ rauchte. Auf Fingerlänge zurechtgeschnittene trockene Lianen, deren Rauch die Schlüsselblumenblüten beim Durchblasen braun färbten. Wieder einmal zog einer der Bomberverbände über Murrhardt hinweg, als sich plötzlich ein begleitendes Jagdflugzeug aus dem Verband löste, um sich wie ein Habicht auf eine im Bahnhof unter Dampf stehende Lokomotive zu stürzen. Die Bordgeschütze ratterten und schlugen Löcher in den Kessel der Lok, aus denen der Dampf zischte. Fasziniert starrten wir auf das Geschehen. Der Jäger drehte ab, zog nach oben und raste bei diesem Manöver auf die Wiese zu, auf der wir saßen. Plötzlich trat die Bordkanone erneut in Aktion. Die Geschossgarbe, eine Spur aufspritzender Erde vor sich her treibend, schoss in rasender Geschwindigkeit auf uns zwei Jungen zu. Reflexartig warfen wir uns rechts und links zur Seite. Wie vom Lineal gezogen hatte die Garbe genau die Mitte unseres ursprünglichen Sitzplatzes durchpflügt. In panischer Angst rannten wir dem Waldrand entgegen. Der Jäger raste noch einmal auf die Wiese zu. Inzwischen war aber der rettende Wald erreicht; wir warfen uns mit zitternden Knien auf den Boden, minutenlang unfähig, auch nur einen Ton von uns zu geben. Betreten und immer noch vor Angst schlotternd, schlichen wir nach Hause. Man verabredete, nichts von dem Vorfall zu erzählen. Ich, um der Mutter nicht noch nachträglich Angst einzujagen. Mein Spielkamerad befürchtete Prügel wegen Herumtreibens bei „akuter Luftgefahr“.
Die Geschwister Horn, von den beiden Kindern Tante Edith und Tante Martha genannt, bildeten ein etwas altjüngferliches, aber liebevolles Paar. Edith war die Fröhlichere von beiden. Martha meist leicht fröstelnd, mit häufig laufender Nase und unvermeidlicher Wolljacke nebst Schal ausstaffiert. Sie vermittelte immer einen Hauch von Autorität ausstrahlender Unnahbarkeit. Die Ernährung, den allgemeinen Umständen entsprechend recht spartanisch, wurde zusätzlich durch eine kräftige Prise naturverbundenen Gedankengutes angereichert. Neben Kathreiner spielten verschiedenste Teeaufgüsse und die Lehre des Sebastian Kneipp eine oft gerühmte und auch praktizierte Rolle im Tagesverlauf. Auf der lausig kalten Toilette baumelten an gebogenem Draht, sorgsam in handliche Quadrate geschnitten, ältere Ausgaben des „Murrhardter Boten“. Gelegentlich, etwas weniger benutzerfreundlich, auch Werbebroschüren auf Hochglanzpapier aus dem Laden. Daneben gemahnte ein Plakat mit der Aufschrift „Schließlich tuet jeder klug, wenn er wieder füllt den Krug“ für rechtzeitigen Wassernachschub nach Erledigung eines umfangreicheren Geschäftes Sorge zu tragen. Woraus sich ergibt, dass es sich bei der vorhandenen Toilette um einen fortschrittlichen Donnerbalken handelte, bei der Abfallgrube und Toilettenschüssel durch einen mit Handgriff zu betätigenden Metalldeckel getrennt war. Das garantierte, insbesondere in der wärmeren Jahreszeit, eine als durchaus angenehm empfundene Verringerung der Geruchsbelästigung.
Nach dem recht regelmäßig praktizierten sonntäglichen Kirchgang in der nahe gelegenen schönen alten romanischen Walterichskapelle galt es, die im Laden eingesammelten, in Pappkartons aufbewahrten Abschnitte der Lebensmittelkarten getrennt nach Nahrungsmittel mit Kleister zu bepinseln und auf Papier zu kleben. Die Abgabe dieser Bögen im Rathaus war Voraussetzung für den Lebensmittelnachschub im Laden.

Es ließ sich wohl nicht vermeiden, dass eines Tages meine Anmeldung in der gegenüberliegenden Schule nicht länger zu umgehen war. Nach eingehender Ermahnung zu Fleiß und Gehorsam übergab mich die Mutter hoffnungsvoll an der Klassenzimmertüre einer Lehrerin, die gerade einen Aufsatz schreiben ließ. Das Thema prangte in großen Druckbuchstaben an der Tafel: „Wie schüre ich meinen Ofen?“ Inzwischen hatte ich zwar schon etwas intensivere Einblicke in die ortsübliche Sprache gewonnen, aber „schüren“ war mir noch nicht begegnet. Immerhin reichte der Grips schon so weit, um sich auszurechnen, dass es sich dabei wohl um das Anfeuern des Ofens handeln müsse. Was sollte man sonst auch schon mit einem Ofen, schulaufsatztauglich betrachtet, anderes anstellen?
Ob meine Ausführungen vor der Lehrerin Gnade fanden, war später nicht mehr erinnerlich. Wohl aber der zusätzliche Sprachgewinn bei der Tage darauf erfolgten Rückgabe der Aufsätze. Hier erschloss sich mir erstmals, dass „Spächtele“ aus in Kleinstteilen zerlegten Holzscheiten gewonnen werden, und was in Schlesien raucht in Schwaben „ruaselet“. Wie auch immer: Hochdeutsch war offensichtlich nicht das bevorzugte Idiom dieser Stätte kindlicher Wissensvermittlung … Mir sollte es recht sein: Auf diese Weise beschleunigte sich die sprachliche Integration des Kindes mit Migrationshintergrund, wie man dies, medientauglich-geschliffen, später einmal formulieren würde. Auch das zwischenmenschliche Miteinander gedieh prächtig – Kinder sind sehr flexibel, wenn man sie nur lässt.
Schräg hinter der Schule stand eine Baracke, in der – es muss wohl Anfang März 1945 gewesen sein – ein Trupp amerikanischer Kriegsgefangener untergebracht war. Bewacht von einigen deutschen Angehörigen des Volkssturms. Deutschlands verzweifeltes letztes Aufgebot an Rentnern, Asthmatikern und sonstigen nicht mehr wehrtauglichen Rettern des „Großdeutschen Reiches“. Die Bewachten fielen durch ihre hervorragende Ausrüstung auf: Die Schuhe mit hohen Profilsohlen und aus widerstandsfähigem Leder bildeten einen grotesken Kontrast zum ärmlichen Schuhwerk ihrer Bewacher. Es war auf den ersten Blick erkennbar: Das war eine Qualität, von der der deutsche Volksgenosse nur träumen konnte. Sie lagen meist in einer weit geöffneten Tür, die einem überdimensionalen Garagentor ähnelte, und blinzelten mit seltsamen permanenten Kaubewegungen, die verdächtig an Kühe auf der Weide erinnerten, in die ersten Strahlen der Frühjahrssonne. Sie sahen sehr gelassen in ihre Zukunft. Allen war klar: Es war nur eine Frage von kurzer Dauer, bis aus den Bewachten Bewacher werden würden. Hier sah ich auch zum ersten Mal Menschen schwarzer Hautfarbe leibhaftig vor mir. Das Rätsel mahlender Kaubewegungen sollte sich erst später lüften.

Etwa zu gleicher Zeit tauchte, wie Zieten aus dem Busch, auch der ältere Bruder auf, womit so schnell niemand gerechnet hatte. Gebannt lauschte ich den Schilderungen über seine Odyssee als Flakhelfer in Breslau zum sicheren Murrhardt. Er hatte wirklich mehr Glück als Verstand. Die meisten Mitschüler seiner Klasse waren ebenfalls zu den Flakhelfern nach Breslau abkommandiert worden. Er mit Abstand der kleinste und schmächtigste von allen. Es sollte seine Rettung werden. Eines Tages baute sich der Kompaniechef beim Morgenappell vor ihm auf und sagte: „Mensch, du bist ja so klein, dass du nicht mal über den Schützengraben rausgucken kannst, da brauchen wir ja eine extra Leiter für dich. Du bist uns hier nur im Weg, sieh dass du heimkommst zu Muttern!“ Sprach’s und stellte ihm einen vorläufigen Entlassungsschein nach Leipzig aus. Dort meldete er sich als Deutschlands letzte Wunderwaffe im Aufgebot gegen den Volksfeind auch brav auf der Ortskommandantur. Ein zufällig anwesender Feldwebel nahm sich seiner dankbar an: „Du kommst gerade recht, wir stellen eben eine Einheit zusammen, die an die Ostfront verlegt wird.“ In diesem Augenblick klingelt das Telefon. Der Feldwebel, den Hörer am Ohr, schlägt die Hacken zusammen: „Jawohl Herr Major, komme sofort Herr Major!“, wirft den Hörer auf die Gabel und befiehlt beim Verlassen des Zimmers barsch: „Du wartest hier!“ Kurz darauf betritt ein Hauptmann das Zimmer; er betrachtet den Dreikäsehoch in Uniform ausgiebig von oben bis unten: „Was in aller Welt willst du denn hier?“ „Ich soll an die Ostfront verlegt werden, Herr Hauptmann.“ Der Offizier lässt sich auf den Stuhl hinter dem Schreibtisch fallen. „Du lieber Himmel, jetzt sollen wir schon mit Kindern den Krieg gewinnen! Wo steckt denn die Familie?“ Minuten später verlässt der Bruder mit einem Entlassungsschein nach Stuttgart in Windeseile die Kommandantur, ehe es sich irgendein Endsieg-Enthusiast noch einmal anders überlegen könnte. Breslau war inzwischen zur Festung erklärt worden. Von allen Schulkameraden, letztendlich ja alles noch Kinder wie er, sollte keiner überleben. Sie waren einfach ein paar Zentimeter zu groß …
Natürlich kannte der Jubel in Murrhardt keine Grenzen. Die Mutter war in Tränen aufgelöst; erst ganz allmählich wich die Anspannung der letzten Monate: Nur nicht neben dem Mann auch noch den Sohn im Krieg verlieren!
Ende April schlugen auch in Murrhardt die letzten Stunden des Großdeutschen Reiches. Die Amerikaner näherten sich dem kleinen Städtchen – eigentlich ja nur eine zu vernachlässigende Randerscheinung ihres schnellen Vormarsches. Unglücklicherweise lagen aber in den Wäldern um die Stadt versprengte Einheiten der Waffen-SS. In heroischer Nacht- und Nebelaktion sprengten sie ein wenige Meter langes Brückchen, das über die Murr führte. Dieses Rinnsal war eigentlich das ganze Jahr über bequem auch zu Fuß zu durchwaten, ohne dass das Wasser die Knöchel nennenswert überspült hätte. Kurzum, die strategische Bedeutung dieses Brückchens nebst Bach stand in keinerlei Verhältnis zu der Hingabe, mit der sich die SS dieser absurden „Verteidigungsmaßnahme“ annahm. Dafür fiel die Antwort der Amerikaner für Murrhardt umso drastischer aus: Das Städtchen wurde mit Brandgranaten beschossen. Währenddessen saß die Familie nebst den Geschwistern Horn bei Kerzenlicht im Keller und zuckte bei jedem Granateneinschlag zusammen. Es war das ungute Gefühl, völlig machtlos dem ausgesetzt zu sein, was da von draußen jeden Moment auf jeden einzelnen zukommen könnte: Qualvolles Leiden, schneller Tod oder nichts von allem? Nach einigen Stunden ließ der Beschuss nach, verebbte schließlich ganz. Der Bruder hatte sich nach draußen gewagt und kam bald mit der Nachricht zurück: Murrhardt brennt. Löschversuche hatte er nicht beobachtet. Man entschloss sich umgehend, noch in der Nacht mit dem nötigsten Gepäck hinauf in den kleinen bäuerlichen Weiler Waltersberg, oberhalb Murrhardt, zu begeben. Die Geschwister Horn kannten dort einen Bauern, der ihnen schon in der Vergangenheit mit seinen landwirtschaftlichen Produkten immer wieder ausgeholfen hatte, wenn ihr Lebensmittelkartendeputat erschöpft war. Diese Flucht in der Nacht mit Blick zurück auf das lichterloh brennende Murrhardt mit krachend einstürzenden Dachgiebeln und grell in den Nachthimmel aufschießenden Flammen und Funkenregen war ebenso unvergesslich wie der beißende Gestank nach verbranntem Holz, der in dichter Wolke über dem Städtchen hing. All das war so schaurig faszinierend, dass die Mutter die Kinder immer wieder antreiben musste, nicht stehen zu bleiben. Als Jahre später im Geschichtsunterricht der von Nero angezettelte Brand von Rom erörtert wurde, kam ich nicht umhin, in Erinnerung an die nächtlichen Bilder vom Brand in Murrhardt, diesem Despoten ein beachtliches Maß an Sinn für schaurig schöne Inszenierungen zuzubilligen.
Am nächsten Morgen sah man von Waltersberg aus immer noch den Rauch über der Stadt im Tal. Die Amerikaner waren rasch weitergezogen, man ging wieder zurück in das praktisch unbeschädigte Haus am Markt. Nur ein vom Granatsplitter durchbohrtes Eisenblech an der Eingangstüre zum Wohntrakt war am Haus selbst wie ein Wundmal von den Ereignissen der vergangenen vierundzwanzig Stunden zurückgeblieben. Wenige Meter vom Haus entfernt, auf der Seite zur Schule, riss eine Granate einen tiefen Trichter auf und einige Häuser am Markt waren bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Es herrschte eine gespenstische Stille, allerdings nur von kurzer Dauer. Die Amerikaner waren bis auf einige wenige verbliebene Posten abgezogen. Ihnen folgten Franzosen, sogenannte De Gaulle’sche Vergeltungstruppen, die sich zunächst über die restlichen Weinvorräte im Städtchen, dann – von Siegesrausch und Alkohol beflügelt – vereinzelt auch über einige Frauen der Bevölkerung hermachten. Dabei hatten die Gastwirte, in weiser Voraussicht, schon Tage zuvor, die meisten Weinvorräte kostenlos an die Murrhardter ausgeschenkt. Noch gut in Erinnerung, dass ich mehrmals mit einer Milchkanne bewaffnet, beim Gasthaus „Zum Engel“ am Marktplatz auf Anweisung der Geschwister Horn zwecks Unterstützung der Alkoholvernichtung aufgekreuzt bin. Damals allerdings noch unfähig, diese großzügige Spende gebührend zu würdigen: Das Gebräu schmeckte furchtbar! Den Geschwistern Horn war das um weitere Ingredienzien wie Honig und Nelken angereicherte Naturprodukt, leicht erhitzt im Sinne einer Art Glühwein, als Hausmittel sehr willkommen.
Die Herren aus Frankreich erwiesen sich zunächst nicht sehr chevalresque. Sie begannen zu plündern und vereinzelt in unsinniger Zerstörungswut Möbel aus den unbeschädigt gebliebenen Häusern auf die Straße zu werfen. Die ältere Schwester auf dem Dachboden zu verstecken erschien unter diesen Gegebenheiten keine übertriebene Vorsichtsmaßnahme. Kurz darauf betraten auch schon einige französische Offiziere das Haus und erklärten die Wohnräume im Erdgeschoss für beschlagnahmt: Rekrutiert für eine Art Ortskommandantur. Man wusste die wenigen Französischbrocken, die der ältere Bruder aus dem Gymnasium herübergerettet hatte, durchaus zu schätzen. Dass er einmal als Soldat eingezogen worden war, kam ihnen gar nicht in den Sinn: Sie mussten sich ja geradezu zu ihm herunterbücken, wenn sie ihre Hand auf seinen Kopf legen wollten. Die Einquartierung erwies sich bald in mehrfacher Hinsicht als vorteilhaft. Jetzt waren Haus und Laden vor Plünderungen sicher. Eine kleine, an die Hausecke gemalte Trikolore diente als Zeichen des Sonderstatus, den das Haus ab sofort genoss. Nach wenigen Tagen hatten sich alte und neue Bewohner bei „Horn am Markt“ soweit aneinander gewöhnt, dass sich der Umgang zunehmend freundlicher gestaltete. Neben einigen Schokoriegeln wechselte ein ganzes Päckchen Kaugummi den Besitzer. Damit lüftete sich endlich das Rätsel um die dem Hornvieh ähnelnden permanenten Kaubewegungen, die ich Tage zuvor bei den gefangen genommenen Amerikanern noch nicht einzuordnen wusste.
Solch sich behutsam entwickelnden zarten Triebe erster Völkerverständigung zwischen Siegern und Besiegten ließen den Entschluss reifen, das Mädchenversteck aufzugeben. Dies natürlich nicht ohne ausgiebige verbale Vorbereitung. Die Offiziere fanden das alles sehr lustig, als die Schwester aus der Versenkung auftauchte und man war natürlich froh, dass sie das Versteckspiel nicht übel nahmen.

Eines Tages fuhr vor dem Hotel „Sonne-Post“ eine stattliche Anzahl von Nobelkarossen mit Mercedes-Stern auf der Kühlerhaube vor. Zum damaligen Zeitpunkt ein an Zahl und Glanz höchst ungewöhnlicher Aufmarsch deutscher Präzisionsarbeit. So drückten sich alsbald zahlreiche Kindernasen an deren Autoscheiben platt. Es sollten viele Monate vergehen, bis die Öffentlichkeit erfuhr, dass damals – mit Einverständnis der Alliierten – einige kluge deutsche Köpfe hier zusammentrafen, um die Grundzüge der neuen Verfassung des Landes Württemberg auszuarbeiten. Unter ihnen neben Carlo Schmid auch ein junger Mann namens Huber. Später Landrat des Ostalbkreises. Ich besuchte ihn kurz vor seinem Tod im Aalener Krankenhaus. Es gelang, dem müden alten Mann noch ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, als die Rede dies historische Ereignis streifte. Eine kleine Messingtafel erinnert an jenem Haus in Murrhardt an diese für das Land Württemberg historisch bedeutsame Zusammenkunft.
Die „Sonne-Post“ war damals aus noch ganz anderen Gründen bedeutsam. Es war der einzige Gasthof weit und breit, in dem zu jener Zeit wenigstens ab und zu – auf Lebensmittelmarken versteht sich – einigermaßen preiswert eine Mahlzeit eingenommen werden konnte, die diesen Namen ehrlich verdiente. Das heißt, es gab dort eine Bratwurst, die zwar höchstens zu etwa zehn Prozent aus Wurst bestand, aber die restlichen neunzig Prozent Brot, Kartoffeln und Quark waren so hervorragend gewürzt, dass man mindestens eine halbe Stunde anstehen musste, ehe man in der Gaststube einen Platz eroberte, um diesem Wunder schwäbischen Erfindungsgeistes die Ehre erweisen zu können. Es lag in der Natur damaliger Rationierungszwänge, dass dieses Bratwurst-Event beileibe nicht täglich und wenn, dann auch nur zeitlich sehr begrenzt zelebriert werden konnte. Da fügte es sich glücklich, den gleichaltrigen jüngeren Sohn des Wirtes als Spielkameraden zu haben. Es garantierte einen nicht zu unterschätzenden Informationsvorsprung bezüglich der Speisekarte. Beide Söhne dieses Wirtes namens Bofinger blieben in der Tradition der Familie und bewirtschafteten später im Neubau einen ganz hervorragenden, weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten Landgasthof. In diesem, aber auch schon zuvor im alten Gasthof, beobachtete ich gelegentlich einen Herrn namens Hans Bayer, wie er gemütlich vor einem Glas Rotwein sitzend, eifrig und gelegentlich schmunzelnd, mit einem Bleistift Notizen zu Papier brachte. Als seltsame Marotte war dessen Stammplatz regelmäßig durch eine bunte Kordel isoliert von jedweder Nachbarschaft abgegrenzt. In kindlicher Unbekümmertheit sprach ich die alte Frau Bofinger hinter der Theke auf dieses Kuriosum an. Noch heute präsent, der aus ihrem Dirndl wogende gewaltige Busen der alten Dame, als sie sich zu mir herunterbeugte, um zu erklären: „Bua, des verstoscht du net – der schreibt für Deutschland!“ Nun war ich um einen feuchten Traum reicher, aber, die Kordel betreffend, arm an Erkenntnis wie zuvor. Bekannt wurde der so sorgsam Eingehegte unter seinem Künstlernamen Thaddäus Troll. Mit unnachahmlich trockenem schwäbischem Humor schuf er so wunderbare Bücher wie „Deutschland, deine Schwaben“ oder „Der Entaklemmer“. Humorist und Clown haben nicht selten gemeinsam, dass es in ihrem Inneren gar nicht so lustig aussieht wie man vermuten möchte. Das galt auch für diesen Literaten, der als Nationalsozialist sich später nie verziehen hat, diesem Ungeist mutig entgegengetreten zu sein. Ihn plagten furchtbare Depressionen. Da sich Antidepressiva nicht mit Alkohol vertrugen, verbot ihm seine Ärztin den regelmäßigen Schoppen Rotwein. Am 5. 7. 1980 setzte sich dieses Denkmal deutscher Literatur mit einer Überdosis Schlaftabletten selbst ein Ende. Keiner hat den Schwaben, scharf beobachtend, bissig formuliert mit so viel Herz eingewickelt porträtiert wie er. In seinem Abschiedsbrief bat er, statt um Blumen oder Nachrufe, um eine Spende für „Pro Asyl“. Auf dem Sitzplatz hinter der Kordel in der „Sonne-Post“ zu Murrhardt war ich einem Mensch begegnet, von dem ich nicht ahnen konnte, wie viel uns im Geist miteinander verband. Ein Geist, der Jahrzehnte später Europa und teilweise auch meine geliebten Schwaben spalten sollte. „Arschlöcher gibt’s überall!“ wäre vermutlich sein freimütiger Kommentar dazu gewesen.
Obwohl sich 1945 die Versorgung mit Lebensmitteln in diesen ländlichen Regionen ungleich unproblematischer gestaltete als in den Großstädten, war auch im Hause „Horn am Markt“ diesbezüglich die Situation alles andere als rosig. Die Ankunft des Bruders verschärfte das Problem. Es bot sich deshalb an, den vielköpfigen Neuzugang dort unterzubringen, wo man in der Nacht des Feuerüberfalls schon einmal Zuflucht gefunden hatte: beim Bauern Bay in Waltersberg. Dieser stimmte zu und damit begannen für mich so etwas wie wie Ferien auf dem Bauernhof.