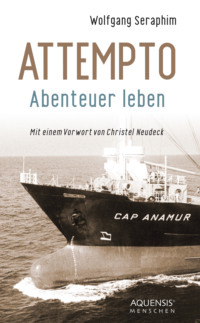Kitabı oku: «Attempto», sayfa 6
Auch die Möblierung des Esslinger Hauses war natürlich nicht auf die zusätzliche Unterbringung von vier Personen eingestellt. Im Gebrauchtmöbelmarkt wurden an Flüchtlinge und Sozialhilfeempfänger kostenlos Einrichtungsgegenstände ausgegeben, die sich allerdings in einem solch traurigen Zustand befanden, dass ihre Integrierung in das eigene Lebensumfeld große Überwindung kostete. Im Volksmund sprach man von „Wanzenholz“, das vor Aufstellung in der Wohnung erst peinlicher Säuberung mit Lauge und Wurzelbürste unterzogen werden musste. Aber es war natürlich besser als nichts. Obendrein für die Stadtväter zu damaliger Zeit eine beachtliche Leistung, solch eine Einrichtung auf die Beine zu stellen. Viele Jahre später landete eine Kommode dieser Herkunft, blau angestrichen, in meinem ersten Hausstand. Sie blieb mir auch bei mehreren Umzügen treu.
Provisorien, laut Stresemann durch besondere Langlebigkeit charakterisiert, dominierten das Zeitgeschehen. Es galt nicht nur für Besiegte. Auch Sieger mussten sich damit auseinandersetzen. Als provisorisch entpuppte sich zum Beispiel auch der Einzug des französischen Militärs in die Funker-Kaserne, die sie schon vor Monaten in Beschlag genommen hatten. Eines Nachmittags fuhren amerikanische Armeefahrzeuge vor die Kaserne, denen der Einlass verwehrt wurde – die Schranke blieb geschlossen. Gespannt harrte ich mit Spielkameraden der Dinge, die da kommen sollten. Es entwickelten sich allerlei diplomatische Aktivitäten. Französische und amerikanische Offiziere redeten heftig gestikulierend aufeinander ein. Die Amerikaner bemühten ihr Feldtelefon, offensichtlich mit dem Ziel, sich höheren Orts bezüglich des weiteren Procedere abzustimmen. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Der amerikanische Konvoi zog sich um einige Meter zurück. Sandsäcke wurden aus den Lastkraftwagen abgeladen, zu einer Barrikade aufgeschichtet und einige Geschütze dahinter in Stellung gebracht – Zielrichtung Kaserne. Die Kinderschar hielt es jetzt für angemessen, den Rückzug anzutreten. Zwar nicht restlos, dafür war die Angelegenheit viel zu spannend. Aber doch in einen zurückliegenden Garten, aus dem der weitere Verlauf beobachtet werden konnte. Die Geschütze waren offensichtlich zunächst nur als Drohgebärde gedacht, sie wurden wohl noch nicht einmal geladen, verfehlten aber doch nicht ihre Wirkung. Nach ungefähr einer halben Stunde, die wie eine Ewigkeit vorkam, erschienen am Kasernentor einige französische Offiziere in schicken Uniformen mit ordensgeschmückter Brust und einer weißen Fahne. Die amerikanischen Offiziere beschränkten sich auf schlichtes Olivgrün, verzichteten auch auf jegliche Fahne und traten erneut in Verhandlungen ein, die jetzt aber sehr kurz ausfielen. Die Franzosen gewährten Einlass und räumten am Tag danach sang- und klanglos das Feld. So alliiert, wie es das Wort vorgibt, waren die Alliierten wohl doch nicht. Zumindest gab es vereinzelt Schnittstellen, die Irritationen hervorriefen, wie das Gesehene zeigt.
Kurz darauf begannen die Amerikaner Wohnungen für ihre Offiziere in der Flandernstraße zu requirieren. Ihr Vorgehen war nicht gerade zimperlich. Sie klingelten auch am Haus der Großmutter, murmelten Unverständliches in ihren nicht vorhandenen Bart, schoben die Bewohner einfach zur Seite und stapften durch das ganze Haus. Es missfiel offensichtlich das fehlende Bad, weshalb sie wortlos wieder abzogen. In Krisenzeiten kann eine bescheidene Raumausstattung ungeahnten Vorteil bedeuten. Gegenüber wohnenden Nachbarn ging es weniger gut: Zwei Häuser mussten innerhalb vierundzwanzig Stunden geräumt werden. Den Herren Siegern war schnuppe, wo die Besiegten Unterschlupf finden. In eines der Häuser durften die Besitzer nach zwei Jahren wieder einziehen, das andere blieb länger beschlagnahmt. In ihm wohnte noch viele Jahre ein amerikanischer Offizier mit Weib und zahlreicher Kinderschar. Letzteren bereitete es besonderes Vergnügen, das Autodach des Vaters zu erklimmen und als Trampolin umzufunktionieren. Das Blech bog sich wie eine zusammengedrückte Schuhcremedose und schnellte mit metallischem Klirren wieder nach oben. Die Kinderseele jauchzte. Alle vier Wochen rückte der Vater dem Haarwuchs seiner Söhne zu Leibe. Er bediente sich eines Maschinchens, das in wenigen Minuten Kind für Kind zu einer Glatze verhalf. Je nach Wetterlage fand die Schur vor der Haustüre oder in der Wohnung statt. Amerika präsentierte sich nicht als Hort besonders gepflegter Konventionen. Aber es beeindruckte doch ein Stück weit durch viel ungeniert offen zur Schau gestelltes Selbstverständnis.
Die Segnungen des Marshallplanes sollten erst später ihre Wirkung entfalten. So auch die nach Herrn Hoover benannte Schulspeisung. Wie der Name sagt, bedurfte es zur Erlangung solcher Köstlichkeit des Schulbesuchs. Der führte in die am Marktplatz gelegene Esslinger Waisenhofschule. Sie konnte von zuhause über die Beutauklinge oder, etwas romantischer mit kleinem Umweg, über die Burg erreicht werden. Weglänge ca. 2 km bergab auf dem Hinweg. Der Rückweg geriet bergauf etwas zeitaufwendiger. Neben dem Tornister mit Schiefertafel – Papier war zunächst noch Mangelware – und einigen zerfledderten Lehrbüchern aus der Kriegszeit, gehörte im Winter die Spende von einem Brikett oder ähnlich Brennbarem pro Schüler zur Wegbegleitung. Letzteres blieb mangels Masse oft nur ein frommer Wunsch. Schließlich fror man in den eigenen vier Wänden schon erbärmlich. Mein Beitrag bestand schwerpunktmäßig im Einsammeln von nachts abgebrochenen Zweigen auf dem Weg zur Schule. Bei Schnee und Regen das richtige Substrat, um dem gusseisernen Koloss im Klassenzimmer statt Wärme gewaltige Rauchschwaden zu entlocken. Zumal die Heizungsspenden der Schulkameraden qualitativ ähnlich dürftig ausfielen. Bei Sonnenschein und klirrender Kälte sorgte die über dem Schornstein geringfügig erhöhte Wärme, dass der Ofen auch da nicht ziehen wollte. Sozusagen angewandte Physik in Sachen Thermik und deren Einfluss auf die Ausdehnung von Gasen. Die kleinen Wölkchen ausgeatmeter Luft verschwanden in den gewaltigen, dem Ofen entweichenden Rauchwolken. Alsbald tränten die Augen, setzten Hustenattacken ein. Im Eiltempo aufgerissene Fenster verhinderten eventuelle Evakuierungsmaßnahmen. Man war nicht verwöhnt und zitterte sich warm. Dabei half die drangvolle Enge von über 40 Kindern in dem kleinen Klassenzimmer. Der sich dabei langsam entwickelnde Mief trug zu wohlig allumfassendem Gemeinschaftsgefühl bei. In der großen Pause stürmte die hungrige Meute, das mitgebrachte Essgeschirr unter dem Arm, zu den Futtertrögen im Schulhof. Eine wahrhaft segensreiche Spende aus Amerika, die sich mit dem Namen „Hoover’sche Schulspeisung“ einen unauslöschlichen Ehrenplatz in uns Kindern eroberte. Klassenweise geduldig eine Schlange bildend, sah man erwartungsvoll den Köstlichkeiten entgegen, die jeder portionsweise zugeteilt erhielt. In der Hoffnung, eventuell einen Nachschlag zu ergattern, stellte man sich, fleißig aus dem Napf löffelnd, umgehend hinten wieder an. Der Speisezettel war nicht sehr abwechslungsreich: Erbsensuppe, Reispampe, Haferflockenbrei mit Kakao, sowie eine atemberaubende Kombination von einem Stück fetten Speck mit einer Dampfnudel und einer süßsäuerlichen lila Soße. Deren Farbe hätte jedem Kreuz auf der Fahne eines Kirchentages zur Ehre gereicht. Alles schmeckte herrlich, und wer glücklicher Besitzer eines Kochgeschirrs aus alten Heeresbeständen war, brachte vom eventuellen Nachschlag noch eine Kleinigkeit mit nach Hause.
Es war eben alles ein wenig ärmlich, aber die Masse der Habenichtse von wohltuender Homogenität. Diese Einheit in Armut war friedensstiftend. Der Blick zum Nachbarn ließ keinen Neid aufkommen. Nur einmal im Winter beim Schlittenfahren unterhalb des Waisenhauses fühlte ich mich etwas verlassen und ausgegrenzt. Niemand war bereit, mich wenigstens einmal den Berg runterrutschen zu lassen. Ein lächerlich kindlicher Schmerz. Und doch, 60 Jahre später, immer noch erstaunlich gegenwärtig.
Schwimmen, die andere spielerische Form der Fortbewegung, lag der Mutter bei ihrem Sohn besonders am Herzen. Fünf Reichsmark wurden in einen Kurs investiert. Nun schwebte der Adlatus im Merkel’schen Schwimmbad beim Bademeister an der Angel. Anfänglich noch mit Schwimmflügeln legte man sich mit dem Bauch auf dem von der Angel getragenen Gurt und erlebte überrascht, wie die sinnvolle Koordinierung von Arm- und Beinbewegungen, begleitet von vernünftiger Atemtechnik, zu angenehm dahingleitender Vorwärtsbewegung führte – fern von hastig nach Luft japsender Zappelei. Die Luft entwich langsam den immer schmalbrüstiger werdenden Schwimmflügeln, bis sie völlig überflüssig wurden. Der Gurt unter dem Bauch hing nicht mehr so straff an der Angel, und nach wenigen Übungsstunden reichte es, wenn sich der Bademeister irgendwo in Sichtweite aufhielt. Selten haben sich fünf Reichsmark als so segensreiche Investition erwiesen. Was wären all die späteren Ferienerlebnisse ohne ihr schwimmendes Badevergnügen gewesen?!
Meine Geschwister sollten das Gymnasium besuchen. Die höheren Lehranstalten waren jedoch 1946/47 in Esslingen noch nicht so richtig in Schwung geraten. So landeten sie auf der Schwäbischen Alb in einem Internat in Urspring, nicht weit von Schelklingen bzw. Blaubeuren und Ulm entfernt, damals in der französisch besetzten Zone gelegen. Zu häuslichen Besuchen in Esslingen war ein Passierschein erforderlich, den zu erlangen es einiger bürokratischer Klimmzüge bedurfte. Grund genug die Grenzüberschreitung, manchmal auch bei Nacht, heimlich still und leise, ohne Passierschein zu bewerkstelligen.
Bei einem Ferienaufenthalt in Esslingen gelang es dem Bruder, im hinteren Teil des Gartens einen Hühnerstall zu errichten. Das dazugehörige Federvieh wusste, was sich gehörte: Die Hennen legten fleißig Eier, die Hähne landeten im Kochtopf. So sorgte jedes Tier auf seine Weise für die dringend benötigte Eiweißzufuhr. Dennoch, wie schon beschrieben, die Folgen der Mangelernährung waren unübersehbar. Ich absolvierte innerhalb weniger Monate die schon beschriebene Rallye durch fast alle gängigen Kinderkrankheiten. Der Hausarzt beantragte eine Kindererholungskur im Otto-Hofmeister-Haus auf der Schwäbischen Alb. An diese wohlmeinende Initiative knüpfen sich allerdings keine erfreulichen Erinnerungen. Die für das leibliche Wohl zuständigen Rotkreuzschwestern ließen mit hartnäckiger Regelmäßigkeit jeden Morgen, den Gott werden ließ, eine aus dünner Magermilch gefertigte Milchsuppe anbrennen. Deren Produkt waberte ganztägig durch die lieblos kasernenähnlichen Räume. Zusätzlich plagte mich nicht ganz Elfjährigen ein kaum zu stillendes Heimweh. Es mündete, zu meinem Entsetzen, in nächtliches Bettnässen. Um die Blamage zu vervollständigen, blieb das Malheur in dem großen Schlafsaal nicht verborgen. Zum Schaden gesellte sich somit der Spott, der das Heimweh noch heftiger beflügelte. Zu allem Überfluss lief ich mir auf einer der zahlreichen Waldspaziergänge in den wieder einmal zu eng gewordenen Schuhen auch noch eine Blase an die rechte Großzehe. Sie vereiterte und zog eine mehrtägige Bettruhe nach sich. Während dieser Zwangspause genas ich eines prächtigen Bandwurmes, der sich plötzlich in der Toilettenschüssel fand. Zum Dank für diese Tortur durfte abschließend noch ein möglichst individuell gestalteter Dankesbrief an die Spender dieses „Jugendglücks“ nach Amerika auf den Weg gebracht werden. Ich schrieb mich in einen wahren Dankesrausch. Weder früher noch später konnte ich mich erinnern, einmal so ausdauernd inbrünstig gelogen zu haben.
Nach vierjähriger Volksschulzeit war eine Aufnahmeprüfung für das Gymnasium fällig, die ich auch bestand. Trotzdem empfahl man, noch ein Jahr Volksschule anzuhängen: In den drei Zügen der Sexta herrschte mit je 50 Schülern drangvolle Enge. An einen vierten Zug war wegen Lehrermangels nicht zu denken. Im Herbst 1947 erfolgte dann der Wechsel auf das humanistisch orientierte Georgii-Gymnasium – es sollte für die nächsten Jahre der Beginn eines schmerzlichen Leidensweges werden.
1947 – 1953
Das Gymnasium – Via dolorosa: „Wolfgang ist fleißig, aber dumm“
Die in der Volksschulzeit gepflegte Leichtigkeit des Seins zerschellte mit Eintritt in die höheren Weihen der Wissensvermittlung, dem Esslinger Gymnasium. 1947 erwies sich die Besetzung mit fachkompetenten Lehrern als ausgesprochen schwierig. Die Lücken des Zweiten Weltkrieges hatten auch in diesem Versorgungszweig heftige Schleifspuren hinterlassen. Ungemach drohte zunächst durch einen Lehrer namens Haug. Ursprünglich für den Schulsport ausgebildet, sollte er, mangels anderer Ressourcen, den Erstklässlern die Geheimnisse der Mathematik näherbringen. „Ständer, Bänder, Ball und Leine, wer nicht spurt, der fängt gleich eine!“ lautete sein bevorzugtes Sprüchlein, wenn er die Besorgung der notwendigen Utensilien anforderte, ehe es auf den Schulhof zum Turnunterricht ging. Diese hemdsärmelige Art wusste er auch in seinen Mathematikunterricht einfließen zu lassen. Seine besondere Vorliebe galt dem großen Einmaleins, das er nicht müde wurde, mit viel Hingabe regelmäßig abzufragen. „Acht mal neunzehn ist?“ Dabei steigerte sich die sonore „acht“ zu einem Crescendo mit in zwei Oktaven höheren Tremolo ausgestoßenen „ist“, womit er sich, zwischen den Stuhlreihen laufend, blitzartig umdrehte und das zunächst sitzende Opfer mit dem Zeigefinger, gleich einer Harpune, beinahe das Brustbein durchbohrend anfunkelte. Der so Aufgeforderte rutschte erst mal zwecks Abfederung des Dolchstoßes einige Zentimeter nach unten. Nach Luft ringend rappelte man sich hoch. Während man noch verzweifelt nach der richtigen Lösung forschte, wurde, zum Zwecke der Beschleunigung des Denkvermögens, das Ohrläppchen des also inquisitorisch Befragten zwischen zwei Fingern langsam um neunzig Grad gedreht. Danach genüsslich entgegen dem Uhrzeigersinn nach oben gezogen. Dieses sicher nicht bei Pestalozzi abgeschaute Erziehungsritual brachte dem Wissensvermittler den Spitznamen „der Lappen“ ein. Wie zu erwarten, fiel mir bei derlei Prozeduren nur selten das richtige Ergebnis ein. Im Gegenteil: Wenn ich kurz zuvor noch mühelos die richtige Antwort hätte geben können – der bohrende Finger auf der Brust, das Ziehen am Ohrläppchen führten zu kompletter Ladehemmung. Gefolgt von einem „mangelhaft“ im allzeit bereit gehaltenen Notizheft des Großinquisitors.
Bei tagelangen Fußmärschen mit einem kleinen einachsigen Wägelchen über die Hochfläche der Schwäbischen Alb zum Zwecke der Kartoffelrequirierung erteilte die Mutter Nachhilfeunterricht und fragte ab. Im Rahmen dieser Fortbildungsaktion ergab sich auch die überraschende Erkenntnis, dass sich das große Einmaleins ganz mühelos durch Addition zweier Zahlen des kleinen Einmaleins, zum Beispiel acht mal zehn plus acht mal neun, beherrschen ließ – ganz ohne Auswendiglernen. Soviel Didaktik überstieg die Möglichkeiten eines Turnlehrers. Leider war das große Einmaleins nach dieser fußläufig gewonnenen Erfahrung nicht mehr sehr gefragt. Aber bekanntlich lernt man ja nicht für die Schule, sondern fürs Leben …
Auch als etwas anspruchsvollere Rechenkünste gefragt waren, wuchsen meine Fähigkeiten leider nicht mit den Anforderungen. Tage vor einer angekündigten Mathearbeit garnierte ich meine Nachtruhe mit Albträumen. Morgendliches Zähneputzen geriet zur ekeligen Würgerei. Deutsch und Sprachen fielen bedeutend leichter, allerdings ohne nachweisbare Höhenflüge. Im Gegenteil: Mit dem Aufsatzthema „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Denn das unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen“, nahte das Unheil. Blauäugig glaubte ich das Thema dergestalt erschöpfend beantworten zu können: „Ich habe mir das gut überlegt: Es stimmt!“ Kurzzeitig der aberwitzige Traum, der Deutschlehrer könne dankbar die an Kürze kaum zu überbietende Pflichterfüllung mit einem anerkennenden Bonus belohnen. Seine mit roter Tinte erfolgte Benotung zeigte Galgenhumor statt Dankbarkeit: „Ich habe mir das gut überlegt: mangelhaft! Es stimmt.“ Nun galt es die Reißleine zu ziehen, ehe das Projekt Gymnasium endgültig baden geht. Von der karg bemessenen Sozialhilfe musste für den dusseligen Sohn auch noch Geld zur Nachhilfe abgezweigt werden. Was für eine Blamage! Sie wog umso schwerer, als die älteren Geschwister in Urspring mühelos von Erfolg zu Erfolg schwebten, was dem Strauchelnden als leuchtendes Fanal vor Augen stand. Nicht minder bitter das traurige Gesicht der Mutter, wenn es galt, wieder einmal miserabel ausgefallene Klassenarbeiten beichten zu müssen. Nachhilfe in Mathematik zum Nulltarif erteilte ein treuer Freund aus der Nachbarschaft, Rolf Bauer, zwei Klassen weiter im Gymnasium als ich. Unermüdlich opferte er ganze Wochenenden, um in die Geheimnisse von Algebra und analytischer Geometrie einzuweisen. Die Ochserei wurde gelegentlich durch eine Partie Tischtennis unterbrochen. Als Tischtennisplatte diente der beidseitig ausgezogene, vor der Küchentüre aufgebaute Esstisch der Großeltern. An darüber gespanntem Bindfaden baumelte ein Stück gefaltetes Zeitungspapier als Netzersatz. Die Tischtennisschläger waren das Produkt feinster Laubsägearbeit. Nur die Tennisbällchen mussten käuflich erworben werden – sie wurden wie ein Augapfel gehütet.

Unweit der Wohnung residierte ein alter, pensionierter Deutschlehrer namens Hanselmann. Ein Mensch, staubtrocken und voller Pflichterfüllung. Hier galt es in vorgegebenen Aufsatzthemen weitschweifiges Erklären einfacher Sachverhalte zu verinnerlichen. Man könnte es auch salbadern oder schwafeln nennen. Da reichte es nicht, dass auf einem Kamin Nippes stand – die „Abstäuberle“ mussten haarklein detailliert beschrieben werden. Die Mannigfaltigkeit der deutschen Sprache galt es dabei penibel auszuloten – Thomas Mann wäre vor Neid erblasst. Positiver Ausfluss solcher Mühewaltung: Die Schulaufsätze bekamen ihre gebührende Länge, aber keineswegs auch die angemessene Tiefe. Bei ihrer Benotung gab es noch viel Luft nach oben. Kurzum: Die Zeit für einen Anruf vom Nobel Komitee zwecks Verleihung des Literaturpreises war noch nicht gekommen. Aber als er viele Jahre später einmal den Kernbeitrag in einem „ZEIT-Magazin“ über seinen Auslandseinsatz in Somalia gestalten durfte, streichelte die Mutter gerührt, beinahe zärtlich, über das bedruckte Hochglanz-Cover des Magazins: „Da war der Nachhilfeunterricht bei Lehrer Hanselmann doch zu etwas gut gewesen!“ Nach so viel Kummer, den er in seiner Schulzeit der Mutter bereitet hatte – was für eine stille Freude bei Mutter und Sohn.
Zwei andere Lehrer des Georgii-Gymnasiums blieben noch bedeutsam. Musiklehrer Hoffmann, ein für den Schulbetrieb viel zu weichherziger Mann, dem es kaum gelang, sich disziplinarisch durchzusetzen. Er verstand meisterhaft, bestimmte musikalische Passagen von Mozarts „Zauberflöte“ im Kontext zur Handlung der Oper aufzuzeigen. Ebenso bei Carl Maria von Webers „Freischütz“. Unendlich ärmer mein Leben ohne diese Öffnung für die Klassik! Wenn es Momente der Dankbarkeit gibt, die mich an die Schulzeit erinnern, dann ist dieser Musiklehrer untrennbar damit verbunden. Musik ist der Anker der Seele. Er legte das für mich später so empfundene Fundament.
Bullig und von wuchtiger Kompetenz Herr Rau – Spitzname „Ralle“ – den eine angeblich allzu braune Vergangenheit von einer altsprachlichen Dozententätigkeit an der Universität Tübingen in das Esslinger Gymnasium gespült hatte. Es hieß, er sei 1945 in Tübingen zum Straßenkehren abkommandiert worden. Im Georgii-Gymnasium unterrichtete er dann Altsprachen und Geschichte – auf beiden Positionen von allen Schülern eine voll anerkannte Autorität. Brillant sein Geschichtsunterricht, in dem er mühelos von der Antike in die Neuzeit und wieder zurück wechselte. Historische Zusammenhänge waren wichtig und in diesem Kontext der Hinweis auf Parallelen querbeet durch den Lauf der Geschichte. Sein Credo: „Ihr müsst lernen, wie Geschichte tickt. Da ändert sich im Laufe der Jahrhunderte, was die Grundstrukturen betrifft, erschütternd wenig.“ Geschichtszahlen waren nebensächlich – „die könnt ihr bei Bedarf in Tabellen nachschlagen. Aber beginnt ein Herrscher vom Gottesgnadentum zu schwadronieren, dann geht’s ganz schnell bergab. Erst mit dem Herrscher, dann mit seinem Volk – oder umgekehrt.“ Es gab keine Beanstandungen an den Zensuren, sein Ruf in puncto Objektivität war legendär.
In sechs Jahren Gymnasium brachte ich es auf stolze fünf Blaue Briefe des Inhalts, meine Versetzung sei gefährdet. Die Mutter konnte das zuletzt schon blind unterschreiben. Doch der Kummer über den offensichtlich nicht sehr intelligenten Jüngsten blieb ein Stachel, auch im Herzen des Sohnes. Nicht nur die Diskrepanz zu den älteren Geschwistern, auch die Tatsache, dass ich trotz Fleiß auf keinen grünen Zweig kam, ließen das schulische Debakel in keinem freundlicheren Licht erscheinen. Ich durfte mich noch nicht einmal auf die fragwürdige letzte Bastion zurückziehen, dass schlichte Faulheit für das Versagen verantwortlich zeichnete. Dennoch: Nach sechs Jahren Gymnasium durfte ich mit Ach und Krach erfolgreich die Ziellinie der „Mittleren Reife“ passieren. Ebenso deutlich fiel die abschließende Beurteilung in meinem Zeugnisheft aus, die damals noch als eine Art „Summary“ üblich war. Dort stand in feiner Handschrift des Klassenlehrers in fünf dürren Worten: „Wolfgang ist fleißig, aber dumm.“ Mir erschien diese brutale, aber keineswegs unsachliche Beurteilung wie eine Hinrichtung. Vielleicht schlummert hier auch das Geheimnis, warum es gelang, nicht eine einzige „Ehrenrunde“ in sechs Jahren Gymnasium drehen zu müssen. Viel Mitleid mit dem „fleißigen Kerlchen“ könnte im Lehrerkollegium dazu geführt haben, sämtliche Augen, einschließlich der Hühneraugen, bei den Versetzungskonventen zuzudrücken. Wie auch immer – es war ein Wunder. Nachdem Wunder meist das Signum der Einmaligkeit zu tragen pflegen: Eventuell war die vernichtende Gesamtbeurteilung im Sinne eines unübersehbaren Zaunpfahls nur gut gemeint. Nach der Zeugnisübergabe nahm der Klassenlehrer, jener oben als Muster der Objektivität gepriesene Herr Rau, mich noch einmal ins Gebet: „Seraphim, duscht mer oin Gfalla: Goscht ronter von der Schual! Bis Du amol a Abitur hosch, flieagsch mindeschtens zwoimal durch, ond was fanget dia na mit dir amol auf der Universität a? Handwerk hat goldenen Boden!“
Süßer konnte der Balsam in meinen Ohren gar nicht klingen. Ich war’s schon lange leid, trotz aller Klimmzüge immer nur den „Bajas mit der Laterne“ zu geben. Viele Kameraden hatten schon die Schule verlassen und verdienten sich ein bescheidenes Taschengeld in der Lehre. Ich hatte zwar nicht die geringste Ahnung, welche Lehre das in meinem Fall sein könnte. Trotz des wenig rühmlichen Kurzurteils im Zeugnisheft mit anschließend verbaler Belehrung flog ich geradezu nach Hause, um der Mutter die geballte Verurteilung mit durchaus positiver Grundstimmung zu präsentieren. Die Mutter war fassungslos. Noch heute sehe ich sie nach meiner Beichte in der Küche stehend blitzschnell zu zwei Ohrfeigen ausholend. Eher Ausdruck des Abreagierens ihrer Hilflosigkeit als eine Strafaktion. Ich war sprachlos. Die Prügelstrafe war in der Familie absolut unüblich. Die letzte Ohrfeige lag Jahre zurück, nachdem in Freystadt beim Nachbarn ein zum Zweck der Kirschernte missbrauchtes Holzstück in dessen Fenster gelandet war. Über das Thema „Schulabbruch“ wurde danach nie wieder gesprochen. Ich bin der Mutter heute noch für diese zwei Ohrfeigen unendlich dankbar …
Einige Jahre später – ich war inzwischen Mitglied der Tübinger Studentenverbindung Roigel – standen sich früherer Lehrer und jetziger Student auf dem Verbindungshaus beim Stiftungsfest plötzlich Aug’ in Auge gegenüber. Wie vom Donner gerührt, starrten sie sich an, dann schüttelte der alte Herr traurig den Kopf: „Was sich heute alles auf der Universität herumtreibt – und Roigel ist der auch noch!“, sprach’s, machte auf dem Absatz kehrt und suchte das Weite …
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.