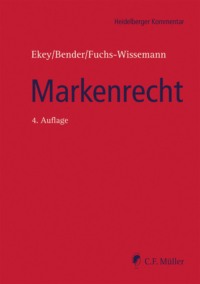Kitabı oku: «Markenrecht», sayfa 6
Kapitel I Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen › Teil 2 Voraussetzungen, Inhalt und Schranken des Schutzes von Marken und geschäftlichen Bezeichnungen; Übertragung und Lizenz
Teil 2 Voraussetzungen, Inhalt und Schranken des Schutzes von Marken und geschäftlichen Bezeichnungen; Übertragung und Lizenz
Inhaltsverzeichnis
Abschnitt 1 Marken und geschäftliche Bezeichnungen; Vorrang und Zeitrang
Abschnitt 2 Voraussetzungen für den Schutz von Marken durch Eintragung
Abschnitt 3 Schutzinhalt, Rechtsverletzungen
Abschnitt 4 Schranken des Schutzes
Abschnitt 5 Marken als Gegenstand des Vermögens
Kapitel I Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen › Teil 2 Voraussetzungen, Inhalt und Schranken des Schutzes von Marken und geschäftlichen Bezeichnungen; Übertragung und Lizenz › Abschnitt 1 Marken und geschäftliche Bezeichnungen; Vorrang und Zeitrang
Abschnitt 1 Marken und geschäftliche Bezeichnungen; Vorrang und Zeitrang
Inhaltsverzeichnis
§ 3 Als Marke schutzfähige Zeichen
§ 4 Entstehung des Markenschutzes
§ 5 Geschäftliche Bezeichnungen
§ 6 Vorrang und Zeitrang
§ 3 Als Marke schutzfähige Zeichen
(1) Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Klänge, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
(2) Dem Markenschutz nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen,
| 1. | die durch die Art der Ware selbst bedingt sind, |
| 2. | die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind oder |
| 3. | die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen. |
Kommentierung
I.Vorbemerkung1, 2
II.Regelungsinhalt des § 3 Abs 13 – 8
III.Ausschluss der Markenfähigkeit nach § 3 Abs 29 – 17
1.Allgemeines9 – 12
2.Durch die Art der Ware bedingt13
3.Zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich14, 15
4.Wesentlicher Wert einer Ware16, 17
Literatur:
Bauer Die Ware als Marke – Gedanken zur BGH-Entscheidung „Füllkörper“, GRUR 1996, 319; Berlit Schutz und Schutzumfang von Warenformmarken am Beispiel des Schokoladen-Osterhasen, GRUR 2011, 369; Bingener Das Wesen der Positionsmarke oder Wo die Positionsmarke hingehört, MarkenR 2004, 377; dies Markenrecht – Ein Leitfaden für die Praxis, 2. Aufl 2011; Bölling Der EuGH und die abstrakte Farbmarke, MarkenR 2004, 384; Eichmann Die dreidimensionale Marke, FS Vieregge, 1995, S 147; ders Die dreidimensionale Marke im Verfahren vor dem DPA und BPatG, GRUR 1995, 184; Fabry SEHEN – HÖREN – FÜHLEN: MARKEN FÜR ALLE SINNE, Mitt 2008, 160; Fezer Olfaktorische, gustatorische und haptische Marken, WRP 1999, 575; Figge/Hörster Das Markenrechtsmodernisierungsgesetz MarkenR 2018, 509; Grabrucker Aktuelle Rechtsprechung zu den Warenformmarken, Mitt 2005, 1; Guth Das Urteil des EuGH zur Riechmarke – Anmerkungen und Folgerungen, Mitt 2003, 97; Hacker Stokke und Marke WRP 2017, 399; ders Das Markenmodernisierungsgesetz (MaMoG), GRUR 2019, 113; Hecht Der Schutz von Warenformen als Marke MarkenR 2017, 381; Jeschke Die „Produktform als Corporate Identity“, GRUR 2008, 749; Kiethe/Groeschke Der Designschutz dreidimensionaler Marken nach dem MarkenG, WRP 1998, 541; Kochtial Die Freihaltebedürftigkeit wegen besonderer Form im europäischen und deutschen Markenrecht, GRURInt 2004, 106; Kopacek/Kortge Aus der Rechtsprechung des BPatG im Jahre 2011, GRUR 2012, 440; Kortge/Mittenberger-Huber Aus der Rechtsprechung des BPatG im Jahr 2016, GRUR 2017, 451; dies Aus der Rechtsprechung des BPatG im Jahr 2017, GRUR 2018, 460; Krüger Zum markenrechtlichen Schutz von Kfz-Karosserie-Ersatzteilen, MarkenR 2005, 10; Kur Formalschutz dreidimensionaler Marken, FS Deutsches Patentamt 100 Jahre Markenamt, 1994, S 175; dies Alles oder Nichts im Formmarkenschutz GRURInt 2004, 755; dies Probleme im Überschneidungsbereich von Marken und Design MarkenR 2017, 185; dies Anm zu EuGH GRUR 2014, 1079; Hauck/Stokke GRUR 2014, 1099; Lewalter/Schrader Die Fühlmarke, GRUR 2005, 476; Lewalter Akustische Marken, GRUR 2006, 546; Meinel/Bonn Das Libertel-Urteil und seine Auswirkungen auf die deutsche Rechtsprechung, MarkenR 2004, 1; Rohnke Zum Prüfungsmaßstab bei Formmarken, MarkenR 2001, 199; Rohnke/Thiering Rechtsprechung des EuGH und BGH in den Jahren 2009 und 2010, GRUR 2011, 8; dies Rechtsprechung des EuGH und BGH im Jahre 2011, GRUR 2012, 967; Ruess Auf roten Sohlen – Formal Form oder Position, GRUR 2018, 898; Sack Die Verletzung abstrakter Farbmarken, WRP 2001, 1022; Sambuc Designschutz mit Markenrecht?, GRUR 2009, 333; Samwer Der Schutz der abstrakten Farbmarke, 2004; Schaffer Der Einfluss der EuGH-Entscheidung „Philips/Remington“ (C-299/99) auf die Markenfähigkeit (§ 3 Abs 2 Ziff 2 MarkenG), FS Eisenführ, 2003, S 29; Sattler In Bad Shape? – Der Schutz dreidimensionaler Registermarken, GRUR 2018, 565; Ströbele Probleme bei der Eintragung dreidimensionaler Marken, FS für v Mühlendahl, S 235; Sekretaruk Farben als Marken, 2005; Thewes Der Schutz dreidimensionaler Marken nach dem MarkenG, 1999; Theissen Die grafische (Nicht-)Darstellbarkeit der Farbmarke, GRUR 2004, 729; Thiering Die Rechtsprechung des EuGH und des BGH zum Markenrecht seit dem Jahr 2015, GRUR 2016, 983; Thiering Die Rechtsprechung des EuGH und des BGH zum Markenrecht seit dem Jahr 2016, GRUR 2018, 30; Vifhues Geruchsmarken als neue Markenform, MarkenR 1999, 249; Weiher/Keser Markenfähigkeit abstrakter Farben im konkreten Verwendungszusammenhang, MarkenR 2005, 117; Würtenberger Waren als Marken, GRUR 2003, 912.
I. Vorbemerkung
1
Nach den Bestimmungen des bis zum 31.12.1994 geltenden Warenzeichengesetzes war ein abstrakter Markenschutz stark eingeschränkt. So war ein Markenschutz für Merkmale, die das Wesen der Ware bestimmen, auch im Falle einer Verkehrsdurchsetzung grds ausgeschlossen (BGH MarkenR 2006, 213, 214 – Scherkopf). Mit dem Inkrafttreten des MarkenG sind demgegenüber Hörmarken, dreidimensionale Gestaltungen, einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung (EuGH GRUR 2004, 428, 430 – Henkel) sowie sonstige Aufmachungen, einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen abstrakt markenfähig geworden. Die Bestimmung gilt für alle Marken iSv § 4 und damit nicht nur für die durch Registrierung Schutz erlangenden Kennzeichen. Wenn § 3 Abs 1 MarkenG auf die Eignung abstellt, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, betrifft dies nur die sog abstrakte Markenfähigkeit. Hiermit ist nicht zwangsläufig die konkrete Unterscheidungseignung nach § 8 Abs 2 Nr 1 verbunden (BGH GRUR 2001, 334, 335 – Gabelstapler). Nicht eine Frage der abstrakten Markenfähigkeit gem § 3, sondern der konkreten Unterscheidungskraft ist die Schutzfähigkeit des Namens von staatlichen Stellen (BGH GRUR 2001, 240, 241 – SWISS ARMY in Abweichung von BPatG GRUR 1999, 58 – SWISS ARMY).
2
Die Erweiterung der Markenformen (zu den einzelnen Markenarten vgl Bingener Markenrecht, Rn 9 ff) durch § 3 Abs 1 MarkenG verfolgt in erster Linie den Zweck, derartige Markenformen, die nicht selten an den absoluten Schutzhindernissen gem § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG scheitern, weil der Verkehr idR in dreidimensionalen Gestaltungen der Ware oder in Farben kein unterscheidungskräftiges Betriebskennzeichen sehen wird (BPatGE 39, 220, 222 f – Stabtaschenlampe; BPatG MarkenR 1999, 32, 36 – Aral/Blau I; vgl aber BGH GRUR 1999, 730, 731 – Farbmarke magenta/grau; OLG Köln MarkenR 2006, 233, 234 – Schokoladenriegel), über § 8 Abs 3 die Möglichkeit einer Verkehrsdurchsetzung zu eröffnen.
II. Regelungsinhalt des § 3 Abs 1
3
Ist schon die abstrakte Markenfähigkeit nicht gegeben, besteht kein Raum für eine Verkehrsdurchsetzung (BGH GRUR 2001, 334, 335 – Gabelstapler). Dies war nach Inkrafttreten des MarkenG insb bei Farbmarken von Bedeutung. Das BPatG hatte § 3 Abs 1 zunächst restriktiv ausgelegt und Farben nur im Rahmen einer konkreten Aufmachung als markenfähig beurteilt (BPatG GRUR 1996, 881 – Farbmarke: gelb/schwarz). Die anmelderfreundliche Auslegung durch den BGH, wonach auch konturlose Farben markenfähig sind und für § 8 Abs 1 eine mittelbare graphische Darstellbarkeit durch Angabe von RAL-Nummern oder Rechtecke ausreicht (BGH GRUR 1999, 491, 492 – Farbmarke gelb/schwarz; BGH GRUR 1999, 730, 731 – Farbmarke magenta/grau; GRUR 2002, 427 f – Farbmarke gelb/grün; zu den Anmeldeerfordernissen vgl § 32 Rn 22), hat zu einer Änderung der Spruchpraxis des DPMA und der Rspr des BPatG geführt. Danach wird die abstrakte Markenfähigkeit von konturlosen Farben und Farbzusammenstellungen nach § 3 Abs 1 bejaht, die konkrete Unterscheidungseignung iSv § 8 Abs 2 Nr 2 idR verneint (BPatG GRUR 2000, 428, 430 – Farbmarke gelb/schwarz; MarkenR 1999, 211 – Farbmarke: violettfarben, vom BGH GRUR 2001, 1154 aufgehoben), wenngleich im Einzelfall die Schutzfähigkeit bejaht worden ist (BPatG GRUR 2003, 77, 78 – magenta). Indes hat der EuGH nunmehr mit der „Libertel“-Entsch eine eher „anmelderfeindliche“ Richtung eingeschlagen (EuGH GRUR 2003, 604 – Libertel). Danach soll die abstrakte Markenfähigkeit von Farben nicht generell, sondern nur unter bestimmten – nicht näher genannten Voraussetzungen – zu bejahen sein. Nach der Entsch „Heidelberger Bauchemie“ (EuGH GRUR 2004, 858 ), die auf die Vorlage durch das (BPatG GRUR 2002, 429 – abstrakte Farbmarke) ergangen ist, sind konturlose Farbzusammenstellungen nicht markenfähig, sofern in der Anmeldung nicht eine systematische Anordnung enthalten ist, in der die betreffenden Farben in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden sind (vgl auch Weiher/Keser MarkenR 2005, 117, 120). Insoweit empfiehlt es sich für Anmelder, bereits mit der angemeldeten Farbmarke eine Beschreibung einzureichen, in der der konkrete Verwendungszusammenhang angegeben wird, dh wie die Farbe(n) iVm der Ware in Erscheinung tritt (vgl BGH GRUR 2002, 427 – Farbmarke gelb/grün; BPatG MarkenR 2005, 286, 289 f – Farbmarke gelb). Bei der Beurteilung auch schon der abstrakten und erst recht der konkreten Unterscheidungskraft ist das Allgemeininteresse an der ungehinderten Verwendung von Farben zu berücksichtigen (vgl insoweit auch Sack WRP 221, 1022, 1030). In der Regel soll die Eintragung nur iF der Verkehrsdurchsetzung gerechtfertigt sein (EuGH GRUR 2003, 604, 607 – Libertel; vgl auch BPatG GRUR 2002, 429, 434 – abstrakte Farbmarke; Meinel/Bonn MarkenR 2004, 1 ff und Theißen GRUR 2004, 729 ff; Samwer S 83 ff), was allerdings voraussetzt, dass die angemeldete Farbzusammenstellung überhaupt abstrakt markenfähig ist. Bezieht sich der Schutz auf eine Vielzahl von Marken, so ist die erforderliche Markenfähigkeit zu verneinen (BGH PAVIS PROMA –I ZB 85/11 – Variable Bildmarke).
4
Hörmarken bzw Schallmarken (vgl HABM GRUR 2003, 1054 – Roar of a Lion) sind abstrakt markenfähig, wie der EuGH zu Recht festgestellt hat (EuGH GRUR 2004, 54, 56 – Shield Mark). So können Werbemelodien als akustische Marke angemeldet werden. Hierbei bezieht sich der Schutz allerdings nicht auf einen in der Werbemelodie enthaltenen Text (HABM GRUR 2006, 343 – Arzneimittel Ihres Vertrauens: Hexal; Lewalter GRUR 2006, 546, 547).
5
Bei allen Markenformen ist § 3 Abs 1 erfüllt, wenn die angemeldete Marke die allg Anforderungen an die Markenfähigkeit erfüllt, dh sie muss abstrakt zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen geeignet sein (BGH GRUR 1999, 491 f – Farbmarke gelb/schwarz). Dies wird idR bei allen in der Bestimmung genannten Markenformen ohne weiteres zu bejahen sein. Allerdings macht der BGH die Markenfähigkeit nach § 3 Abs 1 zusätzlich davon abhängig, dass die Marke kein funktionell notwendiger Bestandteil der Ware ist, sondern über die technische Grundform hinausreichende nichttechnische Elemente aufweist, die – wenn auch nicht physisch – gedanklich von der Ware abstrahierbar sind (BGH GRUR 2001, 334, 335 – Gabelstapler; vgl auch Fezer § 3 Rn 227; Ströbele/Hacker/Thiering/Miosga § 3 Rn 32). Indes ist die Frage der funktionalen Notwendigkeit in § 3 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 geregelt. Das Erfordernis der Selbstständigkeit von Ware und Marke ist zudem irreführend, weil die dreidimensionale Marke mit der Ware identisch sein kann, so dass die Ware zugleich ihre eigene Kennzeichnung bildet (vgl Sambuc GRUR 2009, 333, 334), was der BGH letztlich bei Beurteilung der konkreten Unterscheidungseignung von „dreidimensionalen, die Ware selbst darstellenden Formmarken“ selbst zum Ausdruck bringt (BGH GRUR 2001, 334, 336 – Gabelstapler; vgl auch Ströbele/Hacker/Thiering/Miosga § 3 Rn 19, 20; Würtenberger GRUR 2003, 912, 915 ff). Unproblematisch ist die Selbstständigkeit von Marke und Ware jedenfalls dann, wenn es sich um eine produktunabhängige Form handelt, wie etwa beim Mercedes-Stern (Sambuc GRUR 2009, 333, 334).
6
§ 3 Abs 1 enthält keine abschließende Aufzählung der Markenformen, wie sich aus der mit „insbesondere“ eingeleiteten beispielhaften Nennung möglicher Markenformen ergibt. Deshalb ist auch eine Riechmarke abstrakt markenfähig iSv § 3 Abs 1 (BPatG GRUR 2000, 1044, 1046 – Riechmarke; Vifhues MarkenR 1999, 249), wie der EuGH in der „Siekmann“–Entsch, die auf Vorlage durch das BPatG (GRUR 2000, 1044) ergangen ist, festgestellt hat (GRUR 2003, 145, 147). Fühlmarken oder Tastmarken, wie sie für ein Kennzeichen in Blindenschrift oder die Verkleidung eines Autositzes denkbar ist, können durchaus abstrakt markenfähig sein (Lewalter/Schrader GRUR 2005, 476, 477), werden idR aber wie auch die Geruchsmarken und auch Geschmacksmarken sowie Bewegungsmarken mangels grafischer Darstellbarkeit an § 8 Abs 1 scheitern (BPatG GRUR 2005, 770, 771 f – Tastmarke; Guth Mitt 2003, 97, 99 f), soweit der den Wahrnehmungsvorgang auslösende Gegenstand in seinen maßgeblichen Eigenschaften nicht objektiv hinreichend bestimmt bezeichnet wird (BGH Mitt 2007, 31, 33 – Tastmarke; vgl auch Fabry Mitt 2008, 160, 168 f). Verpackungen stehen den Warenformen gleich und fallen unter § 3 Abs 2 Nr 1, wenn die Verpackung der Warenform gleichzusetzen ist. Dies setzt jedoch voraus, dass die Verpackung der Warenform entspricht oder ihr zumindest so nahesteht, dass zwischen Form und Verpackung nicht unterschieden werden kann (BGH GRUR 2018, 404, 408 Quadratische Tafelschokoladenverpackung).
7
Die Positionsmarke oder Positionierungsmarke (vgl Bingener MarkenR 2004, 377 ff) fällt unter den Begriff der Aufmachung iSv § 3 Abs 1. Wesensnotwendig hierfür ist, dass das Ausstattungselement auf einem bestimmten Warenteil in stets gleichbleibender Platzierung bzw Positionierung in Erscheinung tritt (BPatG GRUR 1998, 390 f – Roter Streifen im Schuhabsatz; 1998, 819 f – Jeanstasche mit Ausrufezeichen; Mitt 2000, 114 f – Positionierungsmarke; BPatG PAVIS PROMA – 27 W(pat) 369/03). Bei der Positionsmarke kann es sich um eine Bild- oder 3D-Marke handeln (vgl Ströbele/Hacker/Thiering/Miosga § 3 Rn 70), was bei der Anmeldung ebenso anzugeben ist wie die Wahl einer Positionsmarke. Da das Ausstattungselement an einer bestimmten Stelle positioniert sein muss, bedarf es einer nach § 8 Abs 5 bzw § 9 Abs 5 MarkenV zulässigen Beschreibung der Stelle, an der sich das Ausstattungselement stets gleichbleibend befinden soll, wenn sich dies nicht schon aus der eingereichten Darstellung ohne weiteres ergibt (vgl Bingener MarkenR 2004, 377, 379 f). Entscheidend soll sein, dass die Marke mit dem Erscheinungsbild der Ware, an dem sich das Positionselement befindet, praktisch verschmilzt (Rohnke/Thiering GRUR 2012, 967,969 unter Berufung auf PAVIS PROMA EuGH C-0042/10). Nicht markenfähig als Formmarke ist ein Zeichen, das aus einer auf der Sohle eines hochhackigen Schuhs aufgebrachten Farbe besteht, da sie nicht ausschließlich aus der „Form“ dieser Ware besteht (EuGH GRUR 2018, 842 – Chistian Louboutin/Van Haren; zustimmend Ruess GRUR 2018, 898, 899 f.).
8
Eine Kombination von 3D-Marke mit einem weiteren Element – etwa einem Wortbestandteil – ist zulässig und steht einer Anmeldung als 3D-Marke nicht entgegen; vielmehr sind dies die Fälle, in denen der traditionelle Gedanke der Selbstständigkeit von Marke und Ware, wie er praktisch uneingeschränkt zu Zeiten des WZG galt, weiterhin gewahrt ist (vgl Sambuc GRUR 2009, 333, 34). Darüber hinaus kann ein zusätzliches Wortelement wie bei der Aufschrift „Lindt“ eines Goldhasen die Marke unterscheidungskräftig iSv § 8 Abs 2 Nr 1 machen; ohne diesen Bestandteil ist die Unterscheidungskraft zu verneinen (EuGH GRUR 2012, 925 – Goldhase mit Glöckchen). Dies gilt auch dann, wenn es sich bei dem weiteren Bestandteil um das schutzbegründende Element handelt. Eine 3D-Marke ist deshalb auch bei Kombination verschiedener Markenkategorien einem Markenschutz zugänglich (BPatGE 43, 122, 124 – MAG-LITE Taschenlampe; BGH GRUR 2005, 158, 159 – Stabtaschenlampe „MAGLITE“; vgl Rohnke/Thiering GRUR 2012, 967, 969, EuGH GRUR 2012, 925 – Goldhase mit Glöckchen). Nicht markenfähig als Formmarke ist ein Zeichen, das aus einer auf der Sohle eines hochhackigen Schuhs aufgebrachten Farbe besteht, da sie nicht ausschließlich aus der „Form“ dieser Ware besteht (EuGH GRUR 2018, 842 – Chistian Louboutin/Van Haren; zustimmend Ruess GRUR 2018, 898, 899 f), wobei allerdings die Form des Schuhs nicht von der Marke umfasst war (Ruess GRUR 2018, 898,899). Deshalb bedarf es bei der Prüfung der Eintragungsfähigkeit keiner Entscheidung der Frage, ob die Gestaltung der Ware als solche – ohne das zusätzliche Element – schutzfähig nach § 8 Abs 2 wäre. Eine solche Prüfung wäre ggf im Kollisionsverfahren nachzuholen.
III. Ausschluss der Markenfähigkeit nach § 3 Abs 2
1. Allgemeines
9
Die abstrakte Markenfähigkeit ist dann zu verneinen, wenn die Ausnahmevoraussetzungen des § 3 Abs 2 eingreifen. Danach sind dreidimensionale Gestaltungen nicht abstrakt markenfähig, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware, ihrer Verpackung (BGH GRUR 2001, 56, 57 – Likörflasche) oder anderen charakteristischen Merkmalen selbst bedingt oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist bzw der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Diese Bestimmung soll als spezielle Regelung des Freihaltungsbedürfnisses der Mitbewerber Dauermonopolrechte an essenziellen, technischen oder ästhetischen Produktmerkmalen verhindern (vgl Rohnke/Thiering GRUR 2011, 8, 9; Sambuc GRUR 2009, 333 f und 335; Hecht MarkenR 2017, 381, 383). Mitbewerber sollen nicht daran gehindert werden können, bei der Gestaltung ihrer Produkte eine bekannte technische Lösung einzusetzen oder ihren Produkten bestimmte vorteilhafte Eigenschaften zu verleihen (BGH GRUR 2006, 679, 681 – Porsche Boxster; vgl auch Schrader MarkenR 2006, 310, 311 ff zur Frage des Schutzumfangs nach Eintragung).
10
Soweit die Marke „aus anderen charakteristischen Merkmalen“ besteht, handelt es sich letztlich entgegen der Gesetzesbegründung zum Markenmodernisierungsgesetz (MaMoG) (BT-Drucks 19/2898, 61) um eine Erweiterung der Ausschlussgründe von Formzeichen auf andere Markenformen (Hacker GRUR 2019, 113, 115). Das Zeichen ist damit auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es artbedingt, technisch bedingt oder wertbedingt ist (Figge/Hörster MarkenR 2018, 509, 510). So kommt eine abstrakte Farbmarke in Betracht, bei der die betreffende Farbe für die beanspruchten Waren eine technische Funktion erfüllt (vgl BPatGE 42, 51 -Farbmarke violett). Eine Klangmarke, die zB aus der Wiedergabe von Vogelgezwitscher besteht, dürfte nach § 3 Abs 2 Nr 1 für „lebende Tiere“ der Klasse 31 von der Eintragung ausgeschlossen sein (Hacker GRUR 2019, 113, 115). Nicht genügen dürfte, dass das Zeichen nur Assoziationen an die Waren hervorruft (Hacker GRUR 2019, 113, 115).
11
§ 3 Abs 2 übernimmt laut amtl Begr zum RegE weitgehend die Kriterien, die von der Rspr zur Ausstattungsfähigkeit dreidimensionaler Gestaltungen entwickelt worden waren (Sonderheft BlPMZ 1994, 59). Indes stimmt die Formulierung weitgehend mit § 1 Abs 2 des einheitlichen Benelux-Markenrechts überein, so dass sich eine Orientierung an der hierzu ergangenen Rspr empfiehlt. Schon wegen der unterschiedlichen Begriffe ist Vorsicht bei der Übertragung der zur Ausstattungsfähigkeit aufgestellten Grundsätze geboten. Der Regelungsbereich beschränkt sich dem Wortlaut nach auf Formen, so dass eine Anwendung auf reine Farbmarken-Anmeldungen an sich nicht in Betracht kommt (BPatG MarkenR 2005, 286, 290 – Farbmarke gelb für farbige Formmarken). Indes hat letztlich die Formmarke die schon vorher zulässige produktdarstellende Bildmarke ergänzt, so dass im Freihaltungsinteresse der Mitbewerber eine Anwendung von § 3 Abs 2 geboten erscheint (vgl BGH GRUR 1999, 495, 496 – Etiketten; Ingerl/Rohnke § 3 Rn 42). Nach der Neuformulierung des Markengesetzes durch das Markenmodernisierungsgesetz (MaMoG), wonach auch Formen oder andere charakteristische Merkmale von der Eintragung ausgeschlossen sind, geht es um die Erweiterung der Schutzausschliessungsgründe für Formzeichen (BT-Drucks 19/2898,61). Letztlich handelt es sich um eine Erweiterung der Ausschlussgründe von Formzeichen auf andere Markenformen (Hacker GRUR 2019, 113, 115).
12
Ob das Freihaltungsbedürfnis abschließend durch § 3 Abs 2 geregelt wird, ist str. Der BGH bejaht eine Anwendbarkeit von § 8 Abs 2 Nr 2 neben § 3 Abs 2 (BGH GRUR 2001, 334, 337 – Gabelstapler; WRP 2001, 265, 269 – Stabtaschenlampen; WRP 2001, 269, 273 – Rado-Uhr; so auch in den Folgeentscheidungen BGH GRUR 2004, 502 – Gabelstapler II, 2004, 505 Rado-Uhr II, 2004, 506 – Stabtaschenlampen II, in denen jeweils zur Feststellung eines Freihaltungsbedürfnisses nach § 8 Abs 2 Nr 2 an das BPatG zurückverwiesen worden ist, wo bei Gabelstaplern ein Freihaltungsbedürfnis bejaht und die Eintragung versagt worden ist (BPatG BlPMZ 2005, 267 – Gabelstapler III; BPatG Mitt 2007, 37 – Rado-Uhr II; BGH GRUR 2006, 679, 681 – Porsche Boxster; EuGH GRUR 2003, 514, 518 – Linde; vgl auch Rohnke MarkenR 2001, 199; Ingerl/Rohnke § 3 Rn 49). Dies ist nicht unbedenklich, weil die beschreibenden Zeichen und Angaben iSv § 8 Abs 2 Nr 2 auf Wort- und Bildmarken zugeschnitten sind, nicht aber auf die Ware selbst darstellende Formmarken, bei denen die Darstellung der Ware ihre Beschreibung schlechthin ist (vgl Eichmann GRUR 1995,184, 188; Bauer GRUR 1996, 319, 321; Fuchs-Wissemann MarkenR 1999, 183, 185). Für den BGH mag immerhin die Erwägung sprechen, dass bei einer engen, anmelderfreundlichen Auslegung von § 3 Abs 2 und einer Zurückweisung nach § 8 Abs 2 Nr 2 das Eintragungshindernis durch Verkehrsdurchsetzung gem § 8 Abs 3 überwunden werden kann (BGH GRUR 2001, 334, 337; GRUR 2006, 588, 590 – Rasierer mit drei Scherköpfen und 588, 589 – Scherkopf). Dies würde aber dem erheblichen Freihaltungsinteresse, das an technischen Formen besteht, nicht gerecht und würde große Unternehmen begünstigen, die durch entspr Werbeaufwendungen die Voraussetzungen für eine Verkehrsdurchsetzung und damit für eine Monopolisierung schaffen könnten (Würtenberger GRUR 2003, 912, 913 ff). Der EuGH hat ebenfalls das Interesse der Allgemeinheit an der Freihaltung derartiger Formen hervorgehoben, ohne allerdings die Frage einer spezialgesetzlichen Regelung zu entscheiden (EuGH MarkenR 2002, 231 – Philips; GRUR 2003, 514 – Linde; vgl Berlit GRUR 2009, 369, 371, allerdings zur Unterscheidungskraft iSv § 8 Abs 2 Nr 1). Das BPatG und der BGH haben die Form einer sog Milchschnitte nicht als durch die Art der Ware bedingt angesehen (BPatG PAVIS PROMA – 32W(pat) 308/02 –; BGH GRUR 2008, 510 ff – Milchschnitte), weil es verschiedene Möglichkeiten der Gestaltung gebe, und hierdurch die Möglichkeit einer Eintragung im Wege der Verkehrsdurchsetzung ermöglicht (vgl Würtenberger GRUR 2003, 912, 913). Die Frage einer spezialgesetzlichen Regelung ist letztlich rein akademischer Natur, weil bei Verneinen der Schutzausschließungsgründe des § 3 Abs 2 von ausschließlich produktdarstellenden Formmarken eine Beschreibung der Ware und damit das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 zu bejahen ist. Problematisch wird diese Frage allerdings dann, wenn im Prüfungsverfahren die Frage des Eingreifens von § 3 Abs 2 dahin gestellt bleibt, was freilich schon im Hinblick auf ein mögliches Durchsetzungsverfahren nach § 8 Abs 3 unzulässig ist.