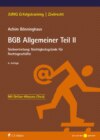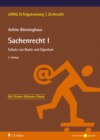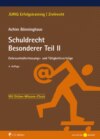Kitabı oku: «Schuldrecht Besonderer Teil I», sayfa 8
2. Übergang des Eigentums auf K nach § 929
Zu prüfen ist weiter, ob V sein Eigentum tatsächlich an K verloren hat, wie dies aufgrund der jetzigen Besitzlage nach § 1006 Abs. 1 nun vermutet wird. Grundsätzlich erfordert eine rechtsgeschäftliche Übertragung des Eigentums an beweglichen Sachen eine Einigung über den Rechtsübergang, die nach § 929 S. 1 formlos möglich ist und zum Zeitpunkt der Übergabe bestehen muss. Eine solche Einigung ist jedoch nicht erfolgt, da sich V und K ausdrücklich nur über den Übergang des Eigentums am Grundstück durch Auflassung geeinigt hatten. Für eine konkludente Einigung bietet der Sachverhalt keine ausreichenden Anhaltspunkte, die eine entsprechende Auslegung stützen könnten. Eine Übereignung nach § 929 scheidet deshalb aus.
3. Übergang nach § 926 Abs. 1
Allerdings sieht § 926 Abs. 1 vor, dass der Erwerber mit dem Eigentum am Grundstück auch das Eigentum in den zur Zeit des Erwerbs vorhandenen Zubehörstücken des Veräußerers erlangt, wenn sich Erwerber und Veräußerer darüber einig sind, dass sich die Veräußerung auf das Zubehör des Grundstücks erstrecken soll. Von einer solchen Erstreckung ist nach § 926 Abs. 1 S. 2 im Zweifel auszugehen.
Da K mit Auflassung und Eintragung im Grundbuch Eigentümer des Grundstücks geworden ist, wurde er nach dieser Regelung zugleich Eigentümer der auf dem Dach aufgestellten Satellitenanlage des V.
II. Ergebnis
V hat sein Eigentum an der Satellitenanlage verloren und kann sie deshalb nicht nach § 985 von K herausverlangen.
C. Anspruch des V gegen K auf Herausgabe der Satellitenanlage aus § 812 Abs. 1 Var. 1
Dem V könnte aber ein Herausgabeanspruch aus § 812 Abs. 1 S. 1, 1. Fall gegen K zustehen.
I. Anspruchsentstehung
Ein solcher Anspruch setzt voraus, dass K das Eigentum und den unmittelbaren Besitz an der Satellitenanlage durch eine Leistung des V erhalten hat, für die kein rechtlicher Grund bestand.
Hinweis
Eigentlich müsste der Obersatz neutraler formuliert werden. Das erste Tatbestandsmerkmal lautet schließlich „etwas erlangt“, so dass in einem ersten Schritt untersucht werden müsste, was K überhaupt erlangt hat. Da hier im Rahmen der Prüfung des § 985 aber bereits herausgearbeitet wurde, dass K unmittelbaren Besitz und Eigentum erhalten hat, wäre es umständlich, die Frage nach dem „erlangten Etwas“ erneut aufzuwerfen. Der Obersatz verkürzt die Fragestellung folglich auf die noch offenen Punkte „Leistung“ und „ohne rechtlichen Grund“.
Wie oben bereits ausgeführt, übertrug V das Eigentum am Grundstück und damit wegen § 926 Abs. 1 auch an der Satellitenanlage auf K, um seine Verpflichtung aus dem mit ihm geschlossenen Kaufvertrag zu erfüllen. Die Zuwendung dieser Positionen stellt somit eine Leistung im Sinne einer zweckgerichteten, nämlich zum Zwecke der Erfüllung einer Verbindlichkeit vorgenommenen Mehrung des Vermögens von K dar.
Die Verschaffung von Besitz und Eigentum erfolgte aber auch mit rechtlichem Grund. Wie oben bereits festgestellt verpflichtete der zwischen den Parteien geschlossene Kaufvertrag den V nicht nur zur Übereignung des Grundstücks, sondern gem. § 311c auch zur Verschaffung des Eigentums und Besitzes an der Satellitenanlage. Die Tatsache, dass in diese Verpflichtung nicht beurkundet wurde, führt nicht zur Nichtigkeit dieser Verpflichtung nach § 125 S. 1. Denn schließlich handelt es sich um einen Nebenpunkt, der gesetzlich geregelt und damit nicht beurkundungsbedürftig ist.[62] Im Übrigen ist mit der Eintragung des K im Grundbuch nach § 311b Abs. 1 S. 1 eine Heilung des zunächst formunwirksamen Kaufvertrages eingetreten.
II. Ergebnis
Ein Rechtsgrund für den Erwerb des Eigentums an der Satellitenanlage liegt vor, so dass auch die Kondiktion nach § 812 Abs. 1 S. 1, 1. Fall ausgeschlossen ist.
Anmerkungen
[1]
Petersen JURA 2008, 180, 182 unter Ziff. II 1b.
[2]
Siehe zu diesen Themen und den damit verbundenen Aufbaufragen im Skript „Schuldrecht AT I“.
[3]
Skript „Schuldrecht AT II“ Rn. 313 ff.
[4]
Skript „Schuldrecht AT II“ Rn. 327 ff.
[5]
Siehe dazu im Skript „Schuldrecht AT II“ Rn. 333 ff.
[6]
Palandt-Grüneberg § 266 Rn. 7; Lorenz NJW 2013, 1341 f. unter Ziff. II 1.
[7]
Lorenz NJW 2013, 1341 f. unter Ziff. II 1.
[8]
Lorenz NJW 2013, 1341 f. unter Ziff. II 1.
[9]
Siehe dazu im Skript „Schuldrecht AT II“ Rn. 333 ff.
[10]
„Casum sentit dominus.“ = Lat.: „Den Zufall spürt der Eigentümer.“
[11]
BGH Urteil vom 10.10.2008 (Az: V ZR 131/07) unter Tz. 10 = NJW 2009, 63 f. und vom 29.6.2007 (Az: V ZR 1/06) unter Tz. 25 = NJW 2007, 2841, 2842.
[12]
BGH NJW-RR 1999, 346, 347 unter Ziff. II.
[13]
BGH Urteil vom 19.10.2007 (Az: V ZR 211/06) unter Ziff. II 2a m.w.N. = BGHZ 174, 61 ff. = NJW 2007, 3777 ff.; Palandt-Weidenkaff § 435 Rn. 8 („fehlendes Eigentum kein Rechtsmangel“); a.A. Canaris JZ 2003, S. 831 ff. (832) m.w.N., der ab dem Moment, in dem der Käufer Eigentum erworben hätte, das Gewährleistungsrecht anwenden will. In der Sache geht es um die Anwendbarkeit der Verjährungsregel des § 438 Abs. 1 Nr. 1a (siehe dazu unter Rn. 90).
[14]
Palandt-Weidenkaff § 453 Rn. 20.
[15]
MüKo-Ernst § 323 Rn. 25, 26.
[16]
MüKo-Westermann § 434 Rn. 51 f.; Bamberger/Roth-Faust § 433 Rn. 38 ff.
[17]
Medicus/Lorenz Schuldrecht II § 7 Rn. 3; Palandt-Weidenkaff § 439 Rn. 2: keine Identität mit ursprünglichem Erfüllungsanspruch; Lorenz NJW 2013, 1341, 1343 unter Ziff. III 1; Musielak NJW 2008, 2801, 2803 unter Ziff. III 2 a.E: gesetzliche Grundlage für primäre Ersatzlieferungspflicht fehlt; Gsell JuS 2007, 97, 100 unter Ziff. II 5 (keine Ausdehnung des § 439 möglich, planmäßige Sonderregelung); a.A. Bitter ZIP 2007, 1881, 1887 f. unter Ziff. III a. E. (Ersatzlieferungspflicht entweder aus § 433 Abs. 1 S. 2 oder § 439 Abs. 1 analog); MüKo-Ernst § 323 Rn. 29 f.
[18]
Bamberger/Roth-Faust § 433 Rn. 42; Lorenz NJW 2013, 1341, 1344 unter Ziff. III 2.
[19]
Lorenz a.a.O.
[20]
Bamberger/Roth-Unberath § 266 Rn. 3 und § 294 Rn. 6; Palandt-Grüneberg § 266 Rn. 7; Lorenz NJW 2013, 1341, 1344 unter Ziff. III 2.
[21]
Lorenz NJW 2013, 1341, 1344 unter Ziff. III 2.; Jud JuS 2004, 841, 845 f. unter Ziff. IV.
[22]
Bamberger/Roth-Faust § 442 Rn. 30; vgl. auch Bamberger/Roth-Unberath § 294 Rn. 7: kein Zurückweisungsrecht, wenn dem Käufer in Bezug auf den Mangel keine Gewährleistungsrechte zustehen.
[23]
Siehe dazu das Skript „Schuldrecht AT I“.
[24]
Palandt-Weidenkaff § 433 Rn. 17; Bamberger/Roth-Faust § 433 Rn. 37.
[25]
Palandt-Weidenkaff § 433 Rn. 11 ff.
[26]
Untergang des Stücks bei Stückschuld, Untergang des ganzen Vorrats bei Vorratsschuld bzw. der ganzen Gattung bei Gattungsschuld.
[27]
Bitter ZIP 2007, 1881 ff. (mit lehrreichen Beispielen – sehr lesenswert!); Balthasar/Bolten ZGS 2004, 411 ff.
[28]
Der Anspruch auf Ersatzlieferung aus § 439 Abs. 1 Var. 2 wegen Mangelhaftigkeit der Kaufsache ist nach h.M. selbst bei der Stückschuld nicht generell ausgeschlossen (dazu näher unter Rn. 222 ff.).
[29]
Bitter ZIP 2007, 1881, 1886 f. unter Ziff. III.
[30]
Z.B. Bamberger/Roth-Faust § 439 Rn. 28; Musielak NJW 2008, 2801, 2803 unter Ziff. III 2; Gsell JuS 2007, 97, 100 unter Ziff. II 5; Roth NJW 2006, 2953, 2955 unter Ziff. II. 3.
[31]
Sog. „quantitative Teilunmöglichkeit“.
[32]
Canaris JZ 2003, 1156 ff.
[33]
Da die Leistungspflicht des Verkäufers regelmäßig keine höchstpersönliche Pflicht i.S.d. § 275 Abs. 3 darstellt, kommt neben § 275 Abs. 1 nur § 275 Abs. 2 in Betracht.
[34]
Allgemein zu § 275 Abs. 2 im Skript „Schuldrecht AT II“ unter Rn. 313 ff.
[35]
Vgl. dazu im Skript „Schuldrecht AT I“ Rn. 132 ff.
[36]
Palandt-Grüneberg § 300 Rn. 3.
[37]
Palandt-Grüneberg § 300 Rn. 4 ff.
[38]
Palandt-Grüneberg § 300 Rn. 6.
[39]
Wegen der Umwandlung des Kaufvertrages in ein Rückgewährschuldverhältnis nach §§ 346 ff. erlöschen die Primärleistungspflichten.
[40]
Wegen § 281 Abs. 4 erlöschen die verletzten Primärleistungspflichten.
[41]
Wegen der in § 357 Abs. 1 bezeichneten Wirkungen hat der Widerruf rücktrittsähnliche Wirkung und führt zum Erlöschen der vertraglichen Primärleistungspflichten.
[42]
Siehe dazu im Skript „Schuldrecht AT II“ unter Rn. 90 ff.
[43]
Auf die Sekundäranprüche wie Nacherfüllung, Schadensersatz etc. bezieht sich § 474 Abs. 3 nicht!
[44]
Medicus/Lorenz Schuldrecht II § 11 Rn. 9.
[45]
Medicus/Lorenz Schuldrecht II § 11 Rn. 9.
[46]
Siehe dazu Skript „Schuldrecht AT I“ unter Rn. 420 ff.
[47]
BGH Urteil vom 24.10.2006 (Az: X ZR 124/03) unter Tz. 35 = NJW-RR 2007, 325, 326.
[48]
Allgemein zur Verjährung Skript „Schuldrecht AT I“ Rn. 426 ff.
[49]
Palandt-Weidenkaff § 438 Rn. 6; MüKo-Westermann § 438 Rn. 13; Bamberger/Roth-Faust § 438 Rn. 14; offengelassen bei BGH Urteil vom 19.10.2007 (Az: V ZR 211/06) unter Tz. 28 = BGHZ 174, 61 ff. = NJW 2007, 3777, 3779.
[50]
§ 281 setzt nicht nur die Fälligkeit, sondern auch die Durchsetzbarkeit der Leistungspflicht voraus, siehe im Skript „Schuldrecht AT II“ Rn. 88 ff.
[51]
Pfandrechte gewähren über § 1227 Herausgabeansprüche aus § 985 gegen den (unberechtigten) Besitzer der verpfändeten Sache.
[52]
Siehe dazu das Skript „Schuldrecht AT II“.
[53]
Siehe im Skript „BGB AT I“ Rn. 277 ff.
[54]
Siehe im Skript „Sachenrecht II“ Rn. 253 f.
[55]
Siehe im Skript „Sachenrecht II“ Rn. 11 f.
[56]
Siehe im Skript „BGB AT II“ Rn. 251 ff.
[57]
Siehe zum Thema Form und falsa demonstratio im Skript „BGB AT II“ Rn. 259 ff.
[58]
Siehe im Skript „BGB AT II“ Rn. 253.
[59]
Palandt-Grüneberg § 311b Rn. 55.
[60]
BGH NJW 1966, 588, 589; Palandt-Ellenberger § 138 Rn. 44; MüKo-Armbrüster § 134 Rn. 57.
[61]
Dazu im Skript „Sachenrecht I“ Rn. 106.
[62]
BGH NJW 2000, 354, 357 li. Sp. zu § 314 a.F. = jetzt § 312c; Palandt-Ellenberger § 125 Rn. 9 und Palandt-Grüneberg, § 311b Rn. 25 und § 311c Rn. 1.
1. Teil Der Kaufvertrag › C. Der Anspruch auf den Kaufpreis (§ 433 Abs. 2)
C. Der Anspruch auf den Kaufpreis (§ 433 Abs. 2)
Anspruch des Verkäufers gem. § 433 Abs. 2 (ggf. i.V.m. § 453)
I.Anspruchsentstehung
1.Wirksamer Kaufvertrag (s. zu den weiteren Problemen im Prüfungsschema oben vor Rn. 4)
unbezifferter KaufpreisRn. 96
Fall des § 241a Abs. 1Rn. 99
2.Sonstige Voraussetzungen/Einwendungen
a)Besondere Voraussetzungen für Gläubiger- oder Schuldnerstellung Dritter
b)Eintritt einer vereinbarten Bedingung
c)anfängliche Unmöglichkeit der Verkäuferschuld (§ 326 Abs. 1 S. 1)
aa)anfängliche Leistungsbefreiung des Verkäufers nach § 275 Abs. 1
bb)(kein) Fall der „qualitativen Teilunmöglichkeit“ (§ 326 Abs. 1 S. 2)
cc)(keine) Ausnahme nach § 326 Abs. 2
II.Rechtsvernichtende Einwendungen, insbesondere
1.Erfüllung und Erfüllungssurrogate (z.B. §§ 362, 364, 389)
2.Nachträgliche Unmöglichkeit der Verkäuferschuld (§ 326 Abs. 1 S. 1)
a)nachträgliche Leistungsbefreiung des Verkäufers nach § 275
b)(kein) Fall der „qualitativen Teilunmöglichkeit“ (§ 326 Abs. 1 S. 2)
c)(keine) Ausnahme nach §§ 446, 447, 326 Abs. 2 S. 1 Var. 1
Voraussetzungen des § 447Rn. 113 ff.
3.Sonderfall des § 300 Abs. 2
4.Eintritt einer auflösenden Bedingung, § 158 Abs. 2
5.Rücktritt, Minderung, Verlangen von Schadensersatz statt der Leistung (§ 281 Abs. 4), Widerruf i.S.d. § 355
III.Durchsetzbarkeit
1.Fälligkeit
2.Einreden
Zurückbehaltungsrecht aus § 273 i.V.m. § 285 („Drittschadensliquidation“)Rn. 126 ff.
1. Teil Der Kaufvertrag › C. Der Anspruch auf den Kaufpreis (§ 433 Abs. 2) › I. Anspruchsentstehung
I. Anspruchsentstehung
1. Wirksamer Kaufvertrag
a) Vertragsschluss mit Inhalt nach § 433 (ggf. i.V.m. § 453)
95
Die Entstehung des Anspruchs gem. § 433 Abs. 2 erfordert zunächst den Abschluss eines Kaufvertrages mit den in § 433 bzw. § 453 typisierten Hauptleistungspflichten. Die vertragstypische Hauptleistungspflicht des Käufers besteht gem. § 433 Abs. 2 in der Zahlung des Kaufpreises. Besteht das Entgelt hingegen ebenfalls in einer Sachleistung liegt kein Kauf, sondern Tausch vor (§ 480).
96

Der Kaufpreis muss bei Vertragsschluss der Höhe nach nicht unbedingt in bezifferter Höhe feststehen. Es genügt, wenn sich seine Höhe nach den Erklärungen der Parteien bestimmen lässt.
Beispiel
„Powerseller“ V stellt auf der „Auktionsplattform“ von „eBay“ eine CD zum Mindestgebot von 1 € zum Verkauf ein und bestimmt einen „Auktionszeitraum“ von 7 Tagen. Nach den Allgemeinen Teilnahmebedingungen erklärt V vorab die Annahme des wirksam innerhalb des „Auktionszeitraumes“ abgegebenen Höchstgebotes.
Sowohl der Kaufvertragspartner als auch die Höhe des Kaufpreises ergeben sich aus der Erklärung des V noch nicht. Beide Punkte werden aber durch das Höchstgebot bestimmt, auf das die Erklärung des V verbindlich (vorab) Bezug nimmt. Ein Kaufvertrag kommt damit mit Zugang des Höchstgebots mit dem Höchstbietenden und dem Preis des Höchstgebots zustande.[1]
97
Nach § 433 Abs. 2 schuldet der Käufer beim Sachkauf außerdem noch die Abnahme der gekauften Sache.

Abnahme bedeutet die Übernahme des unmittelbaren Besitzes (§ 854).[2]
Die Abnahme ist in der Regel Nebenleistungspflicht des Käufers und steht deshalb mit der Hauptleistungspflicht des Verkäufers nicht im Gegenseitigkeitsverhältnis. Der Verkäufer verkauft schließlich, um sein Geld zu verdienen und nicht um die Sache abgenommen zu bekommen. § 320 findet daher grundsätzlich keine Anwendung. Ausdrücklich oder konkludent kann die Abnahme natürlich zur Hauptleistungspflicht erhoben werden, beispielsweise beim Verkauf leicht verderblicher Ware.[3]
Allerdings haben diese Unterscheidungen keine große Bedeutung mehr. Zur Bestimmung der Rechtsfolgen bei Verzögerung der Abnahme kommt Allgemeines Schuldrecht zur Anwendung, egal ob es sich um eine Haupt- oder Nebenleistungspflicht handelt. Für die Anwendung der §§ 280 ff. ergibt sich dies unproblematisch aus dem Gesetz. Trotz der Stellung des Rücktrittsrechts aus § 323 im Titel über den „gegenseitigen Vertrag“ erfordert aber auch diese Vorschrift nicht, dass eine im Synallagma stehende Hauptleistungspflicht verletzt sein müsste.[4]
Hinweis
Unterlässt der Käufer die geschuldete Abnahme, liegt unter den weiteren Voraussetzungen des § 286 Schuldnerverzug vor. Außerdem kann der Käufer nach den §§ 295 ff. in Annahmeverzug[5] bezüglich der vom Verkäufer geschuldeten Lieferung gem. § 433 Abs. 1 geraten.
98
Je nach Vereinbarung können den Käufer weitere Nebenleistungspflichten treffen. Das Gesetz sieht in §§ 446 S. 2, 448 eine Kostentragungspflicht des Käufers für verschiedene Positionen vor.
99

Besonderheiten sind zu berücksichtigen, wenn der Vertrag nach § 151[6] zustande gekommen sein könnte. Bringt der Empfänger eines Vertragsangebots durch sein Verhalten aus objektiver Sicht seinen Annahmewillen zum Ausdruck,[7] kommt der Vertrag dadurch nach § 151 zustande, wenn eine Annahmeerklärung gegenüber dem Empfänger (und Zugang bei diesem) nach der Verkehrssitte nicht erwartet wird oder der Antragende auf sie verzichtet hat. Im Fall des § 241a Abs. 1 kann dadurch ein Vertrag aber ausnahmsweise nicht zustande kommen.
Beispiel
Händler V schickt dem K unaufgefordert eine elektrische Zahnbürste, die V in einem Begleitschreiben als „Messeneuheit“ deklariert und dem K als „sauberes Schnäppchen“ für 69,90 € anbietet. Weiter führt V aus, dass er von einem Einverständnis des K ausgehe, wenn er von diesem binnen 14 Tagen nichts höre. K brauche also nichts weiter zu veranlassen. K ist neugierig und probiert die Zahnbürste sofort mehrere Tage begeistert aus. Nach einer Woche ist ihm die Sache aber zu lästig. Zu einer jetzt anstehenden Geschäftsreise bricht K deshalb mit seiner konventionellen Handbürste auf. Nach 14 Tagen kehrt K zurück findet in seinem Briefkasten eine Rechnung des V vor.
Hier könnte ein Kaufvertrag dadurch zwischen V und K zustande gekommen sein, dass K das Angebot des V nach § 151 angenommen hat. V hatte ausdrücklich auf den Zugang einer Annahmeerklärung verzichtet, so dass es für den Vertragsschluss eigentlich genügt, wenn K durch sein Verhalten objektiv eine Annahme des Angebots zum Ausdruck bringt, ohne dass diese Erklärung gegenüber dem V abgegeben werden und diesem zugehen müsste. Eine solche Betätigung des Annahmewillens liegt hier vor, da eine mehrtägige Nutzung bei objektiver Betrachtung (§ 133) nicht mehr als Test, sondern als Einverständnis mit dem Kauf zu verstehen ist. Erst durch den Kaufvertrag erhält K den Rechtsgrund für die von ihm zu diesem Zeitpunkt offenbar beabsichtigte dauerhafte Nutzung der Sache. Ein insgeheimer Willensvorbehalt wäre nach § 116 S. 1 unbeachtlich.
Wenn jemand einer Person ohne eine dieser Person zurechenbare Aufforderung (invitatio oder verbindliche Bestellung) eine Sache zusendet und die Zusendung mit einem Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages verbindet, kann unter den Voraussetzungen des § 241a kein Kaufvertrag über § 151 zustande kommen. Handelt der Anbietende bei – unterstelltem – Vertragsschluss[8] als Unternehmer (§ 14) und der Empfänger als Verbraucher (§ 13) wird nach § 241a „ein Anspruch gegen diesen“ (= Verbraucher) nicht begründet. Dies bedeutet, dass nur eine gegenüber dem Absender abgegebene und diesem zugegangene Annahmeerklärung einen Vertrag zustande bringt. § 151 kann in einem solchen Fall nicht zum Vertragsschluss führen.[9] Im Beispiel ist daher trotz des Gebrauches der Zahnbürste noch kein Kaufvertrag zustande gekommen.
Hinweis
Ob die Zahlung des Verbrauchers als konkludente Annahme den Vertrag zustande bringt, ist im Einzelnen umstritten: Die wohl überwiegende Auffassung bejaht dies.[10] Zahlt der Verbraucher, weil er sich bereits für verpflichtet hält, fehlt ihm allerdings das Erklärungsbewusstsein für eine Annahmeerklärung: Er kann dann nach der Lehre vom „potentiellen Erklärungsbewusstsein“ nach § 119 Abs. 1 anfechten.[11]
Umstritten ist weiter, ob die Lieferung einer anderen als der verkauften Sache (aliud-Lieferung) in den Anwendungsbereich des § 241a fällt. Da die Vorschrift den Verbraucher vor belästigenden und wegen ihres Überrumpelungscharakters wettbewerbswidrigen Vertriebsformen schützen will, scheidet eine aliud-Lieferung nach vorzugswürdiger Ansicht aus dem Anwendungsbereich des § 241a aus: Immerhin haben die Parteien dann ja einen Vertrag im Vorfeld, also vor der Lieferung geschlossen, so dass dem Verkäufer nicht der Vorwurf eines wettbewerbswidrigen Überlistens zum Vertragsschluss gemacht werden kann.[12] Im Übrigen käme dann der Abgrenzung zwischen Beschaffenheitsfehler und aliud eine entscheidende Bedeutung zu, was der Gesetzgeber mit § 434 Abs. 3 aber gerade vermeiden wollte.