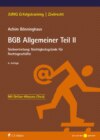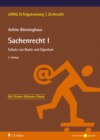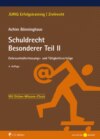Kitabı oku: «Schuldrecht Besonderer Teil I», sayfa 9
b) Wirksamkeitsvoraussetzungen
100
Hinsichtlich der weiteren Wirksamkeitsvoraussetzungen gelten die oben unter Rn. 46 ff. gemachten Ausführungen und Probleme zur Wirksamkeit des Kaufvertrages entsprechend.
2. Sonstige Voraussetzungen/Einwendungen
101
Wie bei jedem Anspruch sind hier ggf. weitere Voraussetzungen zu prüfen, wie zum Beispiel die Vereinbarung einer aufschiebenden Bedingung oder im Falle einer abgetretenen Forderung die Voraussetzungen einer wirksamen Abtretung.
3. Ausschluss nach § 326 Abs. 1 S. 1 wegen anfänglicher Unmöglichkeit
102
Wissen Sie, warum § 275 auf die Kaufpreiszahlungsschuld keine Anwendung finden kann?
Eine anfängliche Unmöglichkeit nach § 275 Abs. 1 ist bei der Pflicht des Käufers nur in Bezug auf die Abnahme denkbar. Schließlich kann der Käufer nicht verpflichtet sein, eine Sache abzunehmen, die der Verkäufer wegen Unmöglichkeit nicht zu liefern braucht.
103
Im Übrigen, also in Bezug auf die Kaufpreiszahlungspflicht, findet § 275 keine Anwendung.[13] Die Kaufpreiszahlungspflicht des Käufers kann aber von Anfang an nach der Preisgefahrregel des § 326 Abs. 1 S. 1 ganz oder teilweise ausgeschlossen sein, wenn der Verkäufer von seiner Leistungspflicht wegen anfänglicher Unmöglichkeit ganz oder teilweise befreit ist (s.o. Rn. 56 ff.).[14]
104
Eine Ausnahme ist aber für den Fall des anfänglich unbehebbaren Mangels zu machen (s.o. Rn. 62 ff.). Denn für diesen Fall schließt § 326 Abs. 1 S. 2 den automatischen Wegfall des Vergütungsanspruches aus. Diese Vorschrift ist auch schon vor Übergabe der Sache bzw. Verschaffung des mit Mängeln behafteten Rechts anwendbar.[15]
Beispiel
Wenn V dem K einen gebrauchten PKW als „unfallfrei“ verkauft, der in Wahrheit bereits einen erheblichen Unfallschaden erlitten hatte, mindert sich wegen der insoweit anfänglich bestehenden „qualitativen Teilunmöglichkeit“ der Kaufpreis nicht automatisch über § 326 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 i.V.m. § 441. Vielmehr muss K entscheiden, ob er nach §§ 437 Nr. 2, 441, 326 Abs. 5 die Minderung wählt oder nach §§ 437 Nr. 2, 326 Abs. 5, 323 Abs. 5 S. 2 vom ganzen Vertrag zurücktritt und damit seine Kaufpreiszahlungspflicht insgesamt zum Erlöschen bringt.
1. Teil Der Kaufvertrag › C. Der Anspruch auf den Kaufpreis (§ 433 Abs. 2) › II. Rechtsvernichtende Einwendungen
II. Rechtsvernichtende Einwendungen
1. Erfüllung und Erfüllungssurrogate
105
Die Zahlungspflicht des Käufers erlischt durch Erfüllung gem. § 362 oder Erfüllungssurrogate. Von den Erfüllungssurrogaten kommen insbesondere die Aufrechnung mit einer gegenläufigen Zahlungsforderung (§§ 387 ff.) oder die Leistung an Erfüllungs statt (§ 364 Abs. 1) in der besonderen Form der Ersetzungsbefugnis bei Inzahlunggabe gebrauchter Sachen in Betracht.[16]
2. Wegfall nach § 326 Abs. 1 S. 1 wegen nachträglicher Unmöglichkeit

[Bild vergrößern]
a) Grundregel des § 326 Abs. 1 S. 1 (Ohne Leistung kein Geld)
106
Bei nachträglicher Leistungsbefreiung des Verkäufers aus Gründen des § 275 Abs. 1–3 entfällt grundsätzlich die Zahlungspflicht des Käufers nach der allgemeinen Regel des § 326 Abs. 1 S. 1.
Beispiel
V verkauft dem K ein bestimmtes Pferd, das vor Übergabe an einer plötzlichen Seuchenerkrankung stirbt.
Von dieser Regel gibt es mehrere Ausnahmen, die an dieser Stelle geprüft werden müssen. Im Falle einer solchen Ausnahme muss der Käufer zahlen, ohne seine vereinbarte Leistung zu bekommen.
b) (Kein) Fall der „qualitativen Teilunmöglichkeit“ (§ 326 Abs. 1 S. 2)
107
Der Automatismus des § 326 Abs. 1 S. 1 greift wegen S. 2 dann nicht ein, wenn – bei oder nach Vertragsschluss – ein Fall der „qualitativen Teilunmöglichkeit“ (= unbehebbarer Mangel) vorliegt.
Beispiel
V verkauft dem K einen bestimmten PKW als unfallfrei. Auf dem Weg zur Übergabe an K wird das verkaufte Fahrzeug in einen Unfall verwickelt. K muss selbst entscheiden, ob er nach §§ 437 Nr. 2, 441, 326 Abs. 5 die Minderung wählt oder nach §§ 437 Nr. 2, 326 Abs. 5, 323 Abs. 5 S. 2 vom ganzen Vertrag zurücktritt und damit seine Kaufpreiszahlungspflicht vollständig zum Erlöschen bringt.
c) Ausnahme nach § 446
108
§ 446 macht beim Kauf von Sachen[17] von der Regel des § 326 Abs. 1 S. 1 eine besondere, auf den Kaufvertrag bezogene Ausnahme, indem die Gefahr des zufälligen Untergangs bzw. der zufälligen Verschlechterung bereits vor Erfüllung ab einem bestimmten Zeitpunkt dem Käufer zugewiesen wird. Mit „Gefahr“ ist dabei gemeint, dass der Käufer die sich aus dem Untergang der Sache ergebenden Nachteile (wie ein Eigentümer) tragen muss und den Verlust wirtschaftlich nicht mehr auf den Verkäufer abwälzen kann.[18] Bezogen auf den Kaufpreiszahlungszahlungsanspruch bedeutet dies zwangsläufig eine Ausnahme zur Grundregel des § 326 Abs. 1 S. 1: Wenn der Verlust der Sache zum Verlust des Zahlungsanspruchs führen würde, bliebe ja der Verkäufer weiterhin mit dem wirtschaftlichen Nachteil belastet.

Unter dem Begriff des Untergangs ist nicht nur die physische Vernichtung, sondern allgemein jeder Umstand zu verstehen, der es dem Verkäufer unmöglich macht, dem Käufer Besitz und Eigentum an der Sache zu verschaffen.[19]
Ein zufälliger Untergang bzw. eine zufällige Verschlechterung i.S.d. § 446 liegt vor, wenn der Untergang/die Verschlechterung von keinem der beiden Vertragspartner zu vertreten ist.[20]
aa) Übergabe der verkauften Sache (§ 446 S. 1)
109
Der Gefahrübergang vollzieht sich im Kaufrecht gem. § 446 S. 1 spätestens im Zeitpunkt der Übergabe der Sache.

Eine Übergabe der Sache i.S.d. § 446 liegt vor, wenn die nach dem Kaufvertrag geschuldete Form der Übergabe endgültig vollzogen worden ist.[21]
Dieser Zeitpunkt deckt sich im Falle des Eigentumsvorbehalts nicht mit dem Zeitpunkt der Erfüllung, da das geschuldete Eigentum erst später durch Erfüllung der Zahlungsbedingung auf den Käufer übergeht (§§ 449 Abs. 1, Abs. 2, 929, 158 Abs. 1). Gleiches gilt beim Grundstückskaufvertrag[22] für den Zeitraum ab Übergabe und vor Eigentumserwerb des Käufers durch Eintragung im Grundbuch.
Die Rechtfertigung für die Zuweisung der Gefahr auf den Käufer liegt darin, dass sich die Sache nun in der Sphäre des Käufers befindet und den sich daraus ergebenden Risiken ausgesetzt ist. Außerdem kann der Käufer die Sache jetzt wie ein Eigentümer nutzen (vgl. § 446 S. 2). Wenn er aber die Vorteile genießen darf, soll er auch die Risiken übernehmen müssen.
Beispiel
V verkauft dem K unter Eigentumsvorbehalt einen PKW. Den Kaufpreis soll K in Raten bezahlen, das Auto darf K sofort mitnehmen. Hier geht die Gefahr mit Übergabe und nicht erst mit Zahlung der letzten Rate auf den Käufer über.
110
Bei vereinbarter Direktlieferung geht die Gefahr nach § 446 mit Übergabe der verkauften Sache an den Zweitkäufer über, da vertragsgemäß gerade kein Lieferumweg über den Erstkäufer stattfinden soll.[23]
Beispiel
V verkauft dem Händler H unter Eigentumsvorbehalt eine Druckmaschine, die direkt an Abnehmer des H, den K, geliefert werden soll. Nach Ablieferung an K und vor vollständiger Zahlung des Kaufpreises durch H wird die Maschine in der Druckerei des K durch einen Brand zerstört.
111
Im Falle des Versendungskaufs (= Schickschuld) liegt mit der Übergabe der Sache an die Transportperson noch keine Übergabe an den Käufer i.S.d. § 446 vor.[24] Andernfalls wäre § 447, der diesen Fall regelt, überflüssig.
bb) Annahmeverzug des Käufers (§ 446 S. 3)
112
§ 446 S. 3 verlagert den Moment des Gefahrübergangs noch weiter vor. Scheitert die Übergabe daran, dass sich der Käufer nach den §§ 293 ff. in Annahmeverzug[25] befindet, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs der verkauften Sache nach § 446 S. 3 auf den Käufer über.
Hinweis
Beachten Sie bei der Frage der „Zufälligkeit“ in diesem Zusammenhang die Haftungsbeschränkung in § 300 Abs. 1!
Dies rechtfertigt sich damit, dass der Verkäufer hier das seinerseits zur Leistung Erforderliche getan hat und die Erfüllung durch die fehlende Mitwirkung des Käufers vereitelt wurde. Der Verkäufer hat deswegen seinen Kaufpreis bereits in voller Höhe „verdient“.
Kann K im Beispiel noch Lieferung anderer Gläser verlangen?
Beispiel
V hat dem K Fenstergläser aus seiner Produktion verkauft, die er dem K am 20.10. bringen soll. K ist jedoch nicht anwesend, so dass V unverrichteter Dinge abzieht. Auf dem Rückweg werden die Fenstergläser infolge leichter Fahrlässigkeit (vgl. § 300 Abs. 1) des V zerstört. V behält seinen vollen Zahlungsanspruch gegen K.
d) Sonderregel beim Versendungskauf (§ 447)
113

Einen noch früheren Zeitpunkt des Gefahrübergangs bestimmt das Gesetz in § 447 beim Versendungskauf: Hier geht die Gefahr des zufälligen Untergangs/Verschlechterung[26] bereits im Moment der Übergabe an die zur Versendung bestimmten Person durch den Verkäufer auf den Käufer über. Sehen wir uns die Voraussetzungen im Einzelnen an:
aa) Anwendbarkeit
114
Beim Verbrauchsgüterkauf i.S.d. § 474 Abs. 1 findet § 447 Abs. 1 gem. § 475 Abs. 2 grundsätzlich keine Anwendung.
Eine Ausnahme besteht nach dieser Vorschrift nur in den seltenen Fällen, dass nicht der verkaufende Unternehmer, sondern der Verbraucher seinerseits die Transportperson ausgesucht und beauftragt hat.
bb) Versendungsverlangen des Käufers
115
§ 447 kommt zur Anwendung, wenn der Verkäufer die Kaufsache „auf Verlangen des Käufers“ an einen anderen Ort als den Erfüllungsort versendet.
Das Versendungsverlangen ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung.[27] Es genügt, wenn der Käufer sein Einverständnis mit einer ihm vom Verkäufer angebotenen Versendung erklärt[28] – mit anderen Worten: Eine Versendung erfolgt immer „auf Verlangen des Käufers“, wenn der Verkäufer dazu nach der Vereinbarung verpflichtet ist. Die Formulierung „auf Verlangen des Käufers“ wird daher von der h.M. also so verstanden, dass dadurch (lediglich) ein eigenmächtiges Versenden der Ware durch den Verkäufer ausgenommen werden soll.[29] Versendet der Verkäufer die Ware eigenmächtig, ohne Vereinbarung mit dem Käufer, findet § 447 keine Anwendung. Der Verkäufer trägt hier die Gefahr bis zum Eintritt der in § 446 bestimmten Zeitpunkte.
cc) Auseinanderfallen von Erfüllungsort und Versandadresse
116
„Erfüllungsort“ ist in der (unglücklichen) Terminologie des § 447 der Ort, an dem der Schuldner seine Leistungshandlung vorzunehmen hat, also der „Leistungsort“.[30] Mangels abweichender Bestimmung ist dies nach § 269 Abs. 1, Abs. 2 der Wohn- bzw. Niederlassungsort des Schuldners, hier also des Verkäufers. Der Versendungskauf zeichnet sich also dadurch aus, dass Leistungsort und Erfolgsort (Ort des Eigentumsübergangs und der Übergabe = Versandadresse) auseinanderfallen. Also beschreibt § 447 Abs. 1 den Versendungskauf als Vereinbarung einer Schickschuld.[31]
Hinter § 447 steckt folgender Gedanke: Im gesetzlichen Regelfall der Holschuld müsste sich der Käufer die Sache eigentlich beim Verkäufer abholen – denn dort befindet sich der Leistungsort. Wenn der Käufer sich die Sache aus Bequemlichkeit zuschicken lässt, nimmt der Verkäufer ihm die Wegstrecke ab und organisiert den Transport, also das, was der Käufer eigentlich selber hätte tun müssen. Mit dem Transport sind nun typischerweise erhöhte Gefahren für die Unversehrtheit der Sache verbunden. Diese sollen grundsätzlich zu Lasten des (bequemen) Käufers gehen, um den Verkäufer nicht mit unkalkulierbaren Risiken zu belasten. Übernimmt der Verkäufer nicht nur die Absendung, sondern will er den ganzen Transport selber durchführen, trägt er auch die Transportgefahr. § 447 ist auf die Bringschuld nicht anwendbar. Dort fallen Leistungs- und Erfolgsort zusammen, und die Sache wird nicht „nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort“ versendet.
Hinweis
Beim Versendungskauf ist der Verkäufer als Schickschuldner verpflichtet, am Leistungsort die Handlungen vorzunehmen, die den Eintritt des Leistungserfolges (Verschaffung mangelfreien Eigentums und Übergabe) am Ablieferungsort bewirken: Beauftragung und Anweisung eines Transporteurs, Aussonderung der mangelfreien Ware und Übergabe der Ware an die beauftragte Transportperson.
Die Bringschuld ergibt sich indirekt aus § 269 Abs. 3, nämlich als diejenige Schuldart, bei der der Ort, nach welchem die Versendung zu erfolgen hat, auch der Leistungsort sein soll. Leistungs- und Erfolgsort fallen hier zusammen. Das ist beispielsweise beim Kauf mit Montageverpflichtung anzunehmen, wenn die Sache beim Empfänger montiert werden soll.[32]
117
Um § 447 anwenden zu können, genügt die Feststellung, dass sich die Parteien darauf verständigt haben, dass der Käufer die Ware nicht abholen muss, sondern geliefert bekommt, noch nicht. Dann ist erst einmal nur entschieden, dass keine Holschuld vorliegen kann. Es kommen aber noch Bringschuld und Schickschuld (= Versendungskauf) in Betracht, die nun voneinander abgegrenzt werden müssen.
Ob eine Schickschuld i.S.d. § 447 oder eine Bringschuld vereinbart wurde, bedarf meistens der Auslegung, da eine ausdrückliche Vereinbarung zum Leistungsort regelmäßig fehlt. Da die Übernahme der Transportkosten durch den Verkäufer nach § 269 Abs. 3 noch kein Indiz für die Vereinbarung einer Bringschuld ist und § 269 Abs. 1 und Abs. 2 den Leistungsort „im Zweifel“ dem Sitz des Schuldners zuweist, ist bei Versendungsfällen im Zweifel von einer Schickschuld auszugehen.[33]
118
Die h.M. interpretiert das Merkmal „Ort“ i.S.d. § 447 Abs. 1 als konkrete Lieferadresse und nicht im Sinne „Gebietskörperschaft“, also nach den kommunalen Grenzen. Damit ist § 447 auch bei Versendungen innerhalb einer Gemeinde anwendbar.[34]
Beispiel
V hat seinen Geschäftssitz in Berlin-Friedrichshain. K möchte, dass V ihm die Ware zu sich nach Hause in Berlin-Zehlendorf zusendet.
Die andere Ansicht mag zwar den Wortlaut auch für sich in Anspruch nehmen, führt aber zu unsinnigen Ergebnissen und ist deshalb abzulehnen: Versendet ein Verkäufer einen Gegenstand in ländlicher Gegend, so können die Gemeindegrenzen schon bei einem Transportweg von wenigen Kilometern überschritten werden. Es ist aber nicht einzusehen, warum dieser Verkäufer besser stehen sollte als derjenige, der eine Sache innerhalb einer Großstadt 30 km weit transportieren muss. Das Transportrisiko wird von der Frage, ob die „virtuellen“ Grenzen einer Gebietskörperschaft überquert werden, nicht berührt.
dd) Sonderfall: Absendung außerhalb des Verkäufersitzes
119
Es kann vorkommen, dass der Verkäufer die Ware gar nicht bei sich hat, sondern ausgelagerte oder „rollende“, auf dem Antransport befindliche Ware verkauft hat. Denkbar ist auch, dass die verkaufte Ware direkt vom Lieferanten des Verkäufers an den Käufer verschickt werden soll.
Beispiel
V mit Geschäftssitz in Köln soll die Ware dem K nach Berlin (Ablieferungsort) versenden. Die Ware befindet sich im Lager des V in Kassel und wird von dort direkt per Kurier nach Berlin geschickt.
Wenn sich der Käufer mit einer Versendung von einem anderen Ort als dem Sitz des Verkäufers aus (Vereinbarung etwa: „Lieferung ab Lager Kassel“) einverstanden erklärt hat, haben die Parteien den Absendeort einvernehmlich festgelegt und damit einen speziellen Leistungsort i.S.d. § 269 Abs. 1 bestimmt. Die Gefahr geht dann bei Übergabe der Ware an die Transportperson am betreffenden Ort auf den Käufer über. In diesen Fällen fallen Absendeort und Leistungsort in Wahrheit gar nicht auseinander.
Hinweis
Denken Sie immer daran, dass sich der Leistungsort nach § 269 nur „im Zweifel“ am Sitz des Schuldners befindet. Er kann bei abweichender Festlegung auch ganz woanders liegen!
120
Kommt § 447 aber auch dann zur Anwendung, wenn die Versendung von einem anderen Ort als dem Leistungsort erfolgt? Im Beispiel liegt dieser Fall vor, wenn K keine Kenntnis vom Lagerort der Ware hatte und nach der Vereinbarung davon ausgehen konnte, die Lieferung erfolge ab dem Sitz des Verkäufers in Köln.
Die h.M. hält § 447 nur für anwendbar, wenn der Leistungsort Ausgangspunkt der Versendung ist. Sie argumentiert, anderenfalls liege in der Versendung gerade keine dem Käufer ersparte Wegstrecke (= Abholung der Sache am Leistungsort) vor.[35] Schließlich hätte der Verkäufer ohne Versendungsvereinbarung die Ware ohnehin zu sich verschaffen müssen. Es erscheint unbillig, das Transportrisiko wegen des Versendungsverlangens nun vollständig auf den Käufer abwälzen zu können. Andere vertreten demgegenüber, § 447 müsse auch in diesen Fällen anwendbar sein, solange nur die Transportgefahr durch die Verschiedenheit von Leistungs- und Absendeort nicht erhöht werde.[36]
JURIQ-Klausurtipp
Beide Ansichten sind gut vertretbar. Für die Auffassung der h.M. spricht, dass sie den Anwendungsbereich des § 447 klarer eingrenzt und dass der Verkäufer den Leistungsort nicht eigenmächtig verlegen kann. Die Gegenauffassung muss sich vorhalten lassen, dass sie mit dem Kriterium der „Gefahrerhöhung“ keine verlässliche Eingrenzung des § 447 erreichen kann.
ee) Auslieferung an Transportperson
121
Nach § 447 geht die Gefahr in dem Moment auf den Käufer über, in dem der Verkäufer „die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat.“
Eine „Auslieferung“ i.S.d. § 447 liegt in dem Moment vor, in dem der Verkäufer alles getan hat, um den erfolgreichen Transport an die Versandadresse zu bewirken:[37] Übergabe der ordnungsgemäß verpackten Ware an den Transporteur, Kennzeichnung der Versandadresse, Zahlung des Beförderungsentgelts, etc.
122
Umstritten ist, ob auch eigene Mitarbeiter des Verkäufers bzw. dieser selber Transportperson i.S.d. § 447 sein kann. Dies hätte zur Folge, dass im Versendungskauf auch der eigene Transport mit Mitteln des Verkäufers den frühen Gefahrübergang nach § 447 herbeiführt.
Beispiel
Winzer W hat dem K 10 Kisten Riesling verkauft. K bittet ihn, den Wein an seinen Wohnort zu übersenden. W hat etliche Kunden zu beliefern, die in der Nähe des K wohnen. Er beauftragt deshalb seinen Angestellten A damit, den Transport durchzuführen. Die gesamte Ware geht infolge eines von A nicht verschuldeten Verkehrsunfalls unter. Der Unfallverursacher bleibt unbekannt. Muss K den vereinbarten Kaufpreis entrichten, obwohl er den Wein nicht erhält?
123
Im Beispiel ist nun entscheidend, ob der Angestellte A eine „sonst zur Versendung bestimmte Person“ im Sinne des § 477 Abs. 1 ist: Dafür spricht auf den ersten Blick der Wortlaut der Norm, die keinerlei Einschränkung erhält. Zweifel ergeben sich allenfalls aus dem Zusammenhang mit den beispielhaft genannten Transportpersonen. Denn Spediteur und Frachtführer sind gegenüber dem Verkäufer eigenverantwortliche, selbstständige Dritte.
Die wohl h.M. wendet § 447 auf den Transport durch eigene Leute und sogar auch auf den Transport durch den Verkäufer persönlich an.[38] Der Verkäufer verdiene das mit dem frühen Gefahrübergang verbundene Privileg auch dann, wenn er den Versand selber übernehme. Schließlich dürfe er wegen seiner freiwilligen und häufig auch sicheren Vorgehensweise nicht benachteiligt werden. Außerdem bestehe kein wesentlicher Wertungsunterschied, da in allen Fällen entscheidend sei, dass der Verkäufer dem Käufer entgegenkomme und ihm die Abholung der Sache erspare.
Die Gegenansicht beruft sich auf den Wortlaut und darauf, die Rechtfertigung für den frühen Gefahrübergang sei vor allem in der Tatsache zu sehen, dass der Transport außerhalb des Herrschaftsbereichs des Verkäufers erfolge. Führe der Verkäufer den Transport selbst oder mit eigenen Leuten durch, sei die Sache aber weiterhin in seiner Obhut und seinem Herrschaftsbereich, so dass er des Schutzes durch § 447 nicht bedürfe.[39]
Je nachdem, welcher Ansicht man sich anschließt, hat W im Beispiel den Anspruch auf Kaufpreiszahlung gegen K gem. § 326 Abs. 1 S. 1 verloren oder nicht.
124
Folgt man der h.M. muss man beim Transport durch eigene Leute großes Augenmerk auf die Frage richten, ob der Untergang/Verschlechterung wirklich „zufällig“, also vom Verkäufer nicht zu vertreten ist. Nehmen wir einmal an, im vorigen Beispiel sei der Unfall vom A verschuldet worden. Einer Zurechnung seines Verschuldens nach § 278 könnte entgegenstehen, dass der Verkäufer (W) zum Transport bei vereinbarter Schickschuld ja nicht verpflichtet ist und der A deshalb nicht „zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit“ i.S.d. § 278 tätig wird.
Doch ist allgemein anerkannt, dass § 278 auch dann Anwendung findet, wenn der Schuldner Dritte willentlich bei der Wahrung seiner Rücksichtspflichten i.S.d. § 241 Abs. 2 einschaltet.[40] Indem der Verkäufer sich für den Transport „auf eigene Faust“ entscheidet, erhält er ja keinen Freibrief, mit der verkauften Sache rücksichtslos verfahren zu können. Im Hinblick auf das Erfüllungsinteresse seines Käufers schuldet er gem. § 241 Abs. 2 jedes zumutbare Verhalten, das vorhersehbaren Gefahren für die von ihm transportierte Ware vermeidet. Aufgrund der selbst gewählten Obhut über die Sache auf dem Transportweg, ist der Verkäufer stärkeren Rücksichtspflichten ausgesetzt als im Fall des Transports durch fremde Personen, wo ihm Einwirkungsmöglichkeiten während des Transports fehlen. Wird die Pflicht zur Gefahrvermeidung durch einen Mitarbeiter auf dem Transport schuldhaft verletzt, muss V sich dies nach § 278 zurechnen lassen. Kommt es infolge des Verschuldens zu einem Untergang/einer Verschlechterung der Sache, liegt kein Zufall i.S.d. § 447 vor.[41]
Hinweis
Im Fall des Transports durch fremde Personen kommt eine dem Verkäufer nach § 278 zurechenbare Rücksichtspflichtverletzung während des Transports nicht in Betracht. § 278 ist zum einen deshalb nicht anwendbar, weil der Transporteur nicht im Leistungspflichtenkreis des Schuldners tätig wird (s.o.). Zum anderen schuldet der Verkäufer während des Transports durch fremde Personen mangels eigener Beteiligung kein besonderes Verhalten im Umgang mit der Sache. Auch insoweit können fremde Transportpersonen also keine Erfüllungsgehilfen des Verkäufers sein.
Ein dem Verkäufer zurechenbares Verschulden ist aber beispielsweise im Vorfeld der Versendung denkbar, etwa wenn die Ware fehlerhaft verpackt wurde und deshalb Transportschäden entstehen. Die ordnungsgemäße Verpackung gehört schließlich noch zum Pflichtenkreis des Verkäufers.[42]