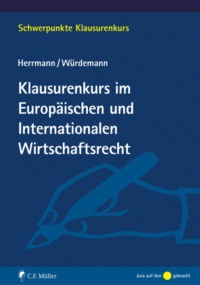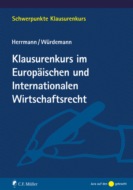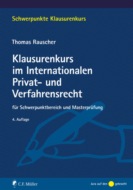Kitabı oku: «Klausurenkurs im Europäischen und Internationalen Wirtschaftsrecht», sayfa 6
Fall 1 Integration? Nein, danke!
Inhaltsverzeichnis
Vorüberlegungen
Gliederung
Lösungsvorschlag
Wiederholung und Vertiefung
66
Der EU-Mitgliedstaat Alonien (A) teilt der Europäischen Union (EU) gemäß Art. 50 Abs. 2 S. 2 EUV mit, dass er aus der Europäischen Union auszutreten beabsichtigt. Erörtern Sie die Bedeutung dieser Entscheidung und beantworten Sie dabei im Einzelnen die folgenden Fragen:
| 1) | Welche Art von wirtschaftlicher Integrationsgemeinschaft stellt die Union dar und welche Elemente wirtschaftlicher Integration umfasst diese? |
| 2) | Wie hat sich die europäische Wirtschaftsintegration inner- und außerhalb der Union historisch entwickelt? |
| 3) | Welche unions- und wirtschaftsvölkerrechtlichen Regeln würden zwischen der Union und A im Hinblick auf die wirtschaftlichen Beziehungen unter der Annahme gelten, dass eine vertragliche Regelung der zukünftigen Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Union und A nicht erreicht wird? |
| 4) | Welche Art von Abkommen zur Regelung der zukünftigen Beziehungen zwischen der Union und A sind vorstellbar? Welche unions- und wirtschaftsvölkerrechtlichen Voraussetzungen sind dabei zu beachten? Welche Vor- und Nachteile bieten die einzelnen Möglichkeiten? |
| 5) | Wie wirkt sich der Austritt aus der Union auf bilaterale Investitionsschutzverträge von A aus, die a) mit anderen Mitgliedstaaten der Union geschlossen worden sind? b) mit Staaten außerhalb der Union geschlossen worden sind? |
Fall 1 Integration? Nein, danke! › Vorüberlegungen
Vorüberlegungen
67
Bei der vorliegenden, durchaus schwierigen Klausur handelt es sich weniger um eine klassische juristische Fallgestaltung, die im Rahmen eines rechtlichen Gutachtens zu bewerten ist, als um schlichte rechtliche Fragestellungen, die allerdings nicht weniger strukturiert als in einem Rechtsgutachten und nicht weniger am Gesetzestext (soweit möglich) beantwortet werden sollen. Angesichts des Umfangs der Aufgabenstellung ist eine Abfassung im Urteils- bzw. Essaystil erlaubt sowie eine Schwerpunktsetzung vonnöten.
Kern der Fragestellungen ist der EU-Austritt von A sowie dessen wirtschaftsvölker- und unionsrechtliche Implikationen. Die Fragen 1, 2 und 4 zielen insbesondere auf die Heranziehung der unterschiedlichen regionalen Wirtschaftsintegrationsstufen (Antidiskriminierungsregime – Freihandelszone – Zollunion – Binnenmarkt – Währungsunion) ab, die sowohl die historische Integrationsentwicklung der Union prägen als auch Ausgangspunkt für die Lösung regionaler Desintegrationsentwicklungen etwa im Rahmen eines EU-Austritts sein können. Frage 3 fordert dagegen die Beschreibung der wesentlichen Inhalte des WTO-Regimes. Frage 5 erweitert die Klausur auf die Behandlung möglicher Auswirkungen des EU-Austritts von A auf den Investitionsschutz und verlangt für die Bewertung der intra- und extra-EU BITs von A grundlegende Kenntnisse sowohl im allgemeinen Völkerrecht als auch im internationalen Investitionsschutzrecht.
Fall 1 Integration? Nein, danke! › Gliederung
Gliederung
68
| Frage 1 | ||||
| I. | Beschreibung des Binnenmarktes i.S.v. Art. 26 Abs. 2 AEUV | |||
| 1. | Zollunion als Grundlage des Binnenmarktes | |||
| 2. | Liberalisierung des Dienstleistungs-, Personen- und Kapitalverkehrs | |||
| 3. | Bestehen eines Wettbewerbsregimes | |||
| II. | Beschreibung der Wirtschafts- und Währungsunion | |||
| III. | Zusammenfassung | |||
| Frage 2 | ||||
| I. | Von der Vollendung der Zollunion zur Vollendung des Binnenmarktes | |||
| II. | Gründung der EFTA als Gegengewicht zur EWG | |||
| III. | Verbindung von Union und EFTA zum EWR | |||
| IV. | Errichtung einer Währungsunion | |||
| Frage 3 | ||||
| I. | Anwendung des im Verhältnis zu Drittstaaten einschlägigen Unionsrechts | |||
| II. | Wirtschaftsvölkerrechtlicher Rahmen | |||
| 1. | Formaler Mitgliedschaftsstatuts von A in der WTO | |||
| 2. | Umfang des WTO-rechtlichen Regulierungsregimes | |||
| Frage 4 | ||||
| I. | Darstellung der möglichen Abkommensarten einschließlich etwaiger Vor- und Nachteile | |||
| 1. | Option 1: Aushandlung eines Freihandelsabkommens | |||
| 2. | Option 2: Errichtung einer Zollunion | |||
| 3. | Option 3: Mitgliedschaft im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) | |||
| II. | Darlegung der unions- und wirtschaftsvölkerrechtlichen Voraussetzungen eines Abkommens über die zukünftigen Wirtschaftsbeziehungen mit A | |||
| 1. | Unionsrechtliche Voraussetzungen | |||
| 2. | Wirtschaftsvölkerrechtliche, insb. WTO-rechtliche Voraussetzungen | |||
| Frage 5 | ||||
| I. | Rechtliche Auswirkungen des EU-Austritts auf intra-EU BITs von A | |||
| 1. | Völkerrechtliche Bewertung der intra-EU BITs | |||
| 2. | Unionsrechtliche Bewertung der intra-EU BITs | |||
| 3. | Ergebnis | |||
| II. | Auswirkungen des EU-Austritts auf extra-EU BITs von A | |||
| 1. | Verstoß der extra-EU BITs gegen Art. 207 Abs. 1 AEUV | |||
| 2. | Übergangsregelung durch die BIT-Übergangs-VO | |||
| 3. | Wegfall der unionsrechtlichen Bindungswirkung nach dem EU-Austritt | |||
Fall 1 Integration? Nein, danke! › Lösungsvorschlag
Lösungsvorschlag
Frage 1: Welche Art von wirtschaftlicher Integrationsgemeinschaft stellt die Union dar und welche Elemente wirtschaftlicher Integration umfasst diese?
69
Die Europäische Union (EU) stellt grundsätzlich einen Binnenmarkt i.S.v. Art. 26 Abs. 2 AEUV dar, dessen Errichtung gemäß Art. 3 Abs. 3 UAbs. 1 S. 1 EUV als unionales Ziel bestimmt ist. Der Binnenmarkt umfasst einen Raum ohne Binnengrenzen und hat als wesentliche Bestandteile die unionsrechtlichen Grundfreiheiten (Warenverkehrsfreiheit, Art. 28 ff. AEUV; Arbeitnehmerfreizügigkeit, Art. 45 AEUV; Niederlassungsfreiheit, Art. 49 AEUV; Dienstleistungsfreiheit, Art. 56 AEUV; Kapitalverkehrsfreiheit, Art. 63 AEUV). Darüber hinaus ist gemäß Art. 3 Abs. 4 AEUV Ziel der Union die Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion mit dem Euro als einheitliche Währung.[1]
I. Beschreibung des Binnenmarktes i.S.v. Art. 26 Abs. 2 AEUV
1. Zollunion als Grundlage des Binnenmarktes
70
Grundlage des Binnenmarktes ist die Zollunion i.S.v. Art. 28 Abs. 1, 30 AEUV, für die die Union gemäß Art. 3 Abs. 1 lit. a AEUV die ausschließliche Zuständigkeit innehat. Unabdingbares Element der Zollunion ist die Beseitigung von Zöllen für den innerunionalen Handel, der durch das absolute Verbot von Ein- und Ausfuhrzöllen oder Abgaben gleicher Wirkung im Warenaustausch zwischen den Mitgliedstaaten gemäß Art. 28 Abs. 1, 30 AEUV bewirkt wird. Darüber hinaus besteht im Verhältnis zu Drittstaaten ein unionales Außenhandelsregime, das zum einen durch einen gemeinsamen Außenzolltarif, dessen Sätze gemäß Art. 26 AEUV durch den Rat festgelegt werden, zum anderen durch die gemeinsame Außenhandelspolitik gemäß Art. 206, 207 AEUV, die nach einheitlichen Grundsätzen gestaltet wird und ebenfalls in der ausschließlichen Zuständigkeit der Union gemäß Art. 3 Abs. 1 lit. e AEUV liegt, gekennzeichnet ist.[2]
71
Das warenverkehrsrechtliche Regulierungsregime des AEUV wird über das Zollverbot hinaus durch das grundsätzliche Verbot von mengenmäßigen Ein- und Ausfuhrbeschränkungen und Maßnahmen gleicher Wirkung gemäß Art. 34, 35 AEUV sowie das (grundsätzliche) Verbot steuerlicher Diskriminierung gemäß Art. 110 AEUV komplementiert.[3] Diese Verbote führen in ihrer weiten Interpretation zu einem weitreichenden Verbot nicht-tarifärer Hemmnisse für den Warenverkehr. So ist nach der Dassonville-Formel des Gerichtshofs jede Maßnahme gleicher Wirkung i.S.v. Art. 34 AEUV verboten, die den innerunionalen Warenhandel unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potentiell behindert (siehe dazu vor allem Fall 2, Rn. 154 ff.).[4]
2. Liberalisierung des Dienstleistungs-, Personen- und Kapitalverkehrs
72
Neben dem Warenhandel sind auch der Dienstleistungshandel als weitere Produktfreiheit sowie der Personenverkehr (Arbeitnehmerfreizügigkeit und Niederlassungsfreiheit) und der Kapitalverkehr im unionalen Binnenmarkt vollumfänglich liberalisiert. Die Grundfreiheiten enthalten nicht nur ein Diskriminierungsverbot, das sowohl offene als auch faktische Ungleichbehandlungen grundsätzlich verbietet, sondern auch ein umfassendes Beschränkungsverbot, nach dem jede mitgliedstaatliche Maßnahme untersagt ist, die die Grundfreiheitsausübung behindert oder weniger attraktiv macht (Gebhard-Formel).[5] Für das Beschränkungsverbot ist maßgeblich, dass durch eine mitgliedstaatliche Maßnahme der unionale Binnenmarkt nicht fragmentiert bzw. der jeweils angestrebte Marktzugang nicht beeinträchtigt wird (bezüglich der Warenverkehrsfreiheit siehe die Keck-Formel[6] bzw. in neuerer Rechtsprechung die sogenannte Dreistufenprüfung[7]; siehe dazu Fall 2, Rn. 154 ff.).
3. Bestehen eines Wettbewerbsregimes
73
Vor dem Hintergrund der vollumfassenden Liberalisierung sowohl des Waren- und Dienstleistungshandels als auch der Produktionsfaktoren (Arbeitnehmerfreizügigkeit, Niederlassungs- und Kapitalverkehrsfreiheit) beinhaltet der AEUV gemäß Art. 101, 102 AEUV bzw. Art. 107 AEUV zudem ein kartell- bzw. beihilfenrechtliches Wettbewerbsregime, das eine Verfälschung oder Beschränkung des innerunionalen Wettbewerbs verhindern soll.[8] Auch im Hinblick auf die Festlegung der für das Funktionieren des Binnenmarktes erforderlichen Wettbewerbsregeln liegt die ausschließliche Zuständigkeit gemäß Art. 3 Abs. 1 lit. c AEUV bei der EU.
II. Beschreibung der Wirtschafts- und Währungsunion
74
Zu den vorgenannten binnenmarktrechtlichen Integrationselementen tritt gemäß Art. 3 Abs. 4 EUV die Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion mit der einheitlichen Währung, dem „Euro“, hinzu. Dabei ist zwischen den Elementen der Wirtschaftspolitik und Währungspolitik zu unterscheiden. Die Durchführung der Währungspolitik liegt gemäß Art. 3 Abs. 1 lit. c AEUV in der ausschließlichen Zuständigkeit der der Union und erfolgt durch das Europäische System der Zentralbanken (ESZB), das gemäß Art. 127 Abs. 2 AEUV die Geldpolitik für die Union bzw. die Eurozone festlegt und ausführt. Die zentrale Rolle innerhalb des ESZB nimmt dabei die Europäische Zentralbank (EZB) als Unionsorgan ein.
75
Die Festlegung der Wirtschaftspolitiken verbleibt dagegen grundsätzlich in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Auf unionaler Ebene findet gemäß Art. 5 Abs. 1 UAbs. 1 S. 1 AEUV i.V.m. Art. 119 Abs. 1 AEUV lediglich eine enge wirtschaftspolitische Koordinierung statt. Diese ist gemäß Art. 119 Abs. 1, 120 S. 2 AEUV dem Grundsatz der offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb verpflichtet.[9] Angesichts der lediglich koordinationsbasierten wirtschaftspolitischen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten ist deren Verpflichtung zur Vermeidung übermäßiger öffentlicher Defizite gemäß Art. 126 Abs. 1 AEUV und damit zur soliden Haushaltspolitik von besonderer Bedeutung. Die Haushaltdisziplin drückt sich gemäß dem Defizitprotokoll i.V.m. Art. 126 Abs. 2 S. 2 AEUV durch die Einhaltung der Referenzwerte von maximal 3% Nettoneuverschuldung und maximal 60% des Bruttoinlandprodukts als Gesamtschuldenstand aus. Zu beachten ist, dass die Pflicht zur Vermeidung öffentlicher Defizite gemäß Art. 139 Abs. 2 S. 1 lit. b AEUV für die Euro-Mitgliedstaaten uneingeschränkt gilt. Wenngleich Einhaltung der Haushaltsdisziplin gemäß Art. 126 Abs. 10 AEUV nicht im Rahmen eines Vertragsverletzungsverfahrens durchsetzbar ist, enthält Art. 126 Abs. 2 bis 11 AEUV ein von der Kommission und dem Rat durchgeführten Überwachungsmechanismus einschließlich etwaiger Sanktionierungsmöglichkeiten durch den Rat.[10] Die Durchsetzung der Haushaltsdisziplin ist umfassend sekundärrechtlich ausgestaltet (siehe eine typische Fallkonstellation zur Finanz- und Staatsschuldenkrise in Fall 13, Rn. 771 ff.).[11]
III. Zusammenfassung
76
Die Union hat mit dem Binnenmarkt, dessen Fundament eine Zollunion ist, einen über die mitgliedstaatlichen Grenzen hinweg gemeinsamen Markt errichtet, in dem neben dem Waren- und Dienstleistungshandel auch die wesentlichen Produktionsfaktoren vollumfänglich liberalisiert sind. Ein Wettbewerbsregime schützt zudem den freien Wettbewerb innerhalb der EU. Einen weiteren weitreichenden Integrationsschritt haben einige Mitgliedstaaten mit der Einführung des Euro als gemeinsame Währung und der damit verbundenen Währungsunion gemacht. Im Hinblick auf die Wirtschaftspolitik beschränkt sich die Union allerdings auf eine wirtschaftspolitische Koordinierung.
Frage 2: Wie hat sich die europäische Wirtschaftsintegration inner- und außerhalb der Union historisch entwickelt?
I. Von der Vollendung der Zollunion zur Vollendung des Binnenmarktes
77
Mit dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG; seit dem Vertrag von Maastricht EG-Vertrag; seit dem Vertrag von Lissabon AEUV) im Rahmen der Römischen Verträge vom 27.3.1957 vereinbarten die Gründungsstaaten (Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande) die Verwirklichung eines sogenannten Gemeinsamen Marktes, der innerhalb einer Übergangszeit von zwölf Jahren erreicht werden sollte. Mit der Einführung eines gemeinsamen Zolltarifs gegenüber Drittstaaten und der Beseitigung von Binnenzöllen wurde bereits am 1. Juni 1968 die Integrationsstufe der Zollunion verwirklicht.[12]
Darüber hinaus befindet sich die Union jeweils in einer Zollunion mit Andorra (seit dem 1.1.1991), San Marino (seit dem 1.4.2002) und der Türkei (seit dem 31.12.1995).
78
Hinweis:
Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) gehörte zum Verbund der Europäischen Gemeinschaften, dem ebenfalls die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) sowie die Europäische Atomgemeinschaft (Euratom) angehörten. Demgegenüber stellte die Europäische Gemeinschaft (EG) (als Nachfolgerin der EWG) neben der Polizeilichen und Justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen (PJZS) sowie der Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) eine Säule der Europäischen Union dar, die 1992 mit dem Vertrag von Maastricht gegründet und mit dem Vertrag von Lissabon in die heutige Union überführt wurde. Dabei wurde die Säulenstruktur weitgehend aufgegeben.
79
Nachdem bereits infolge der Dassonville-Rechtsprechung des Gerichtshofs aus dem Jahr 1974 die Marktöffnung im Hinblick auf nicht-tarifäre Handelshemmnisse innerhalb der EWG erhöht werden konnte, die positive Integration durch Rechtsangleichung allerdings (vor allem aufgrund des Einstimmigkeitserfordernisses für derartige Maßnahmen) ins Stocken geraten war, entwickelte die Kommission im Jahre 1985 ein sogenanntes Weißbuch über die Vollendung des Binnenmarktes, das insbesondere Vorschläge zur Harmonisierung von wesentlichen Rechtsvorschriften enthielt, die dem Funktionieren des Binnenmarktes entgegenstanden. Infolgedessen legte die am 1.7.1987 in Kraft getretene Einheitliche Europäische Akte (EEA) die Vollendung des Binnenmarktes, d.h. einem Raum ohne Binnengrenzen, bis zum 31. Dezember 1992 fest. Die EEA bewirkte im Wesentlichen die Umstellung vom Einstimmigkeits- zum Mehrheitserfordernis für Binnenmarktrechtssetzung (vgl. Art. 110a EWGV, heute Art. 114 AEUV) und gab die Schaffung des Binnenmarktes nunmehr vor.[13]