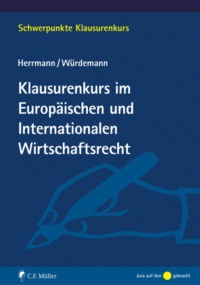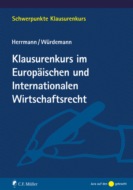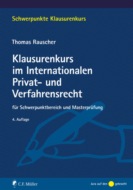Kitabı oku: «Klausurenkurs im Europäischen und Internationalen Wirtschaftsrecht», sayfa 7
II. Gründung der EFTA als Gegengewicht zur EWG
80
Parallel bzw. als Gegengewicht zur EWG wurde im Jahre 1960 die Europäische Freihandelsassoziation gegründet (European Free Trade Association [EFTA]), der heute die Staaten Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz angehören. Ursprünglich gehörten weitere Staaten wie Dänemark oder das Vereinte Königreich der EFTA an, die allerdings 1973 der EWG beitraten. Die EFTA begründet zwischen ihren Mitgliedern eine Freihandelszone.
III. Verbindung von Union und EFTA zum EWR
81
Nach der Gründung der Europäischen Union durch den Vertrag von Maastricht schlossen die EG- sowie EFTA-Staaten (außer der Schweiz) das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ab, das am 1. Januar 1994 in Kraft trat. Der EWR stellt eine vertiefte Freihandelszone dar, die stark mit dem unionsrechtlichen Binnenmarkt verwoben ist. Zum einen kennt auch das EWR-Abkommen die im AEUV enthaltenen Grundfreiheiten, zum anderen sind die EWR-Staaten, d.h. insbesondere die Nicht-EU-Mitglieder verpflichtet, unionales Sekundärrecht nach Entscheidung im Gemeinsamen EWR-Ausschuss in das innerstaatliche Recht zu übernehmen und so nicht-tarifäre Handelshemmnisse abzubauen. Dies betrifft in erster Linie die den Binnenmarkt prägenden Harmonisierungsvorschriften der EU.[14] Hingegen stellt der EWR gerade keine Zollunion dar.
IV. Errichtung einer Währungsunion
82
Mit der Errichtung der Währungsunion erhält der europäische Binnenmarkt im Rahmen der Euro-Zone eine einheitliche Währung, nämlich den Euro. Notwendiges Beiwerk der Einheitswährung ist eine einheitliche Geldpolitik, die gemäß Art. 127 Abs. 1 AEUV durch das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) bestimmt wird und deren vorrangiges Ziel die Gewährleistung der Preisstabilität ist. Der Euro ist seit dem 1. Januar 1999 Gemeinschaftswährung, die Ausgabe von Euro-Scheinen und Münzen erfolgt allerdings erst seit dem 1. Januar 2002.[15] Bislang haben 18 EU-Mitgliedstaaten den Euro eingeführt und bilden das Euro-Währungsgebiet.
Frage 3: Welche unions- und wirtschaftsvölkerrechtlichen Regeln würden zwischen der Union und A im Hinblick auf die wirtschaftlichen Beziehungen unter der Annahme gelten, dass eine vertragliche Regelung der zukünftigen Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Union und A nicht erreicht wird?
83
Im Falle eines Austritts von A aus der Union ohne die Vereinbarung eines bilateralen Handels- und Wirtschaftsabkommens zur Regelung der zukünftigen Wirtschaftsbeziehungen würde A im Verhältnis zur Union Drittstaat werden. Zwar kann nicht von Art. IX WTO-Übereinkommen, nach dem die Union über die Anzahl der Stimmen verfügt, die der Anzahl der EU-Mitgliedstaaten entspricht, auf eine WTO-Mitgliedschaft von A geschlossen werden, da die Stimmenübertragung auf Union nur für diejenigen EU-Mitglieder gilt, die auch WTO-Mitglied sind. Allerdings ist angesichts der Tatsache, dass das WTO-Übereinkommen als gemischtes Abkommen von der Union und den Mitgliedstaaten abgeschlossen worden ist, davon auszugehen, dass sich A ebenfalls dem WTO-Regime verpflichtet hat.
I. Anwendung des im Verhältnis zu Drittstaaten einschlägigen Unionsrechts
84
Das unionale Binnenmarktkonzept verlangt zwar grundsätzlich einen Raum ohne Grenzen im Verhältnis zwischen den Mitgliedstaaten, sodass A etwa nicht mehr an die Grundfreiheiten gebunden ist; allerdings ist zu beachten, dass die Liberalisierung des Kapital- und Zahlungsverkehrs gemäß Art. 63 Abs. 1, 2 AEUV für alle Kapitalbewegungen zwischen den Mitgliedstaaten und Drittstaaten gilt – unabhängig von der Staatsangehörigkeit oder Ansässigkeit des Veranlassers oder des Empfängers. A würde damit auch nach dem EU-Austritt Begünstigter der unionalen Kapitalverkehrsfreiheit sein.
Darüber hinaus enthält das Unionsrecht weitere Vorschriften, die im Verhältnis zu Drittstaaten gelten. Dies ist vor allem der Fall bezüglich des Gemeinsamen Zolltarifs sowie der Instrumente der autonomen (gemeinsamen) Handelspolitik (Einfuhrregulierung, handelspolitische Schutzinstrumente), die auf Warenimporte aus Drittstaaten Anwendung finden.
II. Wirtschaftsvölkerrechtlicher Rahmen
1. Formaler Mitgliedschaftsstatuts von A in der WTO
85
A ist formal eigenständige Vertragspartei des WTO-Abkommens, dessen Rechtsstellung nach dem EU-Austritt von der parallelen Mitgliedschaft der Union gemäß Art. XI:1 WTO-Übereinkommen unberührt bleibt. Angesichts dessen ist der Rückfall auf die WTO-rechtlichen Vorschriften bei Nicht-Erreichung eines Abkommens zwischen A und der Union über die zukünftigen Wirtschaftsbeziehungen zwangsläufige Folge des EU-Austritts.[16]
2. Umfang des WTO-rechtlichen Regulierungsregimes
86
Das Regulierungsregime der WTO begründet keinen Freihandel, sondern zielt auf die Erhöhung des Liberalisierungsgrades des internationalen Handels und damit auf einen freieren Handel ab. Es beinhaltet ein umfassendes Antidiskriminierungsregime sowie den „tariffs only“- und „bound tariffs“-Grundsatz.
a) Antidiskriminierungsregime des WTO-Rechts
87
In materieller Hinsicht basiert das WTO-System im Wesentlichen auf einem umfassenden Antidiskriminierungsregime, das den Grundsatz der Meistbegünstigung sowie denjenigen der Inländer(gleich)behandlung umfasst. Während nach dem Meistbegünstigungsgrundsatz ein gegenüber einem WTO-Mitglied gewährter Vorteil auf alle anderen WTO-Mitglieder auszuweiten ist (siehe Art. I GATT; Art. II GATS), verbietet die Inländerbehandlung die Schlechterstellung gleichartiger ausländischer Waren bzw. Dienstleistungen gegenüber inländischen nach deren Markteintritt (siehe Art. III GATT). Im Bereich des GATS besteht die Besonderheit, dass für den Umfang der Verpflichtungen die in den Listen i.S.v. Art. XI:1 GATS vorgenommenen Zugeständnisse maßgeblich sind.
b) „Tariffs only“-/„bound tariffs“-Grundsatz des GATT
88
Im Zusammenhang mit dem „tariffs only“-Grundsatz ist zunächst festzuhalten, dass die schlichte Erhebung von Zöllen nicht per se gegen WTO-Recht verstößt. Als offensichtliche Maßnahmen aufgrund des Grenzübertritts sind Zölle im WTO-Recht grundsätzlich ein legitimes Instrument zur Lenkung der Warenströme.[17] Normativ ergibt sich der „tariffs only“-Grundsatz aus Art. XI:1 GATT i.V.m. Art. II GATT. Dabei bestimmt Art. XI:1 GATT, dass Kontingente, Ein- bzw. Ausfuhrbewilligungen wie auch andere Maßnahmen, die den Marktzugang bzw. Marktaustritt von Waren in nicht-tarifärer Art und damit regelmäßig wenig transparenter Weise behindern, verboten sind (siehe dazu Fall 15, Rn. 902 ff.).[18] Art. II:1 GATT schreibt darüber hinaus die Zollbindung der WTO-Mitglieder an die gemäß Art. XI:1 WTO-Übereinkommen beizufügenden Listen der Zugeständnisse und Verpflichtungen vor („bound tariffs“). Die WTO-Mitglieder müssen mittels der Listen untereinander verbindliche Maximalzölle festlegen und dürfen die in den Listen festgelegte Maximalzölle nicht überschreiten.[19] Die Zolllisten sind gemäß Art. II:7 GATT ein Bestandteil des GATT. Mit dem Ausscheiden aus der Union gelten für A die im Rahmen der Zollunion festgelegten Zolllisten nicht mehr. Nach dem EU-Austritt bedarf es daher der Beifügung eigener Listen durch A, die allerdings zunächst auf denen der Union basieren müssten.
c) Beifügung eigener Listen von Zugeständnissen zum GATS
89
Eine ähnliche Problematik stellt sich im Zusammenhang mit dem GATS, dem gemäß Art. XI:1 WTO-Übereinkommen ebenfalls Listen spezifischer Verpflichtungen beizufügen sind.[20] Diese sind insbesondere maßgeblich für den Umfang der Verpflichtungen von A in Bezug auf den zu gewährenden Marktzugang gemäß Art. XVI GATS bzw. die zu gewährende Inländerbehandlung gemäß Art. XVII GATS. Mit dem EU-Austritt müsste A entsprechende eigene Listen vorlegen, da die bisher für A geltenden Listen lediglich diejenigen Listen der Union sowie ihrer Mitgliedstaaten sind, aus denen A seine Verpflichtungen aber ableiten kann.
Frage 4: Welche Arten von Abkommen zur Regelung der zukünftigen Beziehungen zwischen der Union und A sind vorstellbar? Welche Vor- und Nachteile bieten die einzelnen Möglichkeiten? Welche unionsrechtlichen und wirtschaftsvölkerrechtlichen Voraussetzungen sind dabei zu beachten?
I. Darstellung der möglichen Abkommensarten einschließlich etwaiger Vor- und Nachteile
1. Option 1: Aushandlung eines Freihandelsabkommen
90
Die Aushandlung eines Freihandelsabkommens würde im Vergleich zum WTO-Regime zu einem deutlich höheren wirtschaftlichen Integrationsgrad zwischen A und der Union führen. Das Abkommen könnte etwa nach dem Vorbild des EFTA-Abkommens oder des CETA-Abkommens als tiefer gehendes und umfassenderes Freihandelsabkommen ausgestaltet sein.
91
Vorteil eines Freihandelsabkommens zwischen A und der Union wäre zum einen ein privilegierter Zugang zum Binnenmarkt aufgrund der vollständigen Liberalisierung des Warenhandels zwischen A und der Union durch Abschaffung der Binnenzölle. Dass der Dienstleistungshandel von einem Freihandelsabkommen grundsätzlich nicht umfasst ist, ist in der Bewertung als Vor- oder Nachteil für A davon abhängig, welche Bedeutung dieser Bereich für die Volkswirtschaft von A hat. Jedenfalls sind Produktionsfaktoren wie der freie Personenverkehr im Rahmen von Freihandelsabkommen grundsätzlich nicht liberalisiert, sodass A den Zugang von Arbeitnehmern und Gesellschaften aus der Union zum einheimischen Markt unter Einhaltung der einschlägigen WTO-Vorschriften beschränken kann. So kann A insbesondere verhindern, dass inländische Marktteilnehmer nicht dem freien Wettbewerb mit EU-An-/Zugehörigen „ausgesetzt“ sind. Des Weiteren hätte ein Freihandelsabkommen den Vorteil, dass A nicht mehr an die binnenmarktrechtliche Harmonisierungsgesetzgebung der Union gebunden wäre. Infolge des generellen Wegfalls der primär- und sekundärrechtlichen Bindungswirkung gegenüber A wäre A auch der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (GHEU) nicht mehr unterworfen. Schließlich würde A nicht mehr dem mit der Zollunion einhergehenden Außenhandelsregime der Union unterfallen, sodass A seine Außenhandelspolitik, etwa die Festlegung eigener Zölle oder die Vereinbarung von Handels- und Wirtschaftsabkommen mit Drittstaaten, autonom bestimmen könnte.
92
Auf der anderen Seite verlöre A aber auch den Zugang zum Binnenmarkt, soweit er nicht Waren betrifft. Auch wäre ein Freihandelsabkommen mit dem Erfordernis von Ursprungsregeln verbunden, d.h. dass zwischen den verbleibenden 27 EU-Mitgliedstaaten (EU27) und A wieder Zollkontrollen stattfinden müssten. Darüber hinaus birgt die Wiedererlangung einer selbstbestimmten Außenhandelspolitik den nicht zu vernachlässigenden Nachteil, dass etwa die Erstellung eines eigenen Zolltarifs einschließlich einer dafür erforderlichen Nomenklatur oder die Verhandlung von Handels- und Wirtschaftsabkommen mit Drittstaaten erhebliche finanzielle und zeitliche Verwaltungs- und Verhandlungsressourcen binden.[21] Insbesondere verfügen die EU-Mitgliedstaaten infolge des gemeinsamen Außenhandelsregimes über kein einschlägiges eigenes Gesetzesrecht zur Regelung anwendbarer Zollsätze oder Einfuhrkontingente.[22] So müsste A zum einen etwa eigene Zolltarife für sämtliche nach A eingeführte Waren festsetzen, zum anderen durch den Abschluss eigener Wirtschafts- und Handelsabkommen mit Drittstaaten seine Außenhandelspolitik neu definieren. Auch wenn die von A vor oder während der EU-Mitgliedschaft abgeschlossen bilateralen Investitionsschutzabkommen nicht unwirksam geworden sind (siehe Frage 5), gelten die bisher in ausschließlicher Zuständigkeit von der Union abgeschlossenen Handels- und Wirtschaftsabkommen nicht auch für A nach dem EU-Austritt. A müsste folglich die im Rahmen der Union vorangetriebene regionale Wirtschaftsintegration, insbesondere im Bereich des Warenhandels eigenständig „aufholen“, um nicht – angesichts der weiter fortschreitenden globalen Integration – in eine außenhandelspolitische Isolation zu geraten.
2. Option 2: Errichtung einer Zollunion
93
Als weitere Option für die zukünftigen Wirtschaftsbeziehungen zwischen A und der Union kommt die Errichtung einer Zollunion in Betracht. Auch in diesem Falle hätte A einen aufgrund des freien Warenverkehrs privilegierten Zugang zum Binnenmarkt, ohne an die binnenmarktrechtlichen Vorschriften, insbesondere die unionale Arbeitnehmerfreizügigkeit sowie die Niederlassungsfreiheit gebunden zu sein. Allerdings würde auch eine Zollunion grundsätzlich nur den Waren-, nicht aber den Dienstleistungshandel erfassen. Vor allem für den Warenverkehr würde das Prinzip der freien Zirkulation (vgl. Art. 28 Abs. 2, 29 AEUV) gelten. Binnengrenzkontrollen könnten somit wegfallen.
94
Darüber hinaus wäre A dem Außenhandelsregime der Union unterworfen und könnte damit von der durch den Abschluss umfassender regionaler Integrationsabkommen fortschreitenden globalen Wirtschaftsintegration der Union profitieren – und gleichzeitig das Risiko einer außenhandelspolitischen Isolation bzw. die mit dem Abschluss entsprechender Abkommen mit Drittstaaten verbundenen Kosten vermeiden. Auch die Festsetzung eigener Zolltarife im Verhältnis zu Drittstaaten wäre nicht erforderlich, da das gesamte zollrechtliche und tarifliche Regelwerk auf die Vorschriften der Zollunion gestützt wäre.[23] Sofern für A die Wiedererlangung außenhandelspolitischer Souveränität allerdings maßgebliches Ziel des EU-Austritts ist, scheidet die Errichtung einer Zollunion grundsätzlich aus.
3. Option 3: Mitgliedschaft im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)
95
Als weitere Option könnte A eigenständige Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) werden. Der Austritt von A aus der Union bedeutet grundsätzlich zugleich dessen Ausscheiden aus dem EWR. Der EWR umfasst den EU-Binnenmarkt, d.h. die EU-Mitgliedstaaten, sowie die EFTA-Staaten (Island, Liechtenstein und Norwegen; die Schweiz ist zwar Teil der EFTA, ratifizierte das EWR-Abkommen jedoch nicht).
Vor dem Hintergrund, dass der EWR lediglich auf binnenmarktrechtlichen Elementen beruht, ohne jedoch außenhandelsrechtliche Elemente des AEUV zu übernehmen, hat dieser insbesondere den Vorteil, dass A den Bereich des Außenhandels autonom gestalten könnte. Ansonsten würde A zwar wirtschaftlich vom Zugang zum unionalen Binnenmarkt profitieren, wäre allerdings über den Waren- und Dienstleistungshandel hinaus zur Personenfreizügigkeit sowie zu einem gemeinsamen Wettbewerbsregime verpflichtet. Zudem wäre A gemäß Art. 6 des EWR-Abkommens weiterhin an die Rechtsprechung des GHEU gebunden, soweit der wesentliche Gehalt von Bestimmungen des EWR-Abkommens und des AEUV bzw. aufgrund derer erlassenen Rechtsakte identisch ist. In Bezug auf unionales Sekundärrecht verpflichtet das EWR-Abkommen des Weiteren zur Übernahme von unionsrechtlichen Verordnungen oder Richtlinien in das innerstaatliche Recht, soweit dies zuvor durch den sogenannten Gemeinsamen EWR-Ausschuss legitimiert wurde.
II. Darlegung der unions- und wirtschaftsvölkerrechtlichen Voraussetzungen eines Abkommens über die zukünftigen Wirtschaftsbeziehungen mir A
1. Unionsrechtliche Voraussetzungen
96
Vor dem Hintergrund, dass Art. 50 Abs. 2 S. 2 EUV lediglich die unionale Kompetenz zum Abschluss des Austrittsabkommens (unter Berücksichtigung des Rahmens für die künftigen Beziehungen) umfasst, nicht aber für den Abschluss eines Abkommens über die zukünftigen Wirtschaftsbeziehungen, ist kompetenziell in Bezug auf letzteres auf die Vorschriften der gemeinsamen Handelspolitik gemäß Art. 206, 207 AEUV zurückzugreifen, die gemäß Art. 3 Abs. 1 lit. e AEUV in der ausschließlichen Zuständigkeit der Union liegt. Gemäß Art. 207 Abs. 1 S. 1 AEUV i.V.m. Art. 216 Abs. 1 AEUV kann ausschließlich die Union insbesondere Waren- und Dienstleistungshandelsabkommen mit Drittstaaten abschließen. Beinhaltet das Abkommen allerdings vollumfassend den Investitionsbereich, ist zu beachten, dass lediglich die Regelung ausländischer Direktinvestitionen von der Außenhandelskompetenz der Union umfasst ist, nicht aber Portfolioinvestitionen (siehe dazu auch Fall 12, Rn. 743 ff.).[24] Das Abkommen bedürfte dann als gemischtes Abkommen zusätzlich der Zustimmung der Mitgliedstaaten. Alternativ käme ein Assoziierungsabkommen gemäß Art. 217 AEUV in Betracht, das auch handelspolitische Elemente umfassen könnte.
2. Wirtschaftsvölkerrechtliche, insb. WTO-rechtliche Voraussetzungen
97
Aus WTO-rechtlicher Sicht sind vor allem die einschlägigen Vorschriften betreffend wirtschaftliche Integrationsabkommen zu beachten, d.h. für den Warenhandel Art. XXIV GATT bzw. für den Dienstleistungshandel Art. V GATS, die sich in ihren materiellen Anforderungen an regionale Handelsabkommen stark ähneln. Art. XXIV GATT erlaubt grundsätzlich die Errichtung von Freihandelszonen bzw. Zollunionen, soweit die eingeführten Zölle und Handelsvorschriften für den Handel in ihrer Gesamtheit nicht höher oder einschränkender als vor der Bildung der jeweiligen Integrationsgemeinschaft sind (Art. XXIV:5 lit. a, b GATT) sowie das jeweilige Abkommen annähernd den gesamten Handel betrifft (Art. XXIV:8 lit. a, b GATT). Die Auslegung der dargelegten Begrifflichkeiten ist aufgrund ihrer Unbestimmtheit vergleichsweise schwierig. Nach dem Appellate Body in Turkey – Textiles ist „annähernd der gesamte Handel“ nicht das gleiche wie „der gesamte Handel“, bedeutet aber gleichzeitig deutlich mehr als „some of the trade“.[25] Zudem sind für die Bewertung sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte heranzuziehen.[26] In qualitativer Hinsicht ist etwa fraglich, inwiefern der Ausschluss ganzer Sektoren von der Binnenliberalisierung zu einer Unzulässigkeit eines in Rede stehenden Freihandelsabkommens gemäß Art. XXIV:5 lit. b, 8 lit. b GATT führt. So ließe sich etwa im Falle des Ausschlusses landwirtschaftlicher Erzeugnisse von der Binnenliberalisierung argumentieren, dass von Mitgliedern regionaler Integrationsabkommen nicht erwartet werden sollte, eine den Agrarhandel umfassende Vollharmonisierung im Rahmen eines Freihandelsabkommens durchzuführen, um die Anforderungen des Art. XXIV: 5 lit. b, 8 lit. b GATT zu erfüllen, wenn doch der Agrarhandel nach dem WTO-Recht ohnehin besonderen Regeln (siehe das Übereinkommen über die Landwirtschaft [LwÜ] [vgl. Art. 2 LwÜ]) unterliegt.[27] In quantitativer Hinsicht wird regelmäßig angenommen, dass ein Integrationsabkommen, das mindestens 90% des Handelsvolumens abdeckt, der Anforderung von „annähernd der gesamte Handel“ genügt.[28]
98
Für Dienstleistungsabkommen gelten gemäß Art. V GATS vergleichbare Anforderungen, nämlich die Erstreckung auf einen beträchtlichen sektoralen Geltungsbereich (Art. V:1 lit. a GATS) sowie keine Erhöhung des allgemeinen Niveaus der Hemmnisse für den Dienstleistungshandel in den jeweiligen (Teil-)Sektoren (Art. V:4 GATS). Hinsichtlich des Kriteriums des „beträchtlichen sektoralen Geltungsbereichs“ konkretisiert die Fußnote 1 zu Art. V GATS, dass diese Bedingung die Zahl der Sektoren, das betroffene Handelsvolumen und die Erbringungsformen (modes of supply i.S.v Art. I GATS) betrifft; insbesondere soll keine Erbringungsform in einem Integrationsabkommen ausgeschlossen sein.
99
Gemäß Art. XXIV:7 GATT bzw. Art. V:7 GATS besteht zudem eine Notifizierungsplicht für regionale Integrationsabkommen. Durch den Transparenzmechanismus für Regionale Handelsabkommen von 2006 wurde diese Notifizierungspflicht im Hinblick auf den maßgeblichen Zeitpunkt präzisiert. Danach sollen die WTO-Mitglieder im Rahmen einer frühzeitigen Bekanntmachung möglichst bereits die Aufnahme von Verhandlungen anzeigen, die auf den Abschluss eines Abkommens gerichtet sind. Die eigentliche Notifizierung soll „so früh wie möglich“, d.h. im Regelfall unmittelbar nach der völkerrechtlichen Ratifizierung und in jedem Fall vor der eigentlichen Anwendung des Abkommens erfolgen.[29] Der Transparenzmechanismus stellt allerdings allein ein zusätzliches verfahrensrechtliches Element dar, durch das die Transparenz der vielfältigen Abkommensbeteiligungen der WTO-Mitglieder und deren jeweiliger Inhalte erhöht werden soll. Materiell-rechtlich hat der Mechanismus keine Relevanz.