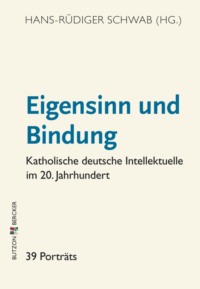Kitabı oku: «Eigensinn und Bindung», sayfa 10
Bilanz des Bittschriftunternehmens
„Über ten Hompel einen Satz zu schreiben, wäre unnütz; er scheint mir (u. vielen) an fixen Ideen zu leiden“,79 teilte der Münsteraner Kaplan und spätere Professor für Homiletik, Adolf Donders (1877 – 1944)80 seinem Kaplanskollegen und Freund Augustinus Winkelmann (1881 – 1954) in einem Brief mit. Die Urteile anderer Zeitgenossen gingen in eine ähnliche Richtung. Nach Ansicht des Index-Sekretärs Thomas Esser (1850 – 1926) war ten Hompel ein „confuser, harter Westfalenkopf“.81
Betrachtet man aus der Distanz von rund 100 Jahren die streitbaren, oft wenig systematischen Veröffentlichungen ten Hompels, seine Korrespondenz, die Protokolle von Sitzungen, dann wundern einen die Urteile seiner Zeitgenossen nicht. Ten Hompel scheint mit einem großen Selbstbewusstsein und mit viel Idealismus ausgestattet gewesen zu sein und hat mit großem zeitlichem und finanziellem Engagement für etwas gekämpft, was man wohl am besten mit dem Begriff „Laienemanzipation“ zusammenfassen kann. Aber glaubte der über die Grenzen Münsters hinaus praktisch unbekannte Gerichtsassessor ten Hompel selbst daran, dass er mit seiner Index-Petition etwas erreichen konnte? Aufschlussreich ist hier ein Brief an seinen Freund, den Historiker und späteren Rechtskatholiken Martin Spahn (1875 – 1945),82 den er als Unterzeichner gewinnen wollte. Ten Hompel führte aus: Auch wenn Spahn ihn als „Idealisten und Optimisten“ kenne, deckten sich ihre Ansichten über „die Unmöglichkeit des praktischen Enderfolgs“ der Bittschrift. Wörtlich heißt es weiter: „Unsere Generation erlebt nicht den Schatten eines Erfolgs in Rom. Was spätere Geschlechter aus der Summe unserer und anderer Schritte profitieren, können wir nicht abwägen. Allein dabei handelt es sich immer nur um den von Rom allein abhängigen Erfolg.“83
Von einem römisch geprägten Katholizismus wandte sich ten Hompel in den folgenden Jahrzehnten gänzlich ab und ließ sich zunehmend von nationalistischen und völkischen Ideen mitreißen. Abschließend sollen einige Schlaglichter auf seinen bislang noch nicht dokumentierten weiteren Lebensweg geworfen werden.
Übersteigerter Nationalismus und Abkehr vom Katholizismus
Im August des Jahres 1918 wandte sich ten Hompel in einer längeren Abhandlung unter dem Titel „Quo vadis“ in der Rheinisch-Westfälischen Zeitung gegen die Friedensresolution des Reichstages, die mit Unterstützung des Zentrumsabgeordneten Matthias Erzberger vorgebracht wurde.84 Ten Hompel machte sich in seinem viel beachteten Beitrag gegen einen Artikel der Verständigung und für einen „Siegfrieden“ stark.85
Von der Zentrumspartei, der er zwar nicht angehört, aber doch nahe gestanden hatte, distanzierte sich ten Hompel im Dezember 1918, nachdem er sich mit der lokalen Parteiführung überworfen hatte, und trat vorübergehend in die Deutschnationale Volkspartei ein, die er allerdings bereits im Mai 1920 wieder verließ.86
Nach einigen Jahren ohne Parteizugehörigkeit bemühte sich ten Hompel um Aufnahme in die NSDAP, die offenbar im Herbst 1933 erfolgte.87 Über den Präsidenten der physikalisch-technischen Reichsanstalt, Johannes Stark (1874 – 1957), versuchte er die Ernennung von Graf Clemens August von Galen (1878 – 1946) zum Bischof von Münster zu verhindern. Ten Hompel drängte Stark, Hitler vor von Galen zu warnen, der sich durch seine Schrift „Die Pest des Laizismus“ disqualifiziert habe.88 „Unser Führer muss diese an Roms Terror anlehnende Schrift gelesen haben und niemals mehr wird er Galen als Bischof der ultramontanen päpstlichen Hochburg Deutschlands, hier im nordischen Rom noch dulden.“ Von Galen müsse abgelehnt, Vizekanzler Franz von Papen ausgeschaltet und ein „Märtyrer-Bischof aus der Hitlerbewegung“ ernannt werden.89
Das Engagement für seine im Jahr 1907 grundgelegte Kulturgesellschaft sah ten Hompel nun in einer Linie mit dem nationalsozialistischen „Kampfbund für deutsche Kultur“ und stilisierte sich zum Vorkämpfer gegen Ultramontanismus und „Deutschfeindlichkeit der Kurie“ im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie.90 In einer Zusammenstellung seiner schriftstellerischen Arbeiten für die Reichsschrifttumskammer klagte er: „Die Ignorierung meines Schrifttums durch den Nationalsozialismus, dem ich die Wege seit 1908 und über meine Indicierung anno 1910 hinaus ebnete, den ich bewusst vorerlebte und bei sämtlichen Hitlerwahlen zielbewusst durch m. Schrifttum unterstützte, wie Professor Dr. Stark, Hitlers rechte Hand vor der Macht-Ergreifung bezeugen wird, – ist mir vollkommen rätselhaft.“ Voller Stolz verwies er auf seine Indizierung: „Vor Rosenberg war ich der einzige indicierte Laie Deutschlands.“91
Die Abschaffung des Index erlebte ten Hompel nicht mehr. Knapp fünf Jahre nach seinem Tod am 5. Dezember 1943 erschien das römische Verzeichnis der verbotenen Bücher ein letztes Mal.92 Erst im Jahr 1966 fiel die immer stärker werdende Kritik am Index librorum prohibitorum in Rom auf fruchtbaren Boden, und die Geltung der gut 500 Jahre alten Einrichtung wurde aufgehoben.93
Schriften von Adolf ten Hompel: Das furtum usus und die Nothwendigkeit seiner Bestrafung. Göttingen 1897 – Der Verständigungszweck im Recht. Ein Versuch zur Aufdeckung rechtpsychologischer Grundlinien unter besonderer Berücksichtigung der freien Wollensbedingung und ihrer gesetzlichen Hauptfälle im Kauf auf Probe, im Vorkaufs-, Rückkaufs-, Reu-, Rücktritts-, Wahlschuld-, Wandlungs-, Einigungs- und Eintragungs-Recht. Berlin 1908 – (Zus. M. Hermann Hellraeth und Josef Plaßmann:) Indexbewegung und Kulturgesellschaft. Eine historische Darstellung auf Grund der Akten herausgegeben. Bonn 1908 – Kiefl, Commer, Schell, in: Der Tag (B) v. 19. 8. 1908 – Über den Ursprung, die Entwicklung u. Abgrenzung des Rechts. Zwei Vorträge. Münster 1909 – (U. d. Pseudonym: Athanasius:) Das Cölner Osterdienstags-Protokoll. Ein Beitrag zur Würdigung latenter Kulturgegensätze im Katholizismus der Gegenwart. Bonn 1909 – Recht, Weltanschauung u. Praxis. Vortrag, geh. auf d. Ersten Kongress d. internationalen Vereinigung für Rechts- u. Wirtschafts-Philosophie. Berlin [u. a.] [1910] – Uditore Heiner und der Antimodernisteneid. Aphorismen und Eröffnungen zu Dr. Franz Heiners Schrift über die Maßregeln Pius’ X. unter Berücksichtigung einer brieflichen Äußerung Herman Schells. Münster [1910] – Der internationale Kongreß für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie. In: Hochland 7/II (1910), 497 – 499 – Tatsachen. Antwort auf Uditore Heiners Streitschrift. Münster 1911 – (Anonym:) Pro memoria. Ein Beitrag zur Krisis im deutschen Katholizismus. In: Die Wahrheit. Kathol. Kirchenzeitung für Deutschland. NF 1, Nr. 24 (15. September 1911), 369 – 373 – Die Verbrechens-Bekämpfung als Aufgabe des christlichen Staatswesens. Gedanken und Vorschläge zu Fiedrich Wilhelm Foersters Studie Schuld und Sühne, sowie zu Andreas Thomsens Grundriß des deutschen Verbrechens-Bekämpfungs-Rechtes. Ein Beitrag auch zur Reform des Strafrechts. Münster 1912 – Recht, Kunst, Moral und Sittlichkeitsverbrechen. In: Hochland 10/II (1912), 346 – 353 – Die Ausschaltung der kirchlichen Büchergesetzgebung für Deutschland: Eine Folgerung aus den gegen das Privilegium Fori anerkannten Rechtsgrundsätzen. In: Der Tag (B) v. 29. 3. 1912 – Die Kernfrage im Gewerkschafts-Streit. Die praktische Unmöglichkeit des scholastischen Systems & seine Opfer. In: Frankfurter Zeitung Nr. 41 v. 8. 3. 1914 – Nachspiel zum katholischen Gewerkschafts-Streit. In: Die Christliche Welt. Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände 28, Nr. 18 (30. 4. 1914), 422 – 428 – Angelsachsen-Trust. Zur Würdigung geschichtlicher Wahrheiten und imperialer Bestrebungen im Weltkrieg. In: Hochland 13/I (1915), 342 – 352 – Das Völkerrecht im Weltgericht des Weltkrieges. In: Deutsche Richterzeitung 8, Nr. 5/6 (1. März 1916), 157 – 161 – Quo vadis? Die Friedensbotschaft des Reichsboten und ihre Begleit-Erscheinungen. In: Rheinisch Westfälische Zeitung Nr. 643, 646, 649, 652 v. 14. – 17. 8. 1917 – Schicksalsfragen: Valuta-Musik & Börsen-Veits-Tanz. In: Münsterischer Anzeiger Nr. 41 v. 26. 1. 1921 – (U. d. Pseudonym Hermann Wahroder:): Sturmflut. Schicksalstragödie eines Volkes. Regensburg und Leipzig. [1923?] – (U. d. Pseudonym: Athanasius:) Die Seelennot eines bedrängten Volkes. Von der nationalen zur religiösen Unterdrückung in Südtirol. Nach authentischen Dokumenten. Innsbruck 1927.
Sekundärliteratur: Jan Dirk Busemann: „Diese Laien aus Münster!“ – Adolf ten Hompels Index-Liga und Kulturgesellschaft. In: Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte 28 (2009) [In Vorbereitung] – Karl Hausberger: Herman Schell (1850 – 1906). Ein Theologenschicksal im Bannkreis der Modernismuskontroverse. Regensburg 1999, 407 – 414 – Norbert Trippen: Kirche und Lehramt im Konflikt. Die kirchlichen Maßnahmen gegen den Modernismus im Jahre 1907 und ihre Auswirkungen in Deutschland. Freiburg i. Br. u. a. 1977, 51 – 67 – ders.: „Zwischen Zuversicht und Mutlosigkeit“. Die Görres-Gesellschaft in der Modernismuskrise 1907 – 1914. In: Saeculum 30 (1979), 280 – 291 – Manfred Wolf: Nachlässe aus Politik und Verwaltung (Das Nordrhein-Westfälische Staatsarchiv Münster und seine Bestände 3). Münster 1982, 153 – 161 – Wer ist’s? Unsere Zeitgenossen, hrsg. v. Hermann A. L. Degener. Berlin 101935, 716.
Gertrud von le Fort (1876 – 1971)
Gertrud von le Fort
Zwischen christlicher Moderne und evangelischer Katholizität
Aleksandra Chylewska-Tölle
Als Gertrud von le Fort im Jahr 1956 durch die Katholische Theologische Fakultät der Universität in München mit dem Titel eines Dr. theol. h. c. ausgezeichnet wurde, fand dies im katholischen Deutschland ein gewaltiges Echo, weil ihr als erster Frau diese Würde zuteil wurde. Bereits seit den 20er-Jahren galt sie in vielen Leserkreisen als „katholische Dichterin“, und zwar aufgrund der ihre Werke konstituierenden Elemente wie der Wahrung katholischer Tradition oder der Beschreibung katholischer Bräuche und der Schönheit der Liturgie. Dennoch ist es unmöglich, das Werk le Forts in irgendeiner Weise theologisch zu vereinnahmen. Dies bedeutet freilich nicht, dass die Theologie für ihre Dichtung methodisch irrelevant war. Sie selbst bemühte sich darum, falsche „Theologisierungen“ ihres Werkes abzubauen.
Gertrud von le Fort war keine Theologin und sie betrachtete ihr Gesamtwerk nicht als eine dienende, eine ancilla-Funktion der Theologie. Sie war auch keine Philosophin, wie Joël Pottier zu Recht vermerkt, sondern eine Dichterin, die „in Bildern und Visionen lebte“,1 die aber zugleich philosophisch-theologisches Gebiet betreten hat. In ihren Werken, aber auch in der umfangreichen Korrespondenz und in den autobiographischen Schriften, begriff sie die „Mysterientheologie“ als Kern der Auseinandersetzung mit dem Christentum. Gemeint war hier das erneuerte Verständnis der christlichen Religion in ihrem Geheimnischarakter und die erneuerte Besinnung auf die Realität der sakramentalen Anwesenheit Christi auf Erden. Die letztlich von der Kirche so hoch geschätzte Gertrud von le Fort hatte jedoch lange auf eine öffentliche Anerkennung ihrer Arbeiten warten müssen. Um ihre Bedeutung im katholischen Milieu Deutschlands deutlich zu machen, muss deshalb zunächst kurz auf ihr Werk eingegangen werden.
Auf dem Weg zu einer tragfähigen Identität der Kultur
Das bis heute kaum beachtete Frühwerk in Vers und Prosa aus dem Zeitraum von 1895 bis 1924 zeugt zwar bereits vom Interesse der damals noch protestantischen Autorin an der Welt des Katholizismus, aber die Gestalten der Klosterfrauen, der Geistlichen, der von Heirat träumenden Jungfrauen und der wegen nicht erwiderter oder verratener Gefühle verletzten Protagonisten stehen hier durchaus in der neoromantischen Tradition. Während aber bei den meisten Vertretern dieser Strömung solche Figuren nicht unbedingt christliche Bedeutung besaßen, sind sie bei le Fort Träger und Verkünder der christlichen Lehre. Eine Wende, auch im dichterischen Schaffen, wurde bei der jungen Autorin 1907 auf ihrer ersten Romreise eingeleitet, während derer sie zum ersten Mal intensiv mit der katholischen Welt konfrontiert wurde.
Im Jahr 1908 begann Gertrud von le Fort in Heidelberg ihr Studium, das sie später in Marburg und Berlin fortsetzte. Die Auflistung der von ihr im Wintersemester 1910/11 besuchten Vorlesungen zur Theologie, Kirchengeschichte und Kunstgeschichte gibt einen Überblick über die Bereiche, die sie damals besonders faszinierten. Es waren „Glaubenslehre“ und „Geschichte der neueren Philosophie“ bei Ernst Troeltsch, „Von der Antike zum Mittelalter“ bei Hans von Schubert, „Vom Mittelalter zur Neuzeit“ bei Otto Cartellieri, „Richard Wagner“ bei Henry Thode, „Übungen zur politischen und Kulturgeschichte des Mittelalters“ und „Italienische Kulturgeschichte“ bei Eberhard Gothein sowie „Aufklärung und Romantik“ bei Albert Schmid.2 Sie bezeichnete die Heidelberger Jahre später als die „wichtigste und entscheidendste Etappe“3 ihres Lebens. Ihre Auseinandersetzung mit theologischen und philosophischen Fragen war von dem Wunsch getragen, ins Transzendente vorzustoßen. Gertrud von le Fort beschäftigte sich intensiv mit dem deutschen Idealismus sowie der Theologie ihres Professors und zugleich Freundes Ernst Troeltsch (1865 – 1923), weil sie hier einen wesentlichen Ausdruck deutscher Geistigkeit sah, und zwar in ihrer preußischen Form. Später räumte sie ein, es gebe noch andere beispielhaft deutsche Formen und Geistesrichtungen.
Nach dem Tod von Ernst Troeltsch veröffentlichte sie 1925 dessen „Glaubenslehre“. Durch die Arbeit an ihrer Mitschrift seiner Vorlesung erkannte Gertrud von le Fort das volle Ausmaß ihrer Beeinflussung durch diesen protestantischen Theologen, Religions- und Kulturphilosophen. In einem Brief an Karel Groensmit schrieb sie später über ihren „Meister“: „Troeltsch hat mich sehr tief beeinflusst, ohne dass ich mir seine liberale Theorie ganz zu eigen machte, denn ich stamme aus einem positiv-gläubigen protestantischen Elternhause. Aber der Reichtum und der Ernst seines Geistes erschlossen mir die Welt des theologischen Denkens überhaupt, die Welt der christlichen Mystik und der christlichen Philosophie und Ethik – allerdings auch die Welt der religiösen Problematik.“4
Es war durchaus kein einmaliger Einfluss, sondern mag als eine stete Herausforderung bezeichnet werden. Im Programm seiner Kulturtheorie definierte Ernst Troeltsch den Theologiebegriff auf drei Ebenen, und zwar als Verhältnis von überkommenem Christentum und moderner Kultur, Verbindung von Wissenschaft und Religion und als Zusammenhang von christlicher Religion und bürgerlicher Gesellschaft. Im Mittelpunkt der Erwägungen stand die Frage nach der Überwindung des Konflikts zwischen dem modernen Bewusstsein zu Beginn des 20. Jahrhunderts und dem christlichen Erbe. Angestrebt wurde dabei die Herausarbeitung eines Begriffs der objektiven Realität der Religion durch ihre erneuerte Integration mit Geschichte und Vernunft.5 Diese Überzeugung übernahm Gertrud von le Fort und schilderte in ihrer Dichtung geschichtliche Vorgänge im Sinne eines metaphysischen Werdeprozesses, den das dialektische Prinzip absoluter Wandlungsfähigkeit in allen Lebensbereichen bei gleichzeitiger Wahrung der eigenen Identität auszeichnet. Die produktive Aufnahme der Einsichten von Troeltsch kann bei ihr unter anderem noch durch die Übernahme der historischen, antidogmatischen Methode festgestellt werden.
Die mit 35 nicht mehr ganz junge Studentin lernte kritisch die Bedingungsfaktoren einer Weltordnung und einer zeitgenössischen Konstellation des Christentums zu reflektieren. Ihrem „Meister“ Troeltsch ist es zu verdanken, dass sie sich von der Fiktion einer geschlossenen christlichen Gesellschaft trennte und die Hinwendung zu einer aufgeschlossenen Glaubensgemeinschaft vollzog. Voraussetzung und gleichzeitig Folge der Verbundenheit mit den Gläubigen war ein ausgesprochener Bekenntnisdrang der Dichterin. Sie erhob einen Anspruch auf geistige Erneuerung ihrer selbst und der Menschheit, wobei ihr in dieser Zeit die im mittelalterlichen römisch-katholischen Grundmodell des Christentums verwurzelte Religiosität zu Hilfe kam. Sie fasste diese Überzeugung folgendermaßen zusammen:
„Die große abendländische Kunst wird nie zu lösen sein von der großen christlich-katholischen Dogmatik, ja sie ist in ihren überzeitlichen Erscheinungen geradezu deren stellvertretende Priesterin. (...) Diese Kunst nicht nur ästhetisch, sondern auch religiös befragen, heißt also mit vollem Bewußtsein den Boden der großen katholischen Dogmatik betreten, das überzeitliche, überpersönliche Fundament, auf dem die gesamte Kultur des Abendlandes ruht und dem sie also auch in der Verneinung noch unentrinnbar verhaftet bleibt.“6
Grundzüge der mittleren Schaffensperiode
Ihre mittlere Schaffensperiode begann 1924 mit der Veröffentlichung der „Hymnen an die Kirche“, mit denen Gertrud von le Fort den Anschluss an die vielfältige geistige Regsamkeit des katholischen Deutschland der 1920er-Jahre herstellt. Seit dieser Zeit kann ihre Dichtung im Vollsinne als „geistlich“ bezeichnet werden. Die Stoffe greifen auf „kirchliches Überlieferungs- und Lehrgut“ zurück7 und ihre Wirkung bewegt sich vornehmlich innerhalb des katholischen Binnenraums. Die „Hymnen an die Kirche“ kennzeichnen eindeutig den intellektuellen und dichterischen Weg Gertrud von le Forts. Einerseits stand sie unter dem Einfluss des französischen „renouveau catholique“ und des literarischen Erneuerungsprogramms von Karl Muth, andererseits war sie berührt vom Kunststreben des christlich orientierten Expressionismus. Sie stand jedoch jenseits der prinzipiellen Auseinandersetzung, welche zu Beginn des 20. Jahrhunderts die katholische Literatur beherrschte. Das Postulat der Schaffung einer katholischen Literatur wird bei ihr zunehmend zu der Frage nach der Möglichkeit einer christlichen Literatur überhaupt. Ein charakteristisches Merkmal der Hymnen ist deren Bildlichkeit, welche die Dichterin größtenteils aus der Poesie ihrer romantischen Vorgänger Joseph von Eichendorff und Clemens Brentano übernahm. Durch die „Romantisierung“ der kirchlichen Wirklichkeit, die Poetisierung des liturgischen Kirchenjahres und die Metaphorisierung des Wahrnehmbaren an der kirchlichen Institution erzielte sie eine bedeutsame Wirkung.
Wenn Gertrud von le Fort, die im Jahre 1926 zum Katholizismus konvertierte, an eine moralische Erneuerung der Gesellschaft dachte, beinhaltete dies für sie ein religiöses Moment, orientiert vor allem an der Lehre der katholischen Kirche. Das kirchliche Selbstverständnis ist in ihren Werken aus der mittleren Schaffensperiode mit theologischer Reflexion verbunden. Der Pluralisierung von Formen christlicher Religiosität entspricht hier die Ausdifferenzierung der le Fortschen Figuren und die Nachgestaltung herkömmlicher christlicher Literaturformen wie Predigt, Katechismus und Kirchenlied. Dass sowohl das lyrische Ich in den „Hymnen an die Kirche“ als auch die Hauptfigur des Romans „Das Schweißtuch der Veronika“ (1928) ein so ausgeprägtes katholisches Sendungsbewusstsein entwickeln, scheint für die geistige Position der Dichterin in den 1920er-Jahren bezeichnend zu sein. Obwohl sich die Autorin von Weihrauch und vom Klang der Kirchenglocken gefangen nehmen ließ, handelt es sich bei ihrer Dichtung jedoch nicht um kirchliche Propaganda. Kennzeichnend für ihre mittlere Schaffensperiode bleibt aber, dass immer dort, wo christliche Ideen und Tendenzen in die le Fortsche Dichtung einflossen, sowohl die Kirche als Trägerin des Glaubens wie auch deren geistliche Repräsentanten hervorgehoben wurden. In der Dichtung aus Gertrud von le Forts mittlerer Schaffensperiode erfuhr ihre „Katholisierung“ der Sprache einen Höhepunkt. In den „Hymnen an die Kirche“ erfolgte diese durch das Hereinnehmen geschlossener Wortfolgen aus der Liturgie und durch die metaphorische Symbolik. Das le Fortsche Verständnis der Apostolizität der katholischen Kirche begrenzte sich dabei nicht ausschließlich auf die Treue gegenüber der Lehre der Apostel und der Tradition, sondern umfasste auch solche Aspekte wie den Blick auf die Eschatologie, wie die kirchliche Identität, die sich an der Teilnahme am sakramentalen Leben manifestiert, und wie das Hineinwachsen in die Gemeinschaft der Gläubigen.
Gertrud von le Fort fühlte sich in ihrem Katholizismus durch die religiöse Situation ihrer Zeit bestärkt und hat sowohl mit ihrer Prosa als auch mit ihrem essayistischen Werk an den Bemühungen um ein neues Verständnis der christlichen Dichtung großen Anteil. Nicht zuletzt wird dies auch in ihren Rezensionen und ihrer Korrespondenz sichtbar. Die Frage nach dem genauen Standort der Autorin innerhalb der katholischen Erneuerungsbewegung der Zwischenkriegsjahre beantwortet zu einem gewissen Teil eine Betrachtung der Periodika, in denen ihre Arbeiten veröffentlicht wurden. Während dieser Zeit veröffentlichte sie ihre Arbeiten unter anderem in den Zeitschriften „Christliche Welt“, „Brenner“ und „Heiliges Feuer“. Insbesondere jedoch war sie in den 1920er- und 30er-Jahren mit der Zeitschrift „Hochland“ durch die Unbedingtheit des Glaubensmomentes und durch die existentielle Grundausrichtung geistig verbunden. Das von Karl Muth dort entworfene Programm der Wiedergeburt der Dichtung aus dem religiösen Erlebnis machte Gertrud von le Fort zu ihrer dichterischen Motivation.
Ein Grund dafür liegt wohl in der von ihr als vorbildlich empfundenen religiösen Dichtung Eichendorffs, welche der Dichterin selbst zufolge den Ausgangspunkt ihres eigenen Schaffens bildete. Gemeint ist hiermit das Bild eines Dichters, der größte poetische Kraft mit tiefster Religiosität in sich vereinigt. Die Sprache steht im Dienste der Begegnung von Literatur und Religion: Weniger als künstlerischer Selbstzweck wird sie verstanden, vielmehr eher als ein Mittel, das zur möglichst breiten Erreichung des von der Autorin für die Dichtung postulierten Ziels beitragen soll. Gertrud von le Fort wollte zeigen, dass die eigentliche Aufgabe der Dichtung darin besteht, das menschliche Leben transparent werden zu lassen. Die Überlebensmöglichkeit christlicher Literatur aus katholischem Geist liegt nach ihrer Überzeugung darin, „christlich“ und „katholisch“ nicht ausschließlich als „kirchlich“ zu begreifen, sowie in einem universalen Verständnis von Katholizität.
Aus dem moralischen Sendungsbewusstsein der Dichterin ergeben sich ihre ethischen Vorstellungen von Wesen und Aufgabe der christlich-katholischen Literatur. Mit Karl Muth betonte sie die Notwendigkeit der dichterischen Reflexion auf die Hauptaussagen des Christentums als Voraussetzung aller Kunst, mit ihm bleibt sie in ihren ästhetischen Vorstellungen letztlich auch der Klassik und Romantik verbunden. Ihr eigenes Werk seit den „Hymnen an die Kirche“ ist eine gelungene Verbindung von Glaube und Dichtung. In jeder Novelle und in jedem Roman sind Inszenierungen der unterschiedlichsten Formen individueller Religiosität in ihrem Verhältnis zur Institution der Kirche und ihren Vertretern zu finden. Wie bei den französischen Autoren des „renouveau catholique“ nicht primär das literarische Problem einer konfessionellen Dichtung, sondern vor allem die generelle Bemühung um ein modernes, christliches Selbstverständnis eine Gemeinsamkeit begründet, so ist der Zusammenhang zwischen der Dichtung le Forts und der französischen katholischen Dichtung in erster Linie in der Revision aller Grundbegriffe des Lebens gegenüber einem neuen Existenzbewusstsein zu sehen. Ihre bekannteste Novelle, „Die Letzte am Schafott“ (1931) – die nach dem Zweiten Weltkrieg Georges Bernanos zur Vorlage eines Film- und Bühnenszenariums sowie Francis Poulenc zu der eines Opernlibrettos diente –, eine frühe Gestaltung existenzieller Weltangst und ihrer christlichen Überwindung, verweist zugleich auf die Modernität dieser um die Transparenz „ewiger Ordnungen“ bemühten Kunst.
Mit ihrer nach 1924 geschaffenen Prosa erweist sich Gertrud von le Fort als Repräsentantin eines deutschen Katholizismus, die selbstbewusst die kulturelle Anerkennung ihrer neuen Konfession verlangte, ohne diese jedoch über andere Bekenntnisse zu erhöhen. Dies wird insbesondere aus dem Roman „Die Magdeburgische Hochzeit“ (1938) ersichtlich, in dem die Dichterin unter anderem die Auseinandersetzung von Katholiken und Protestanten im 17. Jahrhundert thematisierte, oder aus dem Roman „Der Papst aus dem Ghetto“ (1930), in dem es um das Verhältnis von Judentum und Christentum geht. Zwar war die Dichterin in dieser Zeit noch unerbittlich in der Behauptung, dass nur die katholische Kirche die unverfälschte christliche Wahrheit besitze, trotzdem erkannte sie die Bemühungen anderer Konfessionen an, Leben und Moral der Gläubigen zu stärken.
Von besonderem Einfluss auf ihren Schaffensweg sollte sich für Gertrud von le Fort die Bekanntschaft mit dem Jesuiten Erich Przywara (1889 – 1972) erweisen, den sie 1923 – nach anderer Quelle 19258 – kennenlernte. Przywara, der in seinen Schriften das Erbgut der Kirchenväter und der Mystiker neu durchdachte und in einer neuen Form darbot, verband spekulative Kraft, innig-mystische Frömmigkeit und romantische Lebendigkeit zu einer originalen Synthese. Unter anderem ihm verdankte die Dichterin, dass ihre Dichtung einen „betenden“ und „meditativen“ Charakter hat. Zudem trug er wesentlich zur Würdigung und Verbreitung ihrer Werke bei und unterstützte ihre thematische Auseinandersetzung mit dem Heiligen Römischen Reich. Dem Jesuiten verdankt Gertrud von le Fort auch die sich zu einer Freundschaft entwickelnde Bekanntschaft mit der Philosophin und späteren Karmelitin Edith Stein (1891 – 1942), welche für beide Frauen prägend gewesen zu sein scheint. Gertrud von le Fort erinnerte sich an ihre erste Begegnung mit ihr 1932 in München mit den folgenden Worten:
„Ich lernte Edith Stein durch die Vermittlung des hochwürdigen Paters Erich Przywara kennen. (...) Wir trafen uns in München und diese Begegnung hinterließ bei mir den tiefsten Eindruck, der sowohl die Frömmigkeit, die bezaubernde Schlichtheit und Bescheidenheit als die hohe geistige Begabung der damaligen Dozentin von Münster betraf. Diese Eindrücke waren so tief, daß sie mein Buch ,Die Ewige Frau‘ wesentlich beeinflußt hat, d. h. nicht durch Mitarbeit vonseiten Edith Steins, sondern durch innerliche auf jene Begegnung zurückgehend. (...) Ich rief mir bei der Arbeit oftmals Edith Steins geistiges Bild zurück als solches, wie es nur bei meiner Darstellung einer wahrhaft christlichen Frau vorgeschwebt hatte.“9
Die Bekanntschaft mit Gertrud von le Fort hat auch bei Edith Stein tiefe Spuren hinterlassen. Ein Jahr vor ihrem Eintritt ins Kloster schlug sie Sr. Callista Kopf vor, im Deutschunterricht unter anderem Werke von le Fort durchzunehmen: den historisch-legendenhaften Roman „Der Papst aus dem Ghetto“ und den in der Gegenwart spielenden Erziehungsroman „Das Schweißtuch der Veronika“.10 Die wohl größte geistige Gemeinsamkeit zwischen beiden Frauen bestand in der Tatsache, dass sie Richtschnur und Auftrag für ihre Arbeit aus der Bibel empfangen haben. Wilhelm Grenzmann hebt bei Gertrud von le Fort die drei Motivkreise Kirche, Reich (das sacrum imperium des Mittelalters) und Frau hervor.11 Diese sind auch Edith Stein sehr wichtig gewesen. Die Motivkreise sind bei Gertrud von le Fort nicht als chronologische Abfolge zu sehen, sondern bilden eine ineinander verschlungene Thematik, welche die Dichterin ihr Leben lang begleitete.
Ihre Werke artikulieren einige wesentliche Aspekte des weiblichen Erfahrungsbereiches und geben eine klare Vorstellung dessen, was sie damit anstrebte. Das von ihr gezeichnete „neue“ Frauenbild war tatsächlich nicht radikal neu. Es ist eher als eine Neuakzentuierung zu interpretieren gegenüber dem Frauenbild der Moderne im Allgemeinen und dem Bild der „Neuen Frau“ der Weimarer Republik im Besonderen. Das Leben in den 1920er-Jahren wurde von dem Modell der Frau beherrscht, die ihre Selbstständigkeit anstrebte, das Recht auf freie Sexualität proklamierte und sich durch wissenschaftlichen Ehrgeiz auszeichnete.12 Auch wenn Gertrud von le Fort gewisse Veränderungen befürwortete, blieben ihre Auffassungen zum Wesen und zur Rolle der Frau dennoch traditionell geprägt. Die Situation zwischen Mann und Frau war bei ihr eine grundlegend andere als bei den modernen und gern gelesenen Autorinnen der Weimarer Republik. Nicht die einseitige Sehnsucht nach Emanzipation, sondern nach der Anerkennung der Gleichwertigkeit bestimmt hier das Verhältnis der Geschlechter. Sie beabsichtigte mit ihren Werken keine moralische Revolution. Sie betonte andere Kräfte, wie etwa die Liebesfähigkeit, und stellte diese in ihrem Frauenbild heraus. Diese im Vergleich zu dem Frauenbild der 1920er-Jahre auf den ersten Blick „regressive“ Festlegung der Frau auf ihre gefühlsmäßige und „liebende“ Natur schließt Fragen nach dem Wesen und Wert der Frau nicht aus. Ganz im Gegenteil: Die le Fortsche Suche nach einer wahren Menschlichkeit der Frau brachte im Endeffekt deren Darstellung als vollwertiges Wesen, dem mit seiner Kraft zur Verzeihung und zur Gewaltlosigkeit gleichsam eine Erlöserrolle zugeschrieben wird. Ihre Protagonistinnen sind meist starke Gestalten, die mit viel Energie ihre Selbstverwirklichung anstreben. Sie können jedoch trotz ihrer Fähigkeit, progressive und traditionelle Aspekte im Leben zu integrieren, nicht als „Superfrauen“ bezeichnet werden. Ganz gewiss jedoch kritisieren sie das Konzept einer aggressiven, „einseitigen und übersteigerten Männlichkeit“.