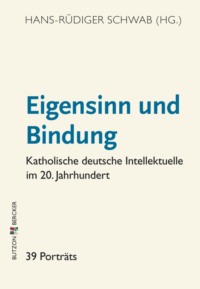Kitabı oku: «Eigensinn und Bindung», sayfa 11
Respektierung unterschiedlicher Glaubensformen
Durch ein intensives Leben in und mit der Kirche sowie eindringliche Beschäftigung mit der christlichen Thematik gelangte Gertrud von le Fort in ihrem zwischen 1945 und 1968 entstandenen Spätwerk zu einer neuen Tiefenschau. Sie fasste Dichtung nun nicht nur als eine Art moralischen Engagements auf, wie dies insbesondere in der mittleren Schaffensperiode der Fall war, sondern grundlegend als metaphysische Betrachtung der Seins- und Gottesfrage bezüglich der Aktualität von Glaube und Religion. Dem veränderten Selbstverständnis der Nachkriegsgeneration entsprechend, entwickelte sie jenen theologisch-religiösen Personalismus weiter, der sich von Anfang an wie ein roter Faden durch ihr Gesamtwerk zieht. Ihre literarischen Arbeiten bejahen das Lebens in all seinen irdischen und geistigen Formen.
Mit ihnen trat sie hervor als eine traditionsgebundene Repräsentantin der Moderne des 20. Jahrhunderts und dessen existenzieller und transzendentaler Sinnsuche im Zeitalter einer sich rasant entwickelnden Technologie. Die konfessionellen Aspekte verloren mit der Zeit an Bedeutung. Viel deutlicher ist in dieser Phase die Betonung der Liebe Christi und seiner Gnade für alle, welche in ihrem Leben nach Wahrheit suchen. Mit anderen Worten: Von Christus aus fällt Licht in Fülle auf alle Lebensbereiche und alle Menschen, wobei die Wirksamkeit dieser Ausstrahlung von deren Aufnahmebereitschaft abhängig ist. Dies ist unter anderem wiederum auch aus der le Fortschen Korrespondenz ersichtlich, die freilich mit sehr unterschiedlicher Intensität und Thematik geführt wurde. Im Vordergrund stand meist das Literarische in seinen praktischen Aspekten (Verlage, Übersetzungen). Bemerkbar ist hier jedoch auch die ständige Suche nach einer richtigen Aussage und dem Gehalt der Dichtung, wobei dieses „Tasten“ nun weniger auf die Sicherheit des Dogmas gerichtet war. In ihrer Dichtung suchte sie meist einen passenden Mittelweg zwischen einem allzu engen Konfessionalismus und völliger Offenheit.
Nach Gertrud von le Fort vermeidet das Zentrum die gegensätzlichen Extreme bei der Entwicklung der eigenen Identität. Diese Identität wird von der Autorin in vertrauten Mustern und Formen des Christentums gesucht. Die Begriffe Umkehr und Identität verwendet sie sowohl in ekklesialer Hinsicht, das kirchliche Leben betreffend, als auch in ekklesiologischer Hinsicht, das heißt die Reflexion über das kirchliche Leben betreffend. Stets hebt sie die Notwendigkeit der ständigen Bekehrung der christlichen Gemeinschaft hervor. Mit ihren Spätwerken tritt sie für eine „evangelische Katholizität“ ein, welche die historisch und dem Wesen nach unterschiedlichen Lebens- und Glaubensformen respektiert. „Evangelische Katholizität“ drückte nach Gertrud von le Fort aus, dass den verschiedenen kirchlichen Gestalten eine christliche Einheit zugrunde liegt, wie sie dies insbesondere in den Novellen „Am Tor des Himmels“ (1954) – deren zentrales Thema die zerstörerische Kraft des Atomzeitalters ist – und „Der Dom“ (1968), ihrer letzten, veranschaulichte. Sie sah dabei mit Scharfblick die Gefahren voraus, welche eine bloß formale religiöse „Orthodoxie“ und moralische Gesetzlichkeit mit sich bringen können. Diese schaden der geistigen Entwicklung des Menschen und verhindern somit eine überzeugte Annahme des Heils, das sie mit dem „Kommen des Reiches Gottes“ identifizierte.
Während dieser Zeit kam das „protestantische Erbe“ der Dichterin in ihren Werken stärker zum Vorschein. Wichtiger als dogmatische Konfessionalität schien ihr die Suche nach Wahrheit und Sinn in der säkularisierten Welt zu sein. Es lässt sich demnach eine Entwicklung in Gertrud von le Forts Denken verfolgen: Nach der Akzentuierung des Katholischen in ihrer Dichtung trat dieses zugunsten einer „Erkenntnis der universellen Wahrheit“ zurück. Festzustellen ist dabei, dass Christentum und Kirchlichkeit bei le Fort nicht mehr deckungsgleiche Größen sind, sondern die Letztere macht für sie nur einen Teil des Ersten aus in der Überzeugung, dass sich das Christentum nicht in der Kirchlichkeit erschöpft. Le Fort als Dichterin wurde zunehmend offener und befreite sich von Berührungsängsten und „Ghettomentalität“. Beispielhaft zeigt dies bereits die durchaus kontroverse Aufnahme ihres Nachkriegsromans „Der Kranz der Engel“ in der katholischen Leserschaft.13
Die unkonventionelle Haltung der Dichterin bewährte sich in ihrem Christentum stets aufs Neue und knüpfte an die Idee der ökumenischen Versöhnung der Christen an. Keineswegs bedeutet dies jedoch, dass die Grenzen der Katholizität bei Gertrud von le Fort während dieser Zeit verschwanden oder dass sie sich von der kirchenchristlichen Tradition abwandte. Es kann auch nicht vom Weg zu einer neuen Form der Religion im Leben und Spätwerk der Dichterin die Rede sein, wie dies etwa bei Luise Rinser, mit welcher le Fort in den Nachkriegsjahren korrespondierte, der Fall war. Zwischen der Neubelebung des christlichen Glaubens infolge des Zweiten Vatikanischen Konzils und der entsprechenden weltanschaulichen Entwicklung Gertrud von le Forts besteht ein enger Zusammenhang. Wohl kaum ein anderer deutscher Autor setzte sich so intensiv wie sie mit dem durch das Konzil ausgelösten Wandel in Theologie, Exegese, Verkündigung und Gemeindeleben auseinander. Was noch viel wichtiger ist: Noch vor der Wende des Vaticanum Secundum legte sie die Scheuklappen einer veralteten, rechthaberischen Orthodoxie ab. Davon berührt ist auch ein neues Verständnis der katholischen Liturgie, wie sie, getragen von der Frage nach dem Verhältnis zwischen objektiver Heilsgeschichte und individuellem Heilsgeschehen, zunächst innerhalb der Liturgischen Bewegung neu definiert wurde. Mit gemischten Gefühlen begrüßte Gertrud von le Fort jedoch das Verschwinden des Lateins in der katholischen Liturgie, weil „das Credo in ihr [= der lateinischen Sprache] eine in keiner [anderen] Sprache wiederzugebende Macht hat“ und dadurch „sogar in der Fremde ein Heimatgefühl“ geweckt wird.14 Mit ähnlicher Besorgnis begegnete sie dem Beschluss eines Münchener Kardinals, auf die Barockmusik im Gottesdienst zu verzichten.15
Dichtung als Antwort
Der dichterische Weg Gertrud von le Forts in die „religiös-metaphysische“ Existenz mit stark ausgeprägtem Geschichtsbewusstsein muss vor allem vor dem Hintergrund der christlichen Tradition gesehen werden. Die Katholische Bewegung des 19. Jahrhunderts zeigte ihr die Möglichkeit einer allegorisch-politischen Deutung und eine enge Verbindung zwischen tiefster Innerlichkeit und engagiertem Handeln in der Welt. Die christliche Autorin betrachtete die dichterische Tätigkeit als eine Art der Neubegründung der Humanität und die Dichtung selbst als eine „vermittelnde Aufgabe“. Sie betonte immer wieder die mannigfache Wechselbeziehung zwischen der deutschen Dichtung und der christlichen Religion in Form eines gegenseitigen Einflusses, der kontinuierlich vom Mittelalter bis zu der der Romantik gereicht habe. Auf diese Weise knüpfte sie auch an die Geschichtsauffassung Ernst Troeltschs an, der in seinen Schriften das Christentum mit allen Errungenschaften der Philosophie und Kultur zu vereinigen suchte, um dadurch unter anderem das neue Antlitz des Christentums mitzuformen. Bei der Dichterin war jedoch weder eine heimliche „Rückkehr zum Mittelalter“ beabsichtigt, noch eine geschichtsphilosophische Romantik, die darauf abzielte, die religiöse und kulturelle Entwicklung des Abendlandes einer bestimmten Epoche als absoluten Höhepunkt künstlich festzulegen. Im Geleitwort zum Essay „Vom Paradox des Christentums“ (1952) von Graham Greene legte Gertrud von le Fort ihr Verständnis von der wahren christlichen Dichtung dar. Diese ist von den Schablonen bürgerlicher Moral ebenso wie denen einer engherzigen Moraltheologie befreit, ist dem Staat und der Gesellschaft gegenüber nicht folgsam und sympathisiert mit menschlicher Schwäche, ja Fragwürdigkeit.16 In der Erfüllung dieser Aufgabe veröffentlichte Gertrud von le Fort u. a. auch ihre „Aufzeichnungen und Erinnerungen“ (1951) oder Essays wie „Die Frau und die Technik“ (1959) und „Woran ich glaube“ (1968). Darüber hinaus schuf sie in dieser Zeit eine Reihe von Werken, in denen sie tradierte religiöse Inhalte im Sinne einer schöpferischen Restauration bearbeitete. Zu ihnen gehören unter anderem die Novellen „Die Consolata“ (1947), „Der Turm der Beständigkeit“ (1957) und „Das fremde Kind“ (1961).
Gertrud von le Fort trat in ihrer Dichtung den säkularisierenden Tendenzen in der Lebenswelt und Kultur der Nachkriegszeit mit Bedenken entgegen. Die Säkularisierungswelle führte ihrer Meinung nach zum Verlust wesentlicher Inhalte, unter anderem zur Verweltlichung der christlich-kirchlichen Tradition, welche das europäische Selbstverständnis seit Jahrhunderten tief geprägt habe. Das Verständnis der Säkularisierung als problematische Transformation steht bei Gertrud von le Fort mit der Beobachtung von Verlusten im engen Zusammenhang. Vor dem Hintergrund einer kritische Einstellung gegenüber der eigenen Zeit drückte sie das Bemühen um christliche Selbstbesinnung und um eine christliche Durchdringung des Lebens aus, wobei sie sich eben hinsichtlich ihres Verhältnisses zur Kirche eigensinniger als in der Zwischenkriegszeit zeigte. Ihre Loyalität jedoch war ungebrochen. Mit der Legende „Das Schweigen“ verteidigte die bereits 91-jährige Autorin 1967 Papst Pius XII. gegen den Vorwurf des Versagens angesichts der Judenverfolgungen im Dritten Reich (wo sie übrigens selbst als Verfasserin unerwünschter Texte galt). Unmittelbarer Anlass für dieses Werk war das Drama „Der Stellvertreter“ (1963) von Rolf Hochhuth.
Gertrud von le Forts Anliegen blieb es nicht zuletzt, das biblische Zeugnis in die Sprache und Vorstellungswelt der Gegenwart zu übertragen, wobei sich in ihrem Werk zwei Hauptaspekte, der prophetische und der eschatologisch-verheißende, abzeichnen. Die literarische Rezeption der Bibeltexte bei ihr umfasst paraphrasierende Texte, aktualisierende Inhalte und transfigurierende Neuschöpfungen, wie etwa in der Novelle „Die Tochter Jephtas“ (1964), wo die biblischen Gestalten ihrer historischen Kostüme entkleidet werden.17 Ihre dichterische Aufgabe insgesamt begriff sie im Sinne dessen, was ihr protestantischer Kollege Jochen Klepper einmal stellvertretend für zahlreiche christliche Autoren formulierte: als „menschlichen Lobgesang in Antwort auf das göttliche Wort“.18
Wissenschaftliche Rezeption des Werkes
Die Pluralität der Perspektiven, Methoden und nicht zuletzt auch der persönlichen Voraussetzungen, mit welchen die Forschung den Werken Gertrud von le Forts begegnet, ist mittlerweile unüberschaubar geworden und lässt deshalb jede Darstellung des Forschungsstands19 und der Rezeption unvermeidlich als bruchstückhaft erscheinen. Neben Literaturwissenschaftlern beschäftigen sich vor allem Philosophen und Theologen mit der le Fortschen Dichtung, und dies schon längst über den deutschen Sprachraum hinaus.
Ein bedauernswerter Mangel ist zweifellos das Fehlen einer historisch-kritischen Ausgabe der Werke Gertrud von le Forts als unabdingbare Grundlage für die wissenschaftliche Beschäftigung. Größtenteils unerforscht blieb darüber hinaus der im Deutschen Literaturarchiv in Marbach am Neckar aufbewahrte Nachlass der Dichterin, wobei jedoch mittlerweile ein zunehmendes Interesse an einer Auswertung der Korrespondenz Gertrud von le Forts zu beobachten ist. Erwähnenswert sind auch die Ausstellungen und die dazu veröffentlichten Kataloge, welche noch in enger Zusammenarbeit mit Eleonore von la Chevallerie, der letzten Sekretärin Gertrud von le Forts (1961 – 71), zusammengestellt wurden.20
Besonders zwischen 1945 und 1955, auf dem Höhepunkt des Ruhms der Autorin, entstanden zahlreiche Arbeiten zu ihrem Werk. In ihnen werden meist Bezüge zu den theologischen Quellen aufgezeigt sowie Parallelen zur dogmatischen Gestaltung ihrer Themen präsentiert. Ansätze zu einer Betrachtung unter konfessionellen Gesichtspunkten bleiben häufig an der Oberfläche einer statistischen Aufzählung und Gruppierung und begnügen sich mit äußerlicher Betrachtung christlicher Motive in einzelnen Werken. Bei der Durchsicht dieser Forschungsliteratur ist festzustellen, dass die meisten Beiträge paradigmatisch orientiert sind und der sprachlichen Präsentation der religiösen Thematik kaum Aufmerksamkeit widmen. Sie konzentrieren sich vielmehr auf die den le Fortschen Werken zugrunde liegende religiöse Sicht und zeigen häufig den Zusammenhang zwischen dem religiösen Paradigma der Dichterin und ihrer Dichtung auf. Darüber hinaus werden spirituelle und moralisch-didaktische Bedeutungsinhalte behandelt. Ihren Bezugspunkt finden diese Arbeiten in der Erschütterung durch die Kriegsfolgen. Sie sind weniger eine wissenschaftliche Beschäftigung mit der le Fortschen Dichtung, sondern suchen in ihr vielmehr eine „Botschaft“ für die Nachkriegszeit. Die theologisch-philosophischen Darstellungen vernachlässigen dabei ein tieferes Eindringen in die Problematik der Persönlichkeit der Autorin, und sie beinhalten auch keinen Gesamtüberblick über ihr Werk und dessen Entwicklungsstränge.
Gertrud von le Forts literaturgeschichtlicher Standort bleibt bis heute ungeklärt, was bedeutet, dass es nur wenige Arbeiten gibt, die ihr Schaffen in die verschiedenen kulturellen und literarischen Kontexte und Diskurse der Jahrhundertwende, der Weimarer Republik, des „Dritten Reiches“ und der Nachkriegszeit einordnen. Vor diesem Hintergrund wäre „die größte Dichterin der Transzendenz unserer Zeit“, wie Carl Zuckmayer sie einmal nannte,21 angemessen zu würdigen, auch in ihrer fortdauernden Bedeutung.
Schriften von Gertrud von le Fort: Erzählende Schriften. 3 Bde. München/Wiesbaden 1956 – Der Turm der Beständigkeit. Novelle. Wiesbaden 1957 – Die letzte Begegnung. Novelle. Wiesbaden 1959 – Das fremde Kind. Erzählung. Frankfurt a. M. 1961 – Die Tochter Jephtas. Eine Legende. Frankfurt a. M. 1964 – Das Schweigen. Eine Legende. Zürich 1967 – Unsere liebe Frau vom Carneval. Eine venezianische Legende. Zürich 1975 – Gedichte. München 1970 – Die ewige Frau. Die Frau in der Zeit. Die zeitlose Frau. Essays. München. Erw. Ausg. 1960 – Woran ich glaube und andere Aufsätze. Zürich 1968 – Aufzeichnungen und Erinnerungen. Einsiedeln/Zürich/Köln 1951 – Hälfte des Lebens. Erinnerungen. München 1965.
Sekundärliteratur: Hedwig Bach (Hg.): Dichtung ist eine Form der Liebe. Begegnung mit Gertrud von le Fort und ihrem Werk. München 1976 – Eugen Biser: Überredung zur Liebe. Die dichterische Daseinsdeutung Gertrud von le Forts. Regensburg 1980 – Lothar Bossle/Joël Pottier (Hg.): Christliche Literatur im Aufbruch. Im Zeichen Gertrud von le Forts. Würzburg 1988 – Diess. (Hg.): Deutsche christliche Dichterinnen des 20. Jahrhunderts. Würzburg/Paderborn 1990 – Aleksandra Chylewska-Tölle: Literarische Entwürfe und Formen der Wandlung im Werk Gertrud von le Forts. Frankfurt am Main 2007 – Sabine Düren: Die Frau im Spannungsfeld von Emanzipation und Glaube. Eine Untersuchung zu theologisch-anthropologischen Aussagen über das Wesen der Frau in der deutschsprachigen Literatur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung von Edith Stein, Sigrid Undset, Gertrud von le Fort und Ilse Stach. Regensburg 1998 – Gertrud von le Fort. Ausstellung in der Universitätsbibliothek Marburg. Zusammengestellt von Eleonore von la Chevallerie. Marburg 1983 – Roswitha Goslich: Orientierungssuche im Zeitalter der Angst. Gertrud von le Forts Weg zur Mystik. Hildesheim/Zürich/New York 2003 – Antje Kleinewefers: „Eine ganz neue Liebe zur Liebe“. Gertrud von le Fort. Annweiler 2003 – Renate Krüger: Aufbruch aus Mecklenburg. Lebenswelten der Gertrud von le Fort. Norderstedt 2000 – Joël Pottier: Zwischen Ernst Troelsch und Edith Stein: Gertrud von le Forts einsamer Weg. In: Wiener Jahrbuch für Philosophie, 34 (2002), 185 – 225 – Helena Mary Tomko: Sacramental Realism: Gertrud von le Fort and German Catholic Literature in the Weimarer Republik und 3rd Reich (1924 – 1946). London 2007
Theodor Haecker (1879 – 1945)
Theodor Haecker
Christliche Existenz im totalitären Staat
Hildegard K. Vieregg
Am 11. Februar 2000 übersandte mir Gerhard Schreiber, der Ur-Enkel des Verlagsgründers Ferdinand Jakob Schreiber, zudem Gründer des J. F.-Schreiber-Museums in Esslingen, eine Einladung zum Nachmittagstee für den 28. April. Anlass war die Verleihung des Theodor-Haecker-Preises 2000 „für politischen Mut und Aufrichtigkeit“ an Sinaida Gontschar, die für ihren seit Monaten verschwundenen Mann, den Reform- und Oppositionspolitiker gegen die Lukaschenko-Diktatur in Weißrussland, die Auszeichnung im Sinne des Namensgebers entgegennehmen sollte.
Gerhard Schreiber, dessen Großvater wohl als Erster die Begabung Haeckers erkannt hatte, ist auch selbst ein wichtiger Zeitzeuge zu Leben und Überzeugungen Theodor Haeckers.
In Esslingen, der eigentlichen Heimatstadt Theodor Haeckers (geboren 1879 in Eberbach am Neckar), wo er von 1894 bis 1901 eine Kaufmannslehre machte, ahnte damals wohl niemand, dass er die Existenzialphilosophie des 20. Jahrhunderts entscheidend beeinflussen sollte. Theodor Haecker, der „Einzelgänger“ (Otl Aicher), zählt heute zu den bedeutendsten christlichen Intellektuellen des 20. Jahrhunderts und konnte zu einer Leitfigur der Kulturkritik und christlichen Kulturphilosophie avancieren.
Der junge diplomierte Buchdrucker und Verlagsbuchhändler Gerhard Schreiber (1922 – 2007) wurde stark geprägt durch Theodor Haecker, der den Lebensunterhalt für sich und seine Familie vierzig Jahre lang als Mitarbeiter in der Münchener Niederlassung des Schreiber-Verlages verdiente und ab 1941, nach dem Tode des Großvaters Schreibers, hauptverantwortlich für den Verlag war.
In dem Brief zur Tee-Einladung steht zu lesen:
„Als Theodor Haecker nicht mehr öffentlich auftreten durfte, wurde der Haecker-Kreis für ihn immer wichtiger. Von den treuen Freunden, die sich um ihn zusammenfanden, hatte ich zu einigen ganz besonders enge Kontakte. Ich denke dabei vor allem an Dr. Stefl von der Bayerischen Staatsbibliothek, an Dr. Wild, den Verleger des Kösel-Verlages, an Professor Seewald mit seiner Frau und Professor Heinrich vom Wilhelmsgymnasium.
Ein Gegenstand spielte bei diesen Treffen immer eine große Rolle, nämlich eine große schwarze Teekanne, die an Silvester auch heißen Punsch von sich gab – bis spät in den neuen Morgen. Diese Kanne gibt es noch.
Meine Frau und ich freuen uns sehr, wenn Sie am Freitag 28. April 2000 um 16.00 Uhr zu uns in den Hölderlinweg 146 kommen, um Form und Inhalt der Kanne zu prüfen und dabei die Tradition eines guten Gesprächs fortzusetzen.“
Das war ganz im Sinne Theodor Haeckers.
Eine zweite Persönlichkeit, die als lebenslange Zeitzeugin für Werk und Wirken Theodor Haeckers steht, ist seine Tochter Irene (1921 – 2000). Sie gab den wohl charakteristischsten Gegenstand aus der Lebenswelt Theodor Haeckers weiter – seinen blau-grau-schwarz-melierten Füllfederhalter mit der Goldfeder –, als Zeugnis dafür, dass damit die schwere Zeit des Nationalsozialismus in den „Schreibenächten“ durchstanden wurde. Theodor Haecker arbeitete tags im Schreiber-Verlag und nachts geheim in seiner Wohnung im obersten Stockwerk des Verlagsgebäudes. Nach dem Tod seiner Frau im Jahre 1935 lebte er hier mit seinen drei Kindern. Das erklärt auch die Vertrautheit der Tochter mit dem Werk ihres Vaters und dessen ausgewähltem Freundeskreis.
Die wohl bekanntesten Werke in seiner Gegnerschaft zum Nationalsozialismus sind „Vergil – Vater des Abendlandes“ (1931, rev. 1933) und die „Tag- und Nachtbücher 1939 – 1945“. Letztere beanspruchten seine Nächte – doch er schien sie nicht zu zählen: „Die wievielte Schreibenacht ist heute? Ich weiß es nicht. Ich habe sie nie gezählt. Sie waren das Glück meines Lebens. Und doch habe ich mich in jeder Nacht gegen ihre Mühen gewehrt, ehe ihr Glück mich überwältigte.“1
Es fällt schwer, Theodor Haecker, dem Kulturphilosophen, einem der bedeutendsten Kulturkritiker der Weimarer Republik, dem Schriftsteller, Übersetzer wegweisender Werke, dem christlichen Philosophen, dem Denker und Visionär gerecht zu werden, repräsentiert er doch als Intellektueller in ganz charakteristischer Weise den christlichen Existenzialismus2 in einer das Christentum gefährdenden Zeit.
Otl Aicher, ein weiterer Zeitzeuge,3 beschreibt in seinem 1985 erschienenen Buch „innenseiten des kriegs“ die Persönlichkeit Haeckers aus seiner Sicht:
„ich lernte theodor haecker kennen, läutete in der möhlstraße in münchen. er hatte einen etwas kantigen, schwäbischen kopf mit hellen augen und einem wäßrigen fernen blick. der mund war gepreßt, die kleine nase offenbar durch eine verletzung etwas seitlich eingedrückt. er ging schlecht, stützte sich immer auf und sprach wenig. er war zugemauert wie eine festung, von der man nicht wußte, gegen wen sie gebaut worden war. was er sagte, hatte er vorher dreimal durchdacht. so schrieb er auch. langsam. immer denkend. lachen konnte er nicht mehr, er lächelte nur, dann aber strahlend, mit genuß, nach innen. im innern dieser festung mußte es kämpfe gegeben haben. er konnte sarkastisch werden. da gab es ein arsenal von waffen. bissige satire, tötende ironie, verletzenden spott. er kämpfte mit aller kraft gegen ein falsches denken, das falsche denken bei andern, das falsche denken bei sich selbst.“4