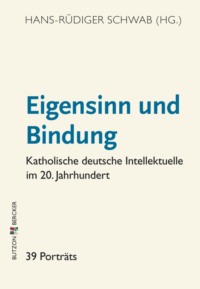Kitabı oku: «Eigensinn und Bindung», sayfa 12
Haeckers christlicher Existenzialismus: Rezeption von Søren Kierkegaard und John Henry Newman
Theodor Haecker war viele Jahre lang ein Suchender und Ringender um die Wahrheit, die er so auffasste wie Søren Kierkegaard (1813 – 1855), nämlich als eine „Bewegung des Menschen in der Zeit“, und das aus diesen Zeitumständen bedingte Nachdenken über das Christentum. Auch der englische Kardinal John Henry Newman (1801 – 1890), von 1851 bis 1857 der erste Rektor der Katholischen Universität von Dublin/Irland, war einer von Haeckers Vorbildern, ja Wegweisern. Dieser hatte das Streben nach Wahrheit vielfach in den Mittelpunkt seiner spirituellen Reflexionen und Predigten gestellt: „Alle, die der Wahrheit folgen, sind auf der Seite der Wahrheit, und die Wahrheit wird obsiegen. Wenige an der Zahl, aber stark im Geist.“5
Einige Tage nach der Geburt seiner Tochter Irene konvertierte Haecker unter dem Einfluss der Schriften Newmans am 5. April 1921 zum katholischen Glauben. Etwa zur gleichen Zeit hatte er auch den Plan, John Henry Newmans bedeutendes Werk „The Development of Christian Doctrine“ (1845; rev. 1878), worin das Gebot moralischen Denkens und Handelns eine der zentralen Fragen darstellt, ins Deutsche zu übersetzen. Newman betonte in seinen zahlreichen Werken immer wieder die Kontinuierlichkeit in der Entwicklung der christlichen Lehre. Diese „Doktrin“ werde weniger beeinflusst durch Veränderungen oder Innovation als vielmehr durch die Entfaltung dessen, was in der Offenbarung schon enthalten ist. Die Vergangenheit wird dabei gedeutet als eine Art „Aufruf“ hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen. Das erste Kapitel des genannten Newman’schen Werkes befasst sich mit der Entwicklung von Ideen – von mathematischen, physikalischen bis hin zu historischen, ethischen und logischen.
Wichtige Ideen fand Haecker auch bei Søren Kierkegaard, dem dänischen Philosophen, Theologen und Schriftsteller. 1913 erschien im Schreiber-Verlag Haeckers erste, ganz unter dem Einfluss Kierkegaards stehende kulturkritische Schrift „Sören Kierkegaard und die Philosophie der Innerlichkeit“.
Haecker hatte Kierkegaards umfangreiche Tagebücher (Bd. I: 1834 – 1848, Bd. II: 1848 – 1855) aus dem Dänischen ins Deutsche übersetzt und sich dabei vertiefend mit der menschlichen Existenz befasst, die für ihn, einen Menschen von schwermütiger Natur, durch die Erfahrung von Leid und Not, Angst und Tod bestimmt ist.
Eine wichtige Publikation Haeckers aus dem Jahre 1932 trägt den Titel „Der Begriff der Wahrheit bei Sören Kierkegaard“. Wahrheit ist laut Kierkegaard nicht „lehrbar“, aber in den „aufsteigenden“ Begriffen von Ästhetik, Ethik und vor allem Religion „erfahrbar“. Haecker verband diesen Wahrheitsbegriff mit seiner Zeit und seiner Spiritualität. Mit diesen „Ideenlehren“ Kierkegaards und Newmans war der Grund gelegt zu Haeckers Gegnerschaft zur nationalsozialistischen Ideologie.
Im Vorwort Haeckers zur zweiten Auflage des Kierkegaard-Diariums ist dann unter anderem zu lesen: „Menschen der Erinnerung sind es auch, die in der Hauptsache Tagebücher schreiben, und natürlich auch Konfessionen. (...) Jedes Tagebuch ist zum mindesten ein Bekenntnis, mit welchen Dingen und Gedanken der Schreiber an einem bestimmten Tag sich beschäftigt hat ...“6
In seinen Lebenserinnerungen7 mit dem Titel „Die Zeit befiehlt’s, wir sind ihr untertan“, beschreibt Richard Seewald (1889 – 1977), der die Illustrationen zum „Vergil“ schuf, seine Begegnungen mit Theodor Haecker ab 1911/12 in München. Während Haecker, von 1905 bis 1910 als „cand. phil.“ in München – vor allem bei Max Scheler (1874 – 1928) – immatrikuliert, seinen Lebensunterhalt als Redakteur der illustrierten Wochenschrift „Meggendorfer Blätter“ verdiente, war Seewald für diese als Zeichner tätig. Beide waren sich wohl in der Redaktion des Schreiber-Verlags begegnet. Diese Freundschaft dauerte bis zum Tode Theodor Haeckers am 9. April 1945 in Ustersbach bei Augsburg.
Die Redaktion charakterisiert Seewald als eine „durchaus merkwürdige Persönlichkeit (...), denn neben diesem Philosophen, der eben sein Buch ,Sören Kierkegaard und die Philosophie der Innerlichkeit‘ geschrieben hatte, saß in ihr noch ein protestantischer Theologe namens Peterson, der humoristische Kurzgeschichten schrieb, und der jüdische Rechtsanwalt Harry Kahn, von dem dann und wann Lustspiele im Schauspielhaus aufgeführt wurden.“8
Seewald berichtet, dass der Freundeskreis um Theodor Haecker jedes Jahr im Herbst nach Diessen am Ammersee fuhr und ein „heiteres Symposium“ veranstaltete: „Haecker, Ludwig Heinrich,9 Schreiber, Hans Rupé,10 Max Stefl und ich. Ein paar Mal war auch Ficker aus Innsbruck zu Gast. Das Fest ging in einer kleinen Pension vonstatten, die von einer ehemaligen Köchin der österreichischen Botschaft in Bukarest geführt wurde.“11 Im Juni desselben Jahres treffen sich Max Stefl und der Herausgeber der katholischen Kulturzeitschrift „Hochland“, Karl Muth (1867 – 1944), zu einer Vorbesprechung über den Abdruck der Übersetzung von Kierkegaards Tagebüchern.
Theodor Haecker als Schriftsteller
Theodor Haeckers Ruf als Schriftsteller, Kulturphilosoph, Satiriker und Warner vor einem totalitären Staat begründeten seine schon in den Zwanzigerjahren verfassten Beiträge im „Brenner“, einer von Ludwig von Ficker in Innsbruck herausgegebenen kritisch-satirischen Zeitschrift, sowie im „Hochland“ und anderen Schriften, die selbst einem Thomas Mann auffielen.12 Mann war nach der Lektüre von Haeckers „Was ist der Mensch?“ (1933), einer Sammlung von Essays, die dieser Jahre später der Widerstandsgruppe Weiße Rose zur Kenntnis brachte, sehr angetan von dessen katholisch-oppositioneller Humanität.13
Karl Kraus sagte Hinrich Siefken zufolge vom „Brenner“, er „sei die einzige zeitschrift, die man in österreich noch lesen könne. sonst war haecker nicht einzuordnen, er war nirgendwo angepaßt, auch nicht in seinen themen. im ,brenner‘ hatte er als einer der ersten über kierkegaard geschrieben, er hat ihn übersetzt, und seine monographie ,sören kierkegaard und die philosophie der innerlichkeit‘, schon vor dem ersten weltkrieg ...“14
Haeckers schriftstellerisches Werk der dreißiger Jahre ist ein außergewöhnliches Zeugnis der christlichen Widerstandsliteratur. Themen wie „Was ist der Mensch?“ und „Der Christ und die Geschichte“ (1935) wurden ihm zum persönlichen Anliegen, das er in zahlreichen Vorträgen und bei Leseabenden vermittelte. Es geht dabei um das christliche Menschenbild, das frei ist von Überheblichkeit und Machtanmaßung. Das Gegenbild dieser Vorstellung verkörperte für Haecker „Die Bestie“. Diesen Titel trug schon 1923 ein Text im „Brenner“. Er bezog sich auf ein Mussolini-Standbild. Haecker kommentierte darin den von einer „Bestie“, einem Diktator, gelenkten Staat mit den Worten: „Mit der Deifikation des Staates gleichen Schritt hält die Bestifikation des Menschen.“15 Wenn der Staat verherrlicht und zum absoluten Richtmaß wird, wenn er an die Stelle Gottes tritt, geht in gleichem Maße damit ein Werteverlust einher, gehen humane und ethische Werte verloren, kurz: wird der Mensch eben zur Bestie. Im Februar 1924 wurden auf ausdrücklichen Wunsch Haeckers Belegexemplare der Ausgabe des „Brenner“ mit diesem hochpolitischen Artikel an Münchener Zeitungen geschickt. Damit ist unschwer nachzuvollziehen, dass sich diese zuerst über Mussolini geäußerte Kritik auch an Hitler und den Nationalsozialismus richtete.
Im Werk Haeckers ist immer wieder der Rückbezug auf die beiden Denker des Glaubens Kierkegaard und Newman festzustellen. In diesem Sinne vertrat er auch die Philosophie des „christlichen Existenzialismus“. Dabei ist schwerlich zu sagen, an welcher der beiden Persönlichkeiten sich Haecker stärker orientiert hat. War es zunächst wohl Kierkegaard, so wurde späterhin der Einfluss Newmans entscheidender, insbesondere, was die Konversion Haeckers zum katholischen Glauben betraf.
Im Rahmen seiner Übersetzung von Kierkegaards Tagebüchern befasste sich Haecker wie der dänische Philosoph intensiv mit der menschlichen Existenz.
Der Ankündigung des ersten Bandes im Verlagsbericht des Brenner-Verlags vom Frühjahr 1923 ist eine vielsagende Tagebuchnotiz Kierkegaards vorangestellt. Sie lautet: „Es gibt einen Vogel, der Regenprophet heißt, und so bin ich; wenn in der Generation ein Ungewitter anfängt sich zusammenzuziehen, so zeigen sich solche Individualitäten, wie ich bin.“16
Als Unheilseher, bezogen auf die eigene Existenz, betrachtete Haecker auch sich selbst, und er sah die katastrophale Entwicklung des Nationalsozialismus voraus. Allerdings interpretiert Haecker die von Kierkegaard entworfenen Existenzkategorien – die ästhetische, die ethische und die religiöse – hinsichtlich der Theodizee trinitarisch.17
In seinem Buch „Der Begriff des Menschen und die Wahrheit“ (1937) widmet Haecker der Existenzphilosophie ein eigenes Kapitel. Er unterscheidet dabei zwischen Existenzphilosophie und Existenzialphilosophie und schreibt: „Existentialphilosophie ist entstanden als Reaktion auf die deutsche idealistische Philosophie. Sie ist zunächst einmal einfach ein Auf-den-Leib-Rücken gegen einem bloßen Auf-den-Gedanken-Rücken oder Auf-den-Begriff-Rücken der idealistischen Philosophie. Am Beginn der Existentialphilosophie steht Sören Kierkegaard, wie der Ahn der Existenzphilosophie Sokrates ist.“18
Vergil – Vater des Abendlandes
„Ich muß ein Wort verlieren – möge es nicht verloren sein!“ – so beginnt Haecker das neunte Kapitel seines Buches „Vergil. Vater des Abendlandes“ zum Thema „Vergil und die Deutschen“. Er verweist dabei auf den großen Verlust des Vergil’schen Gedankengutes, das noch jedem „guten Europäer“ bis ins 18. Jahrhundert hinein geläufig war. Nun aber sei „das Auge des Deutschen (...) krank und schielend geworden“.19
Bernhard Hanssler zeichnete in seinem Vortrag „Vergil und das Abendland“ anlässlich einer Haecker-Tagung in Stuttgart-Hohenheim ein praxisnäheres Bild von den Hirten, Bauern und Herrschergestalten des Vergil’schen Werkes: „Aeneas rettet sich aus dem brennenden Troja. Schon diese Szene ist das verdichtete Bild der ganzen Darstellung: Aus dem Feuer der Geschichte retten sich die Handelnden, indem sie die Vergangenheit teils zurücklassen, teils mitnehmen, vor allem aber die Möglichkeiten der Zukunft in Sicherheit bringen im Geleit der göttlichen Mächte.“20
Haeckers Buch war zum zweitausendsten Geburtstag Vergils erschienen. Er vertritt darin das Maß einer christlichen Daseinsordnung als Erbe der Griechen. Otl Aicher nennt diese Publikation ein „fast theologisches buch“, „eine auseinandersetzung mit der philosophie der zeit“, aber vor allem auch ein „politisches buch (...) – eine zornige, prophetische abrechnung mit den neuen herren, ihren wegbereitern und epigonen. gewiß, geschrieben in einer verschlüsselten sprache, aber wer sie lesen konnte, behielt das buch in seiner rocktasche.“21
Haecker und das Christentum waren eins, seine Philosophie und das Christentum sind ohne einander nicht zu denken.
Als Beispiele für die geistige Gegnerschaft Haeckers zum Nationalsozialismus mögen etwa die Kommentare über Symbole des NS-Staates dienen, die dem Christentum und seiner humanitären Philosophie auf extreme Weise widersprechen, wie beispielsweise das Hakenkreuz. Dieses entlarvte er als Zeichen des Antichrist und „objektiven Schwindels, bei dem nicht einmal die [politische] Bewegungsrichtung festliege“, als „die letzte deutsche Schmach dieser Tage: das Zeichen des Tieres, die Karikatur des Kreuzes“,22 und reihte es ein in das „vergängliche Gewalttätige“. Am Ende des Epilogs seines Werkes geht er ein auf die „populäre Meinung des Mittelalters, daß Vergil ein Prophet und Magier war. Seine einzelnen Worte und Sätze (...) geben (...) Ausdruck dem Leid und der Schwermut, aber auch wieder der Hoffnung auf bessere Tage ...“.23 Auch Haecker war ein Visionär, der das nahende Unheil durchschaute.
Haeckers „Vergil“ wurde von Zeitgenossen in seinem Sinne rezipiert. So hatte sich Willi Graf, später Mitglied der Kerngruppe der „Weißen Rose“, angeregt durch den mit Haecker zusammenarbeitenden Philosophie- und Theologiestudenten Aloys Goergen – später Professor für Philosophie der Ästhetik an der Münchener Akademie der Bildenden Künste und Professor für Liturgiewissenschaft an der Universität Bamberg –, schon in den Dreißigerjahren mit den Schriften Haeckers, insbesondere mit dem „Vergil“ beschäftigt.
In dem Essay „Der Begriff der Wahrheit bei Sören Kierkegaard“, aus dem Karl Muth 1933 im „Hochland“ Auszüge veröffentlichte, befasst Haecker sich mit dem nahenden Unheil. Auch in einem Vortrag zum Thema „Das Chaos der Zeit“ vor dem Verband katholischer Akademiker im Auditorium Maximum der Münchener Universität am 17. November 1933 brachte Haecker wiederum seine Angriffe auf den Nationalsozialismus zum Ausdruck.
Im Dezember 1932 kam die Zeitschrift „Brenner“ mit einem auffallenden Streifband ins Weihnachtsgeschäft, zusätzlich wurden einhundertsiebzig Frei- und Rezensionsexemplare verschickt. Haeckers Freund Max Stefl verhandelte mit Ficker, dem Verleger, sogar darüber, ob man diesen Abschnitt über das „Reich“ nicht sogar als Massenbroschüre herausbringen könne, denn die unterschiedliche Auffassung vom „Reich“ sollte an ein breites Publikum gelangen.
Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten kam Haecker dadurch in große Gefahr; er geriet in den Verdacht staatsgefährdender Aktivitäten: Einmal hatte Karl Muth im „Hochland“ noch im März 1933 daraus zitiert. Aufgrund der Presseverordnungen vom 30. Januar 1933 war Haecker gezwungen, Ficker per Einschreiben am 4. April 1933 schriftlich zu beauftragen, eine Schwärzung der anstößigen Seiten vorzunehmen, was diesem jedoch nicht mehr gelang.
Der Münchener Kulturbeirat beantragte wegen dieser Veröffentlichung eine sechsmonatige „Schutzhaft“ gegen Haecker; das Verfahren wurde glücklicherweise niedergeschlagen.
Haecker glaubte sich nun sicher, unternahm eine Fahrt auf den Spuren Catulls und Vergils. Doch nach seiner Rückkehr wurde er am 20. Mai 1933 verhaftet.24
Haeckers Wohnung wurde nach „Brenner“-Heften durchsucht, Haecker jedoch infolge der Intervention eines Mitarbeiters im Münchener Schreiber-Verlag nach wenigen Stunden wieder entlassen.25 Diese Verhaftung und das Gestapo-Verhör hinterließen einen nachhaltigen Eindruck:
„Die Wahl, in die Hände Gottes, oder in die Hände der Menschen zu fallen, macht mir keine Qual. Ich will in die Hände Gottes fallen, seien sie noch so furchtbar. ... Nur einen Tag kostete ich, was es heißt, in die Hände der Menschen zu fallen – am 20. Mai 1933.“26
Haeckers Schicksal wurde bereits ausführlich charakterisiert, deshalb seien hier nur einige Eckpunkte in Erinnerung gerufen:
Das Redeverbot, das ihm schon 1932 für den Regierungsbezirk Aachen auferlegt wurde.
Im gleichen Jahr die nationalsozialistischen Anpöbelungen, die er sich im Hörsaal Martin Heideggers gefallen lassen musste, als er zum Thema „Der Christ und die Geschichte“ sprach.
Der Zwang, eine Vortragsreise nach Berlin und Ostpreußen abzusagen.27
Das 1936 gegen ihn von der bayerischen politischen Polizei verordnete Redeverbot.
Rede- und Publizierverbot hinderten Haecker nicht, an Übersetzungen zu arbeiten und ein heimliches Tagebuch zu führen, in dem er die nationalsozialistische Ideologie brandmarkte. Hitler nannte er in seinen Aufzeichnungen zu einer Zeit, als dieser vielen „als ein Befreier der Deutschen aus den Fesseln des Versailler Diktats“28 erschien, eine „Ausgeburt der Hölle“.
Die „Tag- und Nachtbücher“
Theodor Haeckers „Tag- und Nachtbücher“ zählen zu den bedeutendsten Zeugnissen der inneren Emigration gegen den Nationalsozialismus. Sie erschienen zwei Jahre nach Haeckers Tod in der Hegner-Bücherei bei Kösel in München, herausgegeben von Heinrich Wild. Dabei handelt es sich jedoch um einen Auswahlband, in dem nur ein Teil dessen, was Haecker sagte und meinte, enthalten war. In der Rezension von Adolf von Grolman in der „Rhein-Neckar-Zeitung“ vom 9. August 1947 heißt es u. a.: „Die Aufzeichnungen Theodor Haeckers als solche sind (...), darüber besteht kein Zweifel, weittragender und schwerer als das, was in dem vorliegenden Auswahlband geboten wird. Ich habe sehr oft mit Haecker sämtliche Probleme, die in den ,Tag- und Nachtbüchern‘ angeschnitten sind, durchgesprochen und weiß, dass Haecker sehr viel radikaler noch dachte, als es möglich war, selbst es in diesen mutigen Blättern niederzulegen. Es ist also nur ein Teil dessen, was Haecker dachte und meinte, was hier vorgelegt wird. Das muß man wissen. (...) denn es werden Zeiten kommen, wo die Personen, die das wissen, nicht mehr leben. Und es wäre nicht richtig, das Dokumentarische dieser Aufzeichnungen zu gering oder auch zu weitgriffig zu erfassen.“29
Die „Tag- und Nachtbücher“ sind in den vielen „Schreibenächten“ entstanden und waren vielfach der Entdeckung durch die Gestapo ausgesetzt. Was Haecker als unerbittlicher Gegner des Nationalsozialismus zu Papier brachte, war lebensgefährlich. Es handelte sich vorwiegend um „aphoristische Zeitkritik, philosophisch-religiöse Reflektion, polemisches Notat, Selbstbesinnung und Selbstbestimmung in einsamem Selbstgespräch, Dialog, Diatribe und Gebet.“30
Irene Haecker hat die „Tag- und Nachtbücher“ auf ihre Weise gerettet. Oft erzählte sie davon, und Nachlebende berichten darüber:
„In ihrer hohen Sensibilität kommt sie, von innerer Unruhe getrieben, gerade in dem Moment zu hause an, als ihr Vater einer Hausdurchsuchung ausgeliefert ist, täuscht große Eile vor und kann auf diese Weise als Klaviernoten getarnt, das Manuskript der ,Tag- und Nachtbücher‘ bei Pfarrer Max Blumenschein sicherstellen. Wie wenn nichts wäre, kommt sie wirklich mit Klaviernoten zurück, die dann tatsächlich überprüft werden. Das ist die Rettung ihres Vaters!“31
Lese- und Diskussionsabende im Kreis von Studenten und Mentoren
Lese- und Diskussionsabende mit Theodor Haecker gehörten, wie Richard Seewald in seinen „Lebenserinnerungen“ berichtet, schon seit 1911 zum Münchener Geistesleben. Jahrzehnte später fanden sie auch im Hörerkreis der Studenten der später so benannten Widerstandsgruppe „Weiße Rose“32 statt.
Dabei ein literarisches Interesse überschreitend, schuf Otl Aicher aus dem Freundeskreis der Geschwister Scholl in den Jahren 1940/41 über Karl Muth die erste direkte Verbindung zu Theodor Haecker. Dazu schreibt er 1942/43:
„Vor zwei Jahren hatte ich Carl Muth kennen gelernt, später Haecker. Nun war auch für Hans und Sophie eine enge Verbindung daraus geworden. Hans hatte Muths Bibliothek geordnet, Sophie wohnte gelegentlich bei ihm. Es gab Vorleseabende mit Haecker und weiteren Freunden von Muth, um außerhalb der Öffentlichkeit in Zirkeln dafür zu sorgen, dass die Gegner dieses Staates nicht auseinander dividiert und in die Isolierung gedrängt werden.“33
Diese Umschreibung enthält Hinweise auf die beflügelnden Leseabende und auch auf deren dezidierte Zielsetzung, die Gegner des NS-Staates zu versammeln, zu solidarisieren und durch „geistige Nahrung“ moralisch zu stärken.
Für Otl Aicher und die Geschwister Scholl waren Leseabende nichts Neues: Schon 1938 hatten sie solche im Haus der Familie Scholl in Ulm veranstaltet und ein Theaterstück von Henry von Heiseler mit verteilten Rollen, philosophische Texte des russischen Glaubensverteidigers, Dichters und Religionsphilosophen Wladimir Solowjew (1853 – 1900) und des ebenfalls russischen Philosophen Nikolai Berdjajew (1874 – 1948) gelesen. Letzterer vertrat seit 1911 eine „Philosophie der Freiheit“ und hatte nach seiner Abkehr vom Marxismus die religionsphilosophische Zeitschrift „Der Weg“ herausgegeben.
Die Studenten aus diesem Kreis waren auch mit älteren Freunden und Mentoren in Kontakt, die teilweise ebenfalls die Leseabende besuchten. Dazu gehörten Schriftsteller, Wissenschaftler, Buchhändler, Architekten, Journalisten und Maler, Persönlichkeiten wie Karl Muth, Theodor Haecker, Kurt Huber (1893 – 1943), Alfred von Martin (1882 – 1979), Werner Bergengruen (1892 – 1964), Sigismund von Radecki (1891 – 1970), Josef Furtmeier (1887 – 1969), Josef Söhngen (1894 – 1970), Heinrich Ellermann, Harald Dohrn (1885 – 1945), Manfred Eickemeyer und Wilhelm Geyer (1900 – 1968).
Vermerke Willi Grafs in seinem Tagebuch weisen auf die Leseabende hin. Er selbst wurde aller Wahrscheinlichkeit nach im Anschluss an eine Lesung Theodor Haeckers aus „Der Christ und die Geschichte“ in den engsten Kreis der Weißen Rose einbezogen.34
Um existenzielle Fragen ging es ab 1941 auch bei den Leseabenden der Münchener Studentengruppe und ihrer Mentoren, die Haecker zwar mitgestaltete, in deren Aktionen er aber nicht eingeweiht war. Die Orientierung am Vorbild Haeckers geht aus Schriften, Briefen, Tagebüchern und Flugblättern hervor. Otl Aicher drückt diese Verbindung später so aus: „ermutigt durch hinweise haeckers, hatten wir begonnen, kierkegaard zu lesen35 und zu begreifen, was man neuerdings mit existenz meinte.
sophie hatte nicht unrecht, wenn sie darauf hinwies, daß heute die philosophie geneigt ist, kierkegaard mit seiner inneren erfahrung mehr recht zu geben als einer systemphilosophie der ,äußeren‘ seinskategorien, einer philosophie als wissenschaft.
(...) in einer diktatur tritt in der tat die frage nach der wahrheit, die eigentliche frage der philosophie in den hintergrund. es geht nicht mehr um die erkenntnis als erkenntnis, sondern um das jetzt richtige, um das für mich richtige. das subjekt kommt ins spiel. (...)
wo die wahrheit aber zum ereignis wird, wo sie in konstellationen auftritt, wo ihr kriterium die richtigkeit ist, wird philosophie zum handeln. zu einem handeln, das erkenntnisse freigibt.“36
Haeckers Einfluss hinsichtlich der Frage nach der Existenz wird auch von der Schriftstellerin Ilse Aichinger hervorgehoben: „So wie in Frankreich der Existenzialismus die Philosophie des Widerstandes war, so gab es auch bei uns einen christlichen Existenzialismus, der stark beeinflusst war von Søren Kierkegaard und Theodor Haecker.“37
Für die widerständigen Studenten stellte sich oftmals die Frage nach dem richtigen Weg: „Wohin sollen wir denn gehen?“ Theodor Haecker seinerseits setzte auf die Jugend, noch bevor er den Studenten in den Leseabenden begegnet war:
„Wenn man mir sagt, daß die heutige deutsche Jugend, die offizielle, von den 2500 Jahren christlicher (...) Geschichte nichts weiß, nichts wissen will und keineswegs begeistert werden kann, so weiß ich das und es macht mich traurig. Wenn man mir aber sagt, daß unter ihr überhaupt keiner sei, der im Innersten davon berührt werde, dann werde ich heiter, denn das glaube ich nicht, denn das ist nicht wahr. Es gibt solche, und sie sind der Adel der deutschen Jugend. Sie werden unter einer Wolke leben, wie ich auch. Sie werden aber im Glanze eines unsterblichen Lichtes stehen, wie ich auch. Und sie werden das wissen, wie ich auch.“ (Mai 1940)
Auf die andere Frage: „Was sollen wir tun in dieser schweren Zeit?“, rät Haecker seinen Gesinnungsfreunden im „Dialog über Europa“:
„In solcher Zeit, o meine Freunde, wollen wir beizeiten überlegen, was wir mitnehmen sollen aus den Greueln der Verwüstung. Wie Äneas zuerst die Penaten, so wir das Kreuz, das wir immer noch schlagen können, ehe es uns erschlägt. Und dann: nun, was einer am heißesten liebt. Wir aber wollen nicht vergessen unsern Vergil, der in eine Rocktasche geht.“38
Haecker hatte der Kunsthändlerin Grete Volle diese Sätze aus Bremen als Widmung in ihr Exemplar von „Was ist der Mensch?“ geschrieben. Sie charakterisieren seine christliche Position. Rückblickend geht auch Otl Aicher auf dieses Buch ein, um damit die „Unangepasstheit“ Haeckers einmal mehr zu beweisen.
Haeckers Menschenbild und dessen Zusammenhang mit der „Weißen Rose“, um das es hier geht, kommt in vielen seiner Texte zum Ausdruck. Dabei sieht er den Menschen auf christlicher Grundlage, als einen, der sich um Gerechtigkeit bemüht, nach Wahrheit strebt, frei ist von Überheblichkeit und Machtanmaßung. Deshalb gewahrte er umso intensiver auch das Gegenbild seiner Vorstellung vom Menschen. Enthalten ist darin auch eine umfangreiche Passage über das „Reich“.
Am 4. Februar 1943, kurz vor den letzten verzweifelten Aktionen der „Weißen Rose“, ist in Willi Grafs Tagebuch ein nochmaliges Treffen vermerkt:
„Um 16 Uhr treffen wir uns: Häcker liest den ersten Teil aus seinem ,Schöpfer und Schöpfung‘. Über zwei Stunden spricht er, ich habe manches Besondere verstanden und gehört.“39
Bei dieser Lesung, die im Atelier Eickemeyer stattfand, waren etwa 25 Freunde und Bekannte anwesend, darunter aus dem engsten Kreis der „Weißen Rose“ Hans und Sophie Scholl sowie Willi Graf. Sophie Scholl berichtete über Haeckers Lesung in einem Brief an ihren Freund Fritz Hartnagel:
„Seine Worte fallen langsam wie Tropfen, die man schon vorher sich ansammeln sieht, und die in diese Erwartung hinein mit ganz besonderem Gewicht fallen.“40
Aus einer späteren Darstellung von Elisabeth Hartnagel-Scholl geht hervor, dass man nicht über die Flugblatt-Aktionen gesprochen, sondern vielmehr das Regime kritisiert hatte, wie man es nur unter Gleichgesinnten überhaupt wagen konnte.
Auch hier erweist sich Haecker, den seine Satire zum kritischen Historiker des „Dritten Reiches“ werden ließ und der auch in seinen Tagebüchern die Verlogenheit des Nationalsozialismus brandmarkte, als einer, der mit seinen Worten verschlüsselte Botschaften weitergab.
Bei einem Vergleich zwischen dem Haecker’schen Werk und Texten, Briefen und Flugblättern der „Weißen Rose“ lassen sich vor allem hinsichtlich der Begriffswahl zahlreiche Affinitäten feststellen. Hinsichtlich der widerständischen Studenten ist auch der Einfluss Otl Aichers – ein enger Freund der Geschwister Scholl seit der Ulmer Zeit – nicht zu unterschätzen, der vielfach als Ideengeber gesehen werden muss.
Obwohl er wegen seiner Verweigerungshaltung gegenüber dem NS-Regime persönliche Konsequenzen ziehen musste, hatte er weder Kenntnis von den Aktionen der „Weißen Rose“ noch hätte er sie, wie aus seinen schriftlichen Äußerungen hervorgeht, als erfolgreich eingeschätzt.
Unter Reflexion der Ausdruckswahl Haeckers selbst und der Aicher’schen Texte, die auf Theodor Haecker verweisen, sollen nun einige Begriffe erläutert werden.