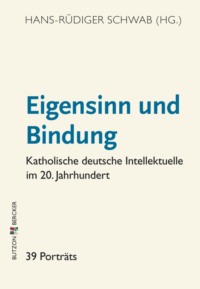Kitabı oku: «Eigensinn und Bindung», sayfa 13
Existenz
Haecker zitiert bei den Leseabenden beispielsweise aus „Der Christ und die Geschichte“:
„Gott zu lieben und seinen Nächsten (...) das ist der letzte Sinn der Geschichte, gegenüber welchem alles andere im strengsten Sinne des Wortes – gleichgültig ist.“
„Die Kirche Christi ist auch eine politische im radikalen Unterschiede zu den vielen sonderbaren zum Teil abscheulichen ,Religionen‘, gegen die Rom (...) tolerant war, wie kein Staat oder Imperium vor ihm, oder auch nach ihm. (...) Die Christen sind vom römischen Staate verfolgt worden um eines in dessen Augen politischen Verhaltens willen: weil sie dem Kaiser zwar geben wollten, was des Kaisers ist (und sich darin von niemand übertreffen lassen wollten), aber nicht das, was nur Gottes ist, und weil sie des Glaubens waren, daß es allein der Autorität der Kirche zukomme, zu entscheiden ... was des Kaisers ist und was nicht. Das Höhere entscheidet über das Niedere (...). Das ist so die Ordnung, das war so und wird so sein.“41
Insbesondere die christlich orientierten Mitglieder der „Weißen Rose“ zogen daraus Konsequenzen für sich selbst und waren zu einem „radikalen“ Christentum (so Otl Aicher), ja zum Martyrium bereit. Hätten sie das Glück gehabt, als junge Menschen in einem demokratischen Staat zu leben, hätte diese Entscheidung nicht angestanden. So aber ertrugen sie die Verfolgung wegen ihrer Weltanschauung und ihres politischen Widerstandes gegen den Terrorstaat aus christlicher Überzeugung. Davon zeugen unter anderem die Briefe Willi Grafs während seiner halbjährigen Einzelhaft im Strafgefängnis München-Stadelheim42 sowie Diktion und Argumentationsweisen in den Flugblättern, die Haeckers geistigen Einfluss erkennen lassen.
Die Frage nach dem Ursprung des Bösen – die Lüge
Haecker fragt in seinen Schriften nach dem Ursprung des Bösen, das er vor allem im Moralischen zu finden glaubt, während er in seiner Theodizee – der Rechtfertigung Gottes angesichts der Macht des Bösen – die physischen Übel meint. Dabei geht er auch der schwierigen Frage nach, ob Gott das Böse nur zulasse, weil er der Schöpfer der Welt ist, oder ob er dabei mitwirke. So stellt Georg Karl Frank nicht zu Unrecht die Frage danach, ob Haecker, wäre es ihm möglich gewesen, das Seine zu einer „Theodizee nach Auschwitz“ beigetragen hätte: „Mit Sicherheit! Denn Ansätze dafür gibt es genug, nicht nur in seinen ,Tag- und Nachtbüchern‘.“43
„Dass Gott Herr der Geschichte ist, die Welt aber im Argen liegt, erklärt das Faktum, dass in aller Geschichtsbetrachtung die Theodizee ein integrierender Bestandteil ist. Gott will die Theodizee, Er lässt sie nicht bloß zu.“44
In den Flugblättern der „Weißen Rose“ wird Hitler gedeutet als einer, der im Dienste des Bösen steht, als Antichrist, als Dämon. Überall und zu allen Zeiten hätten „Dämonen im Dunkeln gelauert auf die Stunde, da der Mensch schwach wird, da er seine ihm von Gott auf Freiheit gegründete Stellung im ordo eigenmächtig verlässt, da er dem Druck des Bösen nachgibt“.
Fast alle Gegner Hitlers stellten ihn als Lügner dar. Auch bei Theodor Haecker ist ein viel gebrauchter Begriff die „Lüge“. Haecker wollte mit der Kraft des Wortes die Verlogenheit des Nationalsozialismus entlarven.45 So verteidigte er schon 1928 in der Publikation „Über Humor und Satire“ den Humor als „letzten und höchsten geistigen Raum des Humanen“.46
Die „Weiße Rose“ beabsichtigte ebenfalls die politische und menschliche Realität im Hitler-Deutschland aufzuzeigen. Im zweiten Flugblatt wirft sie deshalb den Nationalsozialisten Betrug an den Mitmenschen vor und bezeichnet sie als eine Bewegung, die sich „nur durch die stete Lüge“ retten könne. Auch im vierten Flugblatt wird nochmals der gleiche Vorwurf erhoben: „Jedes Wort, das aus Hitlers Mund kommt, ist Lüge.“
Staatsgewalt, Gerechtigkeit und politischer Mord
Die bei den Leseabenden der „Weißen Rose“ vorgetragenen Gedanken aus dem Werk „Der Christ und die Geschichte“ gründen auf der „Mitarbeit des freien Menschen an der Gestaltung dieser Welt“, also an der Geschichte, was von Christen vielfach unterschätzt, von Nichtchristen hingegen, zumindest im europäischen Raum, in der Regel überschätzt werde.47 Jedes politische Ordnen habe ein Ziel. Es müsse nämlich nach der Idee der Gerechtigkeit gestaltet sein, nur darin liege der volle Sinn des Politischen. Dieser Sinn werde nicht erfüllt, wenn die Idee der Gerechtigkeit nicht vorhanden sei. Vom Individuum gehe eine gerechte Ordnung unter Gemeinschaften und Völkern aus. Haecker sieht den Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit und Schuld, aber auch den zwischen Recht und Schuld.48 Wenn er das Ziel des Politischen darlegt, so ist es der Friede auf der Grundlage der Gerechtigkeit.
In dem kurzen Beitrag „Der Staat seid ihr“49 von 1931 reflektiert Haecker den politischen Mord als „Kurzschluss von Phrase und bloßliegenden Nerven“,50 der mit dem, was ernsthafte Denker mit „Tyrannenmord“ meinten – dazu gehörten Ideen, Wille oder Entschluss, ein sinnvoller Plan oder ein Opfer –, nichts zu tun habe. Das politische Morden der unmittelbaren Gegenwart habe mit besonderer Ehrlosigkeit zu tun, weil es ohne politisches Denken vor sich gehe.
Was heute in Deutschland geschehen müsse, sei Denken, Denken und nochmals Denken! Untaten, die als „politische Morde“ bezeichnet würden, „entstehen nicht aus dem Nichts, so wenig wie die Tat (ein deutscher Irr- und Unglaube!) sich selbst gebiert, sondern sie kommen aus der Phrase und Lüge. Ist es ein Mangel an Denkkraft im Staatsmann, diese Ursprünge nicht zu sehen, so ist es, wenn er sie erkannt hat, ein Verbrechen von ihm, die Mittel des Staates, die primär Machtmittel sind, nicht zu gebrauchen; gegen die Äußerung von Phrasen und Lügen.“51
Wie der Staat seine Macht anwende, sein einziges politisches Mittel, sei eine Frage der Kardinaltugend des Staates als Person, also des Staatsmannes.
Die „Weiße Rose“ setzt in ihrem dritten Flugblatt „Salus publica suprema lex“ ebenfalls einen besonderen Akzent. Wie Theodor Haecker sieht auch sie im Staat eine Analogie zur göttlichen Ordnung. Er soll die „civitas Dei“ zum Vorbild haben, dessen höchstes Gesetz das Wohl aller ist. Dagegen sei der heutige Staat „die Diktatur des Bösen“, der den Menschen ihre Rechte raube, so lange bis nur ein „mechanisches Staatsgetriebe“ übrig sei, „kommandiert von Verbrechern“. Das Volk müsse von der „Zerstörung aller sittlichen und religiösen Werte überzeugt werden und so zum passiven Widerstand veranlasst werden“, denn es sei „sittliche Pflicht (...), dieses System zu beseitigen“.52
Apokalyptische Bilder
Theodor Haeckers Position als Mentor lässt sich auch an vielen anderen Äußerungen in den Flugblättern der „Weißen Rose“ erkennen – in Argumentationsweise, Diktion und Gehalt sowie einer Vielzahl apokalyptischer Bilder.53
So reflektiert er beispielsweise den Begriff der „Gottesgeissel“ in seinen „Tag- und Nachtbüchern 1940“. Auch die „Weiße Rose“ spricht in ihrem ersten Flugblatt, das im Mai 1942 erschien, von der „Geissel der Menschheit, wider den Faschismus und jedes ihm ähnliche System des absoluten Staates“.
Haecker zeichnet apokalyptische Bilder vom Krieg. In seiner tagebuchartigen Kritik an zwei Weltkriegen und ihren wahrhaft apokalyptischen Situationen zeigt sich einmal mehr die satirisch-polemische Seite des Kulturphilosophen. Insbesondere in „Satire und Polemik“ (1922)54 geht er unter Bezug auf den Ersten Weltkrieg darauf ein, dass „die Ehre des natürlichen Menschen, des Kriegers und Soldaten (...) in diesem Krieg für den konkreten europäischen Menschen vollends vernichtet worden“55 sei. In seinen Tagebuchaufzeichnungen beruft er sich wiederholt darauf, dass das technisch Machbare moralisch nicht zu bewältigen sei, und er macht diese Aussage zum Kernpunkt der Kritik des modernen Krieges.
Ein weiteres wichtiges Thema bei Haecker und der „Weißen Rose“ ist die als solche bezeichnete „Judenfrage“. Obwohl er auch mit Beiträgen im „Hochland“ dieser schwierigen Frage und der sich abzeichnenden Katastrophe nachging, wurde er kaum gehört. Seine Argumente und Appelle an Menschenwürde und Gerechtigkeit und sein Aufzeigen der Gefahren für die jüdische Bevölkerung verhallten. Aus der Erkenntnis, dass der Nationalismus äußerst bedrohlich für die jüdische Bevölkerung sei, stellte er fest, dass die Juden „dort, wo diese Welt des Nationalismus siegt, immer für Feinde gelten“56 werden. Ebenso sieht er den durchschnittlichen Bürger in Deutschland als „latenten Antisemiten“.
Im Zusammenhang mit dem christlichen Menschenbild, das den Menschen als Ebenbild Gottes sieht und das auch Theodor Haecker in seinen Schriften „Der Christ und die Geschichte“ und „Schöpfer und Schöpfung“ (1935) zu vermitteln suchte, ist verständlich, dass die „Weiße Rose“ die Nationalsozialisten anprangerte. Nicht zufällig scheint im zweiten Flugblatt die Frage nach dem „Sinn der Geschichte“ und die letztliche Reinigung durch das Leid auf, wenn über die bestialische Ermordung von Juden berichtet wird.
Vision eines künftigen Europa
1932 erschien der Essay „Betrachtungen über Vergil, Vater des Abendlandes“, im Novemberheft des „Brenner“.57 Zur Vision eines künftigen Europa gehörte für Haecker die lateinische Antike. Dieser Essay war sozusagen die „Antwort“ auf ein Buch von Fritz Büchner mit dem Titel: „Was ist das Reich? Eine Aussprache unter Deutschen“, das auch als Aufsatzreihe in den „Münchener Neuesten Nachrichten“ veröffentlicht worden war.
Vorangegangen war Haeckers „Satire und Polemik“ hinsichtlich des Diktats von Versailles. Seine Begründung für eine europäische Vision liegt im Christentum und „humanen Ideen der Versöhnung“.58 Auch im sechsten Flugblatt der „Weißen Rose“ geht es um die Verantwortung des Einzelnen in einem neuen Staat: „Es gilt der Kampf jedes einzelnen um unsere Zukunft, unsere Freiheit und Ehre in einem seiner sittlichen Verantwortung bewussten Staatswesen.
(...) auch der Satiriker erreicht im Verborgenen zuweilen etwas. Wo noch eine natürliche geistige Jugend ist, da stärkt er ihre Angst vor der Leere und dem Geschwätz, ihren Mut zur Höhe und Fülle der Weisheit, ihren Abscheu, ihre Begeisterung, ihren Entschluss, ihr Schweigen und ihr Wort.“59
Doch anders, als der Philosoph Haecker die „Tat“ beurteilte, die er niemals als eine Aktion wie die der Geschwister Scholl sah, verstand die „Weiße Rose“, die in ihren Flugblättern immer wieder an den passiven Widerstand appellierte, für sich selbst eine Tat im vollen Wortsinn auch als physischen Einsatz. Nur so sind letztlich ihre Aktionen zu verstehen. Auch im zweiten Flugblatt entwirft sie eine Zukunftsvision:
„Es ist uns nicht gegeben, ein endgültiges Urteil über den Sinn unserer Geschichte zu fällen. Aber wenn diese Katastrophe uns zum Heile dienen soll, so doch nur so: Durch das Leid gereinigt zu werden, aus der tiefsten Nacht heraus das Licht zu ersehnen, sich aufzuraffen und endlich mitzuhelfen, das Joch abzuschütteln, das die Welt bedrückt.“60
Der Gestapo waren Haeckers Kontakte zur „Weißen Rose“ nicht verborgen geblieben. Unmittelbar nach der Verhaftung der Geschwister Scholl fand in Haeckers Wohnung eine vierstündige Hausdurchsuchung statt. Haecker wurde in das Münchener Gestapo-Gefängnis im Wittelsbacher Palais gebracht, dort vernommen und abends wieder entlassen. Am gleichen Tag entging auch eine Abschrift seines Tagebuch-Manuskripts bei einer Durchsuchung im Hause Karl Muths dem Zugriff der Gestapo.61
Am 1. März 1943, eine Woche nach der Hinrichtung der Geschwister Scholl und Christoph Probsts, veranlasste die Gestapo in ihrer Nervosität und der Annahme, dass sich eine viel größere Zahl von Studenten, als ihr bekannt geworden war, hinter der Weißen Rose verberge, die Einleitung eines neuen Verfahrens gegen Theodor Haecker wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“. Dieses wurde jedoch wieder eingestellt.
Theodor Haeckers Bücher waren nicht nur Bücher, seine Vorträge und Lesungen nicht nur kulturkritisch-philosophische Präsentationen, sondern vielmehr „Konfessionen“, die für die Zukunft wirksam werden sollten. „,Vergil. Vater des Abendlandes‘: das war nicht nur ein Buch, das war ein kulturpolitisches Programm, übrigens schon 1931 beim ersten Erscheinen.“62 Die „Tag- und Nachtbücher“ waren nicht nur Tagebücher, sondern mit ihren Inhalten von Dichtung, Philosophie, Ästhetik, Theologie und Politik ein Lebensprogramm gegen den totalitären Staat. In ihrem Bezug auf „Themen der neudeutschen Herrgottreligion“, „Hybris der Kriegstechnik“, „Hybris des Menschen“, „Rolle der Kirche“, „Überlegungen zur Stunde des Bösen“, „Auftrag und Gebot der Liebe“ und „Aufruf an den Einzelnen zur Umkehr“ gemahnen sie auch uns Heutige.63 Mit den grundlegenden Fragen nach Wahrheit und Existenz überdauern sie wohl jegliche Zeiten.
Schriften von Theodor Haecker: Werke. 5 Bde. München 1958 – 1967 (Bd. 1: Essays; Bd. 2: Tag- und Nachtbücher. 1939 – 1945; Bd. 3: Satire und Polemik. Der Geist des Menschen und die Wahrheit; Bd. 4: Was ist der Mensch? Der Christ und die Geschichte. Schöpfer und Schöpfung; Bd. 5: Vergil. Schönheit. Metaphysik des Fühlens) – Eva Dambacher (Bearb.): Bibliographie Theodor Haecker. In: Hinrich Siefken (Bearb.): Theodor Haecker. 1879 – 1945. Marbach a. N. 1989, 71 – 95.
Sekundärliteratur: Detlef Bald (Hg.): „Wider die Kriegsmaschinerie“. Kriegserfahrungen und Motive des Widerstandes der „Weißen Rose“. Essen 2005, 47 – 54 – Gebhard Fürst/Peter Kastner/Hinrich Siefken (Hg.): Theodor Haecker (1879 – 1945). Verteidigung des Bildes vom Menschen. Stuttgart 2001 – Winfrid Halder: Die Spuren des Widerstandes. Theodor Haecker in der politischen Landschaft des frühen 20. Jahrhunderts – eine Spurensuche. In: Freiburger Diözesan-Archiv 127 (2007), 105 – 134 – Bernhard Hanssler/Hinrich Siefken (Hg.): Theodor Haecker: Leben und Werk. Texte, Briefe, Erinnerungen, Würdigungen. Zum 50. Todestag am 9. April 1995. Esslingen 1995 – Klaus Kunissen: Theodor Haecker als Literaturkritiker. In: „... aus einer chaotischen Gegenwart hinaus ...“ Gedenkschrift für Hermann Kunisch. Hg. v. Lothar Bossle. Paderborn 1996, 53 – 65 – Florian Mayr: Theodor Haecker. Eine Einführung in sein Werk. Paderborn/München/Wien/Zürich 1994 – Barbara Schüler: „Geistige Väter“ der „Weißen Rose“. Carl Muth und Theodor Haecker als Mentoren der Geschwister Scholl. In: Rudolf Lill/Klaus Eisele (Hg.): Hochverrat? Neue Forschungen zur „Weißen Rose“. Konstanz 1999, 101 – 128 – Hinrich Siefken: Der Schriftsteller Theodor Haecker und die Satire. In: Heidrun Colberg/Doris Petersen (Hg.): Spuren. Festschrift für Theo Schumacher. Stuttgart 1986, 435 – 452 – Ders.: Thomas Mann und Theodor Haecker. In: Internationales Thomas-Mann-Kolloquium 1986 in Lübeck. Bern 1987, 246 – 270 – Ders.: Die Weiße Rose und Theodor Haecker. Widerstand im Glauben. In: Ders. (Ed.): Die Weiße Rose. Student Resistance to National Socialism 1942/43. Forschungsergebnisse und Erfahrungsberichte. Nottingham 1991, 117 – 147 – Ders.: Theodor Haecker, Tag- und Nachtbücher 1939 – 1945. Diaries from the „Dark Ages“. In: Janet Wharton (Ed.): German Politics and Society from 1933 to the Wende. Nottingham 1992 – Paulo Astor Soethe: Der Christ – ein Satiriker? Ein Versuch, Heinrich Böll und Theodor Haecker ins Gespräch zu bringen. In: Stimmen der Zeit 217 (1999), H. 5, 341 – 350 – Sönke Zankel: Theodor Haecker und die Juden. In: Niklas Günther/Ders. (Hg.): Abrahams Enkel. Juden, Christen und die Shoah. Stuttgart 2006, 29 – 40
Konrad Weiß (1880 – 1940)
„Man darf nicht reifer sein im Geiste als in der Sünde seiner Natur“
Konrad Weiß und seine Verortung des Glaubens im Geheimnis der Schöpfung und der Menschwerdung
Michael Schneider
Auch wenn Hauptwerke des schwäbischen Dichters Konrad Weiß noch in einzelnen Ausgaben vorliegen, dürfte der Schriftsteller selbst inzwischen eher in Vergessenheit geraten sein. Nicht wesentlich anders verhielt es sich schon zu seinen Lebzeiten. 1880 in Rauenbretzingen bei Schwäbisch Hall geboren, arbeitete er in den Jahrzehnten seiner journalistischen und dichterischen Arbeit am Rande der deutschen literarischen Welt, vor allem als Kunstkritiker an den „Münchener Neuesten Nachrichten“, seit Karl Muth ihn 1920 aus der Redaktion der Zeitschrift „Hochland“ fortgeschickt hatte.1
Entäußerung des guten Lebens
Seinen ersten Gedichtband veröffentlichte Konrad Weiß 1918, also mit 38 Jahren. Über die Zeit davor wissen wir kaum etwas. Allerdings sind Studienhefte aus den Jahren 1909 bis 1915 und Tagebücher aus den Jahren 1914 bis 1919/20 erhalten; es waren Jahre der inneren Krise, aber auch der Synthese.2 Nach dem Abschied aus der Mitarbeit am „Hochland“ wandte er sich nun ganz der Lyrik zu.
Die Aufzeichnungen dieser Zeit, die bruchstückhaft waren, blieben für Konrad Weiß so wichtig, dass er in späteren Jahren immer wieder an ihnen weiterarbeitete. Festgehalten sind einzelne Begebenheiten des Alltags wie auch Erwägungen zu inneren und äußeren Erlebnissen, vor allem die Erfahrung des Dunkels und der Ferne Gottes. Was er schmerzvoll durchleidet, wird nicht nachträglich begrifflich systematisiert; er belässt es in seinem Mangel und in seiner unfertigen Bruchstückhaftigkeit. Vieles bleibt offen – „auf dem Wege“. Was ihn zutiefst bewegt, fasst Konrad Weiß am 29. September 1915 in folgende Worte:
„Es drängt sich mir bei Betrachtung der angesammelten Gedanken und unvollendeten Werke eine fast frevelhaft gegen die Unendlichkeit scheinende Lebensregel auf: Man darf nichts größer werden lassen als man selber in seiner Zeit gerade ist (solange es die Beziehung seiner Natur zur Geschichte betrifft), man darf die Einsicht nicht über die Kräfte und sich die Wahrheit Gottes in der Welt nicht über den Kopf wachsen lassen. Man darf nicht reifer sein im Geiste als in der Sünde seiner Natur.“3
Konrad Weiß verzichtet bewusst darauf, sein Leben in den Griff zu bekommen. Erstes Zeichen dafür ist 1904 sein Austritt aus dem Priesterseminar in Tübingen und später sein Weggang vom „Hochland“. Etwas von dem, das ihn zu diesem Schritt bewogen haben mag, scheint in der eher brüsken Feststellung auf:
„Das Christentum, daß man es nicht vergißt,/das Christentum ist ein Verein/zufrieden als ein Kreissegment,/beamtet und voll braver Seelen ...“4
Konrad Weiß beschreibt es als „Faulheit“, aufgrund derer einer sich nicht in das Leben gestellt sehen will, um nur ja aller Tragik zu entkommen, und weshalb sich einer lieber mit einer „abstrakten“ bzw. „ästhetischen“ Existenz begnügt. Doch selbst wenn Konrad Weiß bekennt, dass er immer wieder der Versuchung begegnete, sein Leben nicht in die Hand zu nehmen, handelt es sich bei ihm keineswegs um „faule“ Bequemlichkeit: „Erfahrung, daß keiner sich selber einholen kann und auch sein Nächster kann ihn nicht einholen.“5
Kein Mensch kann den Bauplan seines Lebens wie ein „Ideal“ konzipieren und gleichsam vorwegnehmen; doch der Sünder will in sich selbst stehen und seine eigene Mitte sein. Der Glaubende hingegen ist in seinem Tun reines Empfangen; er lässt sich durch Sünde und Reue zu Gott hindrängen. Konrad Weiß erkennt, dass ihm kein anderer Ausweg bleibt, als sein Dasein als „passive Passion“ zu ergreifen und zu leben, denn, so lautet seine eher zaghaft formulierte Frage: „Wie kann man Gott zuvorkommen?“6 In dieser Zeit der inneren Krise wie auch ihrer Überwindung wendet sich Konrad Weiß bewusst der Lyrik zu.
Zwischen Bild und Wort
Es ist nicht leicht, einen angemessenen Zugang zum Werk und zur Sprache von Konrad Weiß zu finden. So las Frau Weiß in Siedlinghausen immer wieder viele Stunden und Tage lang aus dem Werk ihres 1940 verstorbenen Mannes vor, um es anderen auszulegen und sie zu einem tieferen Verständnis zu führen. Auffällig für seine Gedichte sind versetzte Wortstellungen, sogar Verstöße gegen die gängige Sprache, Zersetzung des grammatikalischen Gefüges und Brechung des Sprachrhythmus, Wechsel der Perspektiven, Verfremdungseffekte, einzelne abgebrochene, unvollendete Sätze, unterschiedliche Strophenlängen. Kaum dürfte es gelingen, die von Konrad Weiß formulierten Verse in einer für alle Leser verständlichen Weise zu kommentieren, um sie einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Das Besondere an Konrad Weiß ist sein Verständnis vom Auftrag des Dichters. In seiner Schrift „Vom Wesen der Dichtung“ beschreibt er in kurzen Worten, wie er seine eigene Sendung versteht: „Dichtung denkt nicht, sie findet sich in einem Sinne. Getrieben und gespiegelt geht sie die Spuren, in denen sie einen Weg findet zwischen Bild und Wort, einen Weg, als ob er von einem Sinne geplant sei (...) Die Blindheit muß sein wie ein Opfer. Sie kann nicht gedacht werden, aber sie bedeutet die Richtung und die Wahrheit des innersten Wortes.“7 Konrad Weiß verfasst mit seiner Dichtung ein Werk, das sich nicht in sich selbst („hermetisch“) verschließen will. Die Dunkelheit des Ausdrucks ist nicht gesucht und gewollt, sie ist etwas, was sich von selbst einstellt. Nicht Willkür ist es, die so sprechen lässt, auch keine ästhetische Selbstverliebtheit in irgendwelche sprachlichen Extravaganzen; alles kommt aus der Erfahrung, dass das, was der Dichter ins Wort zu fassen sucht, sich ihm selbst entzieht.
Das Dunkel des Wortes kommt weniger aus dem Dunkel einer tiefen seelischen Impression wie bei Georg Trakl, auch ist die Dunkelheit der Sprache nicht belastet mit der ungeheuren Tiefe seelischen Ringens und Kämpfens, selbst wenn vieles davon bei Konrad Weiß anklingen mag. Solche Dunkelheit erklärt sich aus der anderen, nicht allgemein vertrauten Erfahrung der „Erde“ und des Lebens, die sich intellektuell nicht gleich einholen lässt, weil sie als solche wohl einzigartig ist.
Aufgrund seiner ihm eigenen Erfahrung wendet sich Konrad Weiß entschieden gegen alle sich bloß auf die Tagespolemik einlassenden Schriftsteller, erst recht gegen jene, die sich einem „liberalen Idealismus“ anpassen wollen. Zurück bleibt die „Kreatur des Wortes“, die Erfahrung der endlichen und gebrochenen Wirklichkeit und Geschichte, nicht aber das System eines Geistes und einer Idee.8 Es gilt, in der Grammatik selbst einen Raum frei zu halten für die „Wortwerdung der Wahrheit“. In den „Nachgedanken“ heißt es: „Der allgemeine bürgerliche Geist arbeitet mit nebeneinander und gleichgestellten Begriffen. Er glaubt die Mittel zu besitzen, um welche Gott kämpft und die Schöpfung sinnt.“9
Den Willen, die Sprache gegenüber dem Geheimnis der Kreatur zu neutralisieren, erklärt Konrad Weiß mit dem Uranliegen der abendländischen Philosophie, die Wahrheit der Seinswirklichkeit definieren zu wollen. Statt Definition im System und Absicherung im Begriff geht es Konrad Weiß um Wortwerdung im Geheimnis der Kreatur, in dem ein letzter Rest verharrt, der sich nicht von der Logik einholen lässt. So wird der Kreatur ihr Schweigen, das sich nicht begrifflich ausdrücken lässt, belassen; sie verbleibt im Unaussprechbaren.