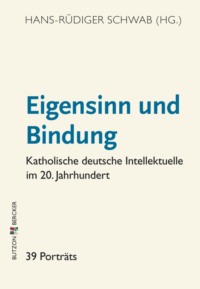Kitabı oku: «Eigensinn und Bindung», sayfa 6
Für ein in die Moderne hinein vermitteltes Christentum
Im Jahrzehnt nach der Jahrhundertwende setzen Annette Kolbs Bemühungen um eine neue Verhältnisbestimmung zu ihrem katholischen Erbteil ein. Die Heldin der 1905 entstandenen autobiographischen Erzählung „Torso“ hat ebenfalls eine problematische Schulzeit bei Nonnen hinter sich, die sie der Religion „zu sehr entfremdet“ hatte. Nach Umwegen findet sie am Ende wieder zu ihrem „verlorenen (...) Glauben“ zurück (WN 57) – auf einer neuen Ebene allerdings. Vor ihrem Auge gibt sich ein universaler „Mensch“ und „Gott“ zu erkennen, der „auf unnennbar geheimnisvolle Weise alle Widersprüche in sich aufhob“, weil ihm „nichts fremd war“ (WN 55) und „jede Äußerung auf dem Gebiete des menschlichen Geistes“ zu ihm hin „gravitierte (...). Und von der überschwänglichen Tragweite jenes schlichttönenden Ausspruches: ,In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen‘ wurde sie wie von unendlichen Schallwellen fortgerissen und durchleuchtet.“ (WN 56)
Mit Emphase wird ein schöpferischer Entwicklungsprozess des Menschen beschworen, dessen „Apotheose“, im Einklang mit der Botschaft Christi, das Endziel der Geschichte ist. Unter christlichem Vorzeichen äußert sich hier ein dynamisches Weltbild von Möglichkeitsräumen, das an Henri Bergsons „Évolution creatrice“ (1907) gemahnt, einen Text, den Annette Kolb zur Vorbereitung eines durch Max Scheler mit dem französischen Philosophen vermittelten Treffens allerdings erst zwei Jahre später liest.
Während dieser Zeit geraten Vertreter dessen, was seitens der kirchlichen Autorität als „Modernismus“ angeprangert wird, in ihr Blickfeld. Es handelt sich dabei um durchaus verschiedene Bestrebungen, theologische Aussagen mit dem Erkenntnisstand der zeitgenössischen Wissenschaft und Philosophie zu verbinden. In „Das Exemplar“ (dessen Handlung im Sommer 1909 in England spielt) kommt das Gespräch einmal auf den „kürzlich erfolgten“ Tod George Tyrrells (am 15. Juli diesen Jahres), wobei die Protagonistin „sich über die unversöhnliche Haltung des Klerus mächtig ereiferte“ (E 124). Der ehemalige Philosophieprofessor war seiner öffentlichen Kritik an Papst Pius’ X. antimodernistischer Enzyklika „Pascendi“ wegen exkommuniziert worden. Auf dem Totenbett erhielt er zwar bedingungsweise die Sterbesakramente, doch wurde ihm auf Betreiben höchster Stellen ein kirchliches Begräbnis verweigert, weil er keinen formellen Widerruf geleistet hatte.15 Annette Kolbs Mariclée empfindet dieses Vorgehen als skandalös.
Über die Bedeutung eines anderen Indizierten für sie hat die Autorin 1911 einen Essay verfasst, „Besuch bei Duchesne“ (den sie bis 1954 zweimal neu, teilweise modifiziert, veröffentlicht). Der hoch angesehene Kirchenhistoriker Louis Duchesne hatte den Exegeten Alfred Loisy beeinflusst, den Kopf der „modernistischen“ Strömung. Nicht nur in seiner „Histoire ancienne de l’Église“ (1906/11), die 1912 auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt wurde, war er selbst der kritischen Methode verpflichtet.
Annette Kolb beschreibt Duchesne als Leitfigur einer wünschenswerten katholischen Avantgarde, die mit Blick auf „den kommenden Umbau“ (F 190) Wege in die Zukunft zu weisen vermag: „Nicht mit den Unbedachten und den Fanatikern, die blindlings ein zerfallendes Gemäuer verteidigen, sondern weil er dessen unerschütterliche Basis ergründete, nur deshalb verharrte er standhaften Fußes inmitten des immer hastigeren Gerölles. Gar manche Werte, als unvergänglich ausgegeben, wird es ja als vergangene vor sich hintreiben.“ Dies aber, die Erkenntnis seiner Verhaftetheit auch an zeitbedingte Denkformen, ist die Voraussetzung, um „sich zu einem Katholizismus zu bekennen, von dem die düstere, unziemliche und abgenützte Wörtlichkeit sich endlich löste!“ (F 195) Annette Kolb fordert eine andere Hermeneutik, den Sinn für Unterscheidungen von geschichtlich Vermitteltem, das keine dauerhafte Geltung beanspruchen kann. Wenn sie sich feindselig gegen das zeitgenössische Reflexionsniveau einmauert, läuft die Kirche Gefahr, zur Ruinenbaumeisterin zu werden.
Die für das Selbstverständnis der Autorin nicht hoch genug einzuschätzende Begegnung (F 204) findet um 1903 in Rom statt. In einem langen Gespräch erläutert Annette Kolb Duchesne ihr Verständnis von der Wahrheit als einer „vieldeutigen Einheit“ des Inkommensurablen, die den Menschen deswegen besonders reizt, weil sie sich ihm permanent entzieht: „eine Einheit, die (...) die vielen Wohnungen auch wirklich in sich birgt, von welchen geschrieben steht“ (F 201 f.). Daher müsse es die Aufgabe einer Auseinandersetzung mit „den Dogmen“ sein, „den spekulativen Gedanken auf das äußerste anzuspornen“ (F 201). Duchesne, der „vielangefeindete“ große Gelehrte mit Hang zum Sarkasmus, gibt sich in dieser Situation zugleich „als ein heiliger Priester“ zu erkennen, der das Anliegen seines Gastes ins Recht setzt (F 204).
Auch nachdem wenige Jahre später „in den klerikalen Blättern jene berühmte Hetzjagd“ auf ihn eingesetzt hatte, „bei welcher er als ein Ketzer behandelt“ wurde (F 205) – worin Annette Kolb übrigens einen Bruch des Pontifikats von Pius X. mit dem seines Vorgängers Leo XIII. sieht –, wendet er sich trotz aller Verbitterung nicht von der Kirche ab. In dieser Situation besucht sie den „großen Katholiken“ (F 209) noch einmal, um ihn ihrer Verbundenheit zu versichern.
„Eine reformkatholische Heilige“
Das Verständnis der Heiligen als „eigentlichen Experten des Christentums“ begründet „ein übergreifendes ,modernistisches‘ Interesse an der Hagiographie“.16 Für zwei weitere Arbeiten Annette Kolbs dürfte dieser Kontext nicht außer Acht zu lassen sein. Ein kurzer Essay über das „Leben der Heiligen Walpurga“ (1911) stellt dabei Verbindungen zwischen dem Glauben und der „modernen“ Denkform eines „auf das verstandesmäßige Sehen verzichtleistenden Schauens“ her. Nach Bergson, auf den hier wahrscheinlich Bezug genommen wird, erschließt sich die Wahrheit nicht durch den Intellekt, sondern allein durch „Intuition“.17
Einen aktualisierenden Akzent anderer Art setzt Annette Kolb gleich zu Beginn des ergänzenden Essays zu ihrer Übersetzung der Briefe der „reformkatholischen Heiligen“18 Caterina von Siena 1906:19 „Denn wir sind heute so weit wie zuvor: Der Protestantismus wird seiner nicht mehr froh, und die Norm der Katholiken, durch zuviel gescheiterte Reformversuche eingeschüchtert, hat den Glauben an eine römisch-katholische Reformation verloren, jene Reformation, die Catharina nicht müde wird zu verkünden (...). Und wenn heute unsere katholischen Gesellschaften, Vereine usw. ihre fortschrittlichen Bestrebungen verheißen, so belächeln wir im voraus die kümmerlichen Resultate, die sie uns bringen werden. Da dringt denn zu guter Stunde die kühne Sprache Catharinas wie ein frischer Luftzug in eine verbrauchte Atmosphäre.“ (F 111)
Geheimer Mittelpunkt des Essays ist der Gedanke einer evolutionären Perspektive des Christentums, das sich erst allmählich zu seiner vollen Gestalt entfalte. So erklärt Annette Kolb die „extremen“ Selbstkasteiungen der Heiligen als Solidarität mit dem trauernden, nicht dem verklärten Christus angesichts einer Zeit der allgegenwärtigen „Leiden“ und „Grausamkeiten“ in Gesellschaft und Kirche (F 116 f.), „in welcher die Gemüter vom Geist des Christentums noch so wenig umbildet waren“ (F 118). Die eigene Epoche deutet sie als eine Inkubationsphase, einen Zustand jenseits dieser „Greuel“, aber noch nicht unter den „apollinischen Klängen“ des „rätselvollen Auferstehungstages“: „Es ist (...), als träte nunmehr die Welt in das Zeichen der Grablegung, und als dämmerte unsere Zeit, oder die nächstkommende, oder die kommenden Jahrhunderte dem beruhigten, ahnungsvollen Zauber der Kartage entgegen.“ (F 119)
Für Annette Kolb nimmt Caterinas „Mystik“ von Gott ihren Ausgang, „deren Ziel“ sei jedoch „die Menschheit“ (F 128). In diesem Zusammenhang wird das Jesuswort aus Joh 10, 34 von der Autorin mit einer besonderen anthropologisch-evolutionären Bedeutung aufgeladen: „Ihr seid Götter!“ (F 129) Noch anderswo kehrt es in ihren Arbeiten wieder. Sie sieht darin eine über den Menschen und seine individuellen wie geschichtlichen Entwicklungsmöglichkeiten kraft seines Ursprungs und der „Anrede“20 Gottes ausgesprochene Verheißung.
Einen weiteren Anknüpfungspunkt für die Gegenwart arbeitet Annette Kolb bei Caterina heraus: Sie „wäre uns heute so stumm wie viele ihrer heiligen Genossen, die im Kalender stehen, wäre sie nicht als Frau so unvergänglich – modern bis in die Fingerspitzen –, als ,Frauenrechtlerin‘ vielleicht die einzige, die ganz unserem Geschmack entspricht“, was sich etwa darin zeige, „wie sie (...) mit aller Konvention bricht“ (F 129). In der Theologie werden solche Aspekte bekanntlich erst in ferner Zukunft aufgenommen.
Kritik des Krieges
Ein Jahrzehnt später beruft sich Annette Kolb auf eine andere Charakterisierung Caterinas aus dem Essay. Ihre „Briefe einer Deutsch-Französin“ (1916) verweisen auf die Aktualität der dezidiert politischen Heiligen als „Friedensstifterin“ (F 120). Selbst eine „Arbeiterin im Weinberg des Herrn“, wie man sie, analog zu ihrer Bezeichnung für Alfred H. Fried, den Gründer der Zeitschrift „Friedenswarte“, bezeichnen könnte, der „eigentlichen Seele der pazifistischen Bewegung in Zentraleuropa“ (F 162 f.), weigert sich Annette Kolb nicht nur, an der allgemeinen „geistigen Mobilmachung“21 mitzutun, sondern engagiert sich gegen deren Ziele und die Realitäten des Krieges.
Erneut greift sie hier den Fortschrittsgedanken auf, hinter den die Menschheit nun aber zurückfällt. Angesichts ihres Entwicklungsstands sei der Krieg eigentlich ein Relikt „aus der Rumpelkammer“ der Gattung (SB 27). Unter Verweis auf die kulturschöpferischen Kräfte des Menschen widerspricht Annette Kolb einem Biologismus, der Kriege als naturgegeben, ja -notwendig bejaht. Auch wenn im Zeichen des Christentums selbst „die wüstesten Greuel in der Welt entbrannt“ seien, sieht sie in diesem die große Gegenkraft zum Krieg und geißelt die Diskrepanz zwischen Rhetorik und Praxis bei den europäischen Mächten. Annette Kolb fordert die Regierungen auf, sie mögen „eine Doktrin, von welcher nicht die allerleiseste Notiz genommen wird, nicht mit so fluchwürdiger Stirn der Form nach noch aufrecht halten“.22 Allein das auf Vermittlung ausgerichtete Handeln Papst Benedikts XV., der sich zwischen den Fronten erfolglos um Friedensinitiativen bemüht, habe „das Recht auf seiner Seite“ (DF 96).
Trotz des Atavismus, den die „Kriegspsychose“ (SP 110) darstellt, hält Annette Kolb am Entwicklungsgedanken fest, dessen Ziel die Mitte des Christentums bezeichne. Nur ist der (für sie bezeichnenderweise „nach vielen Dezennien eines ausschließlichen Männerregiments“ ausgebrochene [DF 88]) Krieg ein Zeichen dafür, dass „die Menschheit“ zu „langsam und in so verzweifelt weiten Kurven um dies Gestirn“ evoluiere: „Aber der Gewalt des Christentums tut die menschliche Hinfälligkeit keinen Abbruch“ (DF 85). Bisher sei die Menschheit für die in ihm beschlossene Idee noch nicht reif gewesen. Damit es seine Frieden stiftende Kraft entfalten könne, seien – zumal in Deutschland – erhebliche Bildungsanstrengungen erforderlich, Nachhilfe in Sachen Demokratie besonders: „die Deutschen nämlich seien „die politisch Ungeschulten, die Unpolitischen par excellence“ (DF 21).
Für die Trennung von Staat und Kirche
Um das Selbstverständnis der Kirche und ihr Verhältnis zur Demokratie geht es wesentlich in Annette Kolbs Stellungnahmen zum französischen Laizismus. „Daphne Herbst“ enthält einen Rückblick auf die Zeit seiner Implementierung 1905, in dem „peinlichste Auftritte“ und „Gewaltmaßregeln“ nicht verschwiegen werden, von denen etwa „die Vertreibung der lehrenden Ordensbrüder und Schwestern“ begleitet war (D 29). Übertönt werden sie indes durch wenig schmeichelhafte Einblicke in das Milieu eines aristokratischen Katholizismus mit seinem Kampf gegen die infolge der Ideen von liberté, egalité und fraternité entstandenen „Verirrungen“. Verbindungslinien zwischen autoritär verfasstem Staat und autoritär verfasster Kirche scheinen auf. Politisch und religiös sind die frommen Legitimisten rückwärtsgewandt: „Der Marquis witterte Morgenluft, Restauration“ (D 31), heißt es einmal, und an anderer Stelle ist vom „Fanatismus“ in diesen Kreisen die Rede (D 31).
Das Thema der Trennung von Kirche und Staat in Frankreich spielt eine wichtige Rolle auch im „Versuch über Briand“, Annette Kolbs knapp 25 Jahre später erschienenem Buch über den damals zuständigen Minister. Selbst schon als Heranwachsende Anhängerin von Lamennais’ frühen Plädoyers für ein Miteinander von Christentum und moderner Freiheitsgeschichte, tadelt sie hier offen jene Mentalitäten, bei denen es „zum guten Ton, vorwiegend auch zur religiösen Erziehung“, gehört habe, „daß man antirepublikanisch war“.23 Politische Prediger seien für die Konfrontation in hohem Maße mit verantwortlich: „Also ein wenig wie bei uns, nur daß in Frankreich auch der gesamte Klerus geschlossen die Regierung befehdete und ihr täglich Waffen in die Hand lieferte, um einer unleidlichen Situation ein Ende zu machen.“ (BR 36)
Aristide Briand habe seinerzeit mit Recht „das hohe moralische Interesse“ hervorgehoben, „welches für die katholische Kirche selbst in einer Trennung vom Staate bestand – und große Katholiken wie Montalembert hatten sie schon in den vierziger Jahren befürwortet“ (BR 33). Zugleich lobt Annette Kolb ihn seiner Kunst der Vermittlung wegen, der es gelungen sei, dem von dieser ausgehenden „Bruch mit der Kurie die letzte Schroffheit zu nehmen“ (BR 37).
Eine machtgeschützte, gesellschaftlich bevorzugte oder auch nur vom Staat geförderte Kirche, erst recht eine, die sich durch eigene Machtinteressen kompromittiert, hält Annette Kolb deren spiritueller Gestalt für abträglich. Durch den Verlauf der Geschichte fühlt sie sich bis ins hohe Alter hinein bestätigt. Tatsächlich habe „das religiöse Leben in Frankreich (...) an Ernst, Geist und innerem Wachstum gewonnen, seitdem es die Rolle des öffentlichen Angreifers einbüßte, seinen Anteil an den Geschäften des Staates verlor“ (B 38). Dem Vorzug, dass „der Klerus (...) dort“ nun „geziemendere Sorgen als die der Tagespolitik“ habe, steht freilich die vielfältige Störung der Messen durch die Kollekten gegenüber, gegen die sie die Erhebung einer Art von „Eintrittsgeldern“ vorschlägt.24
Nationalsozialismus und Nachkriegszeit
Nicht nur ihre freiheitlichen Ansichten sind es, die Annette Kolb schon während der Endphase der Weimarer Republik in Widerspruch zur Ideologie der Nazis bringen. Unter der Überschrift „Analphabeten“ lautet eine sarkastische Notiz ihres „Beschwerdebuchs“ (1932): „Im ,Völkischen Beobachter‘ steht, daß die Evangelien kein Wort enthalten, das im pazifistischen Sinne auszulegen sei.“ (B 120)25 Mit den faschistischen Strömungen sieht sie eine gegenchristliche Welt unter dem Vorzeichen den Schwächeren vorenthaltener Gerechtigkeit aufsteigen. Auch den Bolschewisten gilt ihre Kritik. Beim Sozialismus hingegen nimmt sie „ein in die Praxis gesetztes Agens des Christentums, ohne dessen Theorie“, wahr (B 120). Später spitzt sie diesen Satz selbstkritisch zu: „Hätten wir seiner bedurft, wären wir minder schlechte Christen gewesen?“ (SB 144)
Die Haltung des Heiligen Stuhls der nationalsozialistischen Regierung gegenüber ist ihr ein Ärgernis: „Viele Leute sind aus der Kirche heraus wegen der Haltung des Centrums“, schreibt sie am 27. April 1933 aus Basel an René Schickele: „Ermächtigungsgesetz. Die Priester sollen vielfach dagegen gewesen sein, diesem infamen Papst hätten sie nicht gehorchen sollen.“ (BW 55) Aufgrund der Verhandlungsbereitschaft Pius’ XI. mit den Nationalsozialisten hatten die deutschen Bischöfe in einer Erklärung vom 28. März 1933 frühere Warnungen vor der NSDAP „nicht mehr als notwendig betrachtet“.26 Am 16. August des gleichen Jahres kehrt im Briefwechsel mit dem Freund die Wendung von „diesem entsetzlichen Papst“ wieder (BW 71): Pius XI. hatte am 20. Juli mit Deutschland das so genannte Reichskonkordat geschlossen und damit zum Prestigegewinn wie zur Stabilisierung der NS-Diktatur beigetragen.
Nach dem Krieg tritt Annette Kolb gegen Tendenzen zur Verdrängung von Schuld und Verantwortung für die nationalsozialistische Herrschaft in Deutschland ein. Ganz in ihrem Sinne sind Reinhold Schneiders Aufrufe zur radikalen Gewissenserforschung, die allerdings auf taube Ohren stoßen: Dieser halte das „Unglück“ seiner Landsleute „mitnichten durch ein Hinwegsehen über dessen Ursachen [für] gelindert, oder wenn sie der Zeit (die nicht alle Wunden heilt) durch Vergessenheit vorbeugen wollten. Denn Vergessenheit wäre kein Weg“ (SB 127). Neben Charles de Gaulle erscheint ihr Konrad Adenauer, den sie geradezu hymnisch rühmt, als Bürge für eine europäische Friedensordnung. Gegenläufig dazu erscheint der alten Dame die Welt der 60er-Jahre im Zeichen funktionalistischer Modernisierungsprozesse zunehmend als „verhäßlicht“ und „seelisch verarmt“ (Z 204): „Wie nie zuvor sehen wir die Anbetung des Goldenen Kalbes so im vollen Schwung“ (Z 202). Verlust des Sinns für Schönheit aber ist ein Zeichen für den Verlust an Sinn überhaupt.
Verteidigung der Messe
In ihren späten Jahren unterhielt Annette Kolb engen Kontakt mit einigen profilierten Geistlichen wie dem Dominikaner Pierre Jean de Menasce, einem gelehrten Orientalisten, für den das Verhältnis des Christentums zu den Weltreligionen im Zentrum seines Interesses stand, oder dem „Sozialapostel Münchens“, Willibrod Braunmiller OSB, der für ein konfessionsübergreifendes „Tatchristentum“ eintrat und in der „Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit“ tätig war.27 Der namhafteste, mit dem sie sich trifft und korrespondiert, ist (seit 1953) Hans Urs von Balthasar, der sie in seinem Lebensrückblick von 1965 „meine verehrte Freundin“ nennt. Als „großartig und prachtvoll“ rühmt er ihre deutsche Version von Valéry Larbauds „Sankt Hieronymus. Schutzpatron der Übersetzer“.28 Umgekehrt schenkt sie ihm ein Buch von Duchesne und interessiert sich für Balthasars Aufsatz über die amtskirchlicherseits keineswegs wohlgelittene Spiritualität Pierre Teilhard de Chardins mit ihrem Ineinander von Evolution und christlichem Glauben.
Nicht erst im Alter ist ihr die Form des Gottesdienstes wichtig. Am deutlichsten erhellt dies aus den Schilderungen liturgischer Eindrücke, von denen der Roman „Daphne Herbst“ durchsetzt ist. In einem Aufsatz von 1954 („Letztes Albumblatt. Gefährdung der Messe“) erinnert Annette Kolb, gegen das, was sie als deren Verunstaltung empfindet, vehement an den kulturellen und geistlichen Wert des überkommenen Messritus. Hässliche Kirchen und eine unschön verrichtete Liturgie erscheinen schon Daphne Herbst „wie eitel Ketzerei“ (D 146). Daran hat sich für Annette Kolb auch ein Vierteljahrhundert später nichts geändert: Jetzt benutzt sie das Wort „Häresie“ (SB 152).
In ihrem Mozart-Buch spricht sie einmal von der „abgründigen Handlung der Messe“ (M 305 f. ). Diese Feier gilt es mit dem höchsten Anspruch zu gestalten. Ein „zweitausendjähriger Kult“ (SB 163) schmilzt für sie „Dekorum“, „Ästhetik“ und „Protokoll“ ineinander (SB 158). Zwischen äußerer Gestalt und innerer Wahrheit besteht eine Wechselbeziehung. Mit kunstseligem Schwelgen hat dies nicht unbedingt zu tun. Annette Kolb ist eine Freundin der Stillen Messe (mit ihren zurückgenommenen Zeremonien) ebenso wie der orchestralen. Was sie beanstandet, ist mangelndes Stilbewusstsein, Zerreden des Mysteriums oder Distanzlosigkeit der Gläubigen ihm gegenüber.
„Sammlung“ und „Ergriffenheit“ ist der Habitus, in dem der Priester in der Münchner Nepomukskirche das „Messopfer“ feiert, an dem Daphne Herbst heimlich regelmäßig teilnimmt. (D 108). Bei der Feier der Kartage in Beuron schlägt eine nachgerade Entleerung des Zelebranten von jeglicher Subjektivität sie in ihren Bann, seine „Ent-Persönlichung“ (D 165) und „Weltabgewandtheit“ (D 151), von der auch die Liturgie selbst geprägt ist. Die „ewig selben Worte“ werden dort wiederholt: „Reichten sie vielleicht am weitesten, stürmten sie am ehesten die Himmel?“ (D 148 f.) Jedenfalls darf selbst „der Beschauer glauben, auch er fasse die Wahrheit bei einer ihrer Enden“ (D 146).
Entsprechend hält Annette Kolb nur eine „unwandelbar“ gewordene und „dem Alltag entzogene Sprache“ (SB 159) dem sakralen Geschehen für gemäß. Das zeremonielle Latein, das „sich auf kein ich einläßt“, ist ein Medium der „Distanz“, ohne individuelle Variante, „ohne Inbrunst“: eine Diktion, die sich „im selben Tonfall durch alle Zeiten hin mit dem Ungeheuerlichen deckt, was sie besagt“ – und deswegen „so nah der inneren Versenkung, ja der Verzückung gebaut“ (M 305). Gerade die „Objektivität“ des Ritus ist es, welche ihr Gegenteil ermöglicht: die für Annete Kolb so bedeutsame Weite der emphatischen Erfahrung eines Nicht-Wörtlichen, die Schwelle zur Unendlichkeit „geistiger Wonnen“ (D 108). Ein Weiteres kommt hinzu.
„Alle Künste“, heißt es schon im „Duchesne“-Essay, „strebten seit vielen Tausenden von Jahren an den Schleiern unseres Kultes zu weben“ (F 202). Angesichts des „Niveaus“ der Beuroner Liturgie „nach den ältesten Gebräuchen“ kommt sich Daphne Herbst „ein wenig (...) vor wie in Bayreuth.“ (D 145 f.) Sie spricht von einer „wundervollen Regie (...) sublimster Ordnung“ (D 147). Mehrfach, teilweise sogar wörtlich, wird bei Annette Kolb (für die Richard Wagner ein zentrales Bildungserlebnis war) eine Analogie zwischen dem Messritus und der Formel vom „Kunstwerk der Zukunft“ hergestellt (D 33), wo durch „das Aufgebot aller Künste“ (SB 168, D 146) die Totalität menschlichen Apperzeptionsvermögens angesprochen, ja transzendiert werden soll. Damit ist er reales Zeichen einer anderen Wirklichkeit: „Denn ohne Mystik, ohne sie ist dies nur eine abgeblühte winterliche Welt.“ (SB 169)
Abseitig ist Annette Kolbs Assoziation keineswegs. Ausgehend von der Gralsfeier im „Parsifal“, als dem „Höhepunkt“ von Wagners „Gesamtkunstwerk“, war sie schon vier Jahre, bevor sie erstmals bei der Autorin zutage tritt, in einer theologischen Fachzeitschrift aufgegriffen worden: Wo, wurde dort gefragt, lernte Wagner das Ideal des Zusammenwirkens aller Künste kennen? „In katholischen Kirchen, im katholischen Kult“, wie sich denn auch im Begriff „,Gesamtkunstwerk‘ (...) das Kultusideal der katholischen Kirche“ subsumieren lasse, das „in der feierlichen Messe“ zum Ausdruck komme.29 Deswegen habe, so Annette Kolb, diese immer „große Anziehungskraft auch auf Andersgläubige“ gehabt (SB 163).
Was den Protestantismus betrifft, erinnert Annette Kolb in ihrem Text gleich eingangs daran: „Es ist Zeit, alle Feindseligkeiten abzuwerfen, sind wir doch alle Christen.“ (SB 152) Und zur Verteidigung der „Unantastbarkeit der alten Gebräuche“ (SB 159) beruft sie sich nicht etwa auf das Tridentinum, sondern auf Duchesnes, des „Modernisten“, „Origines du Culte Chrétien“ (1902) und „L’Eglise au Ve Siècle“ (1925 [SB 156]). Überhaupt ist das „Albumblatt“ der 84-Jährigen, stärker als ihre früheren Arbeiten, durch ein „impressionistisches“ Vorgehen gekennzeichnet (SB 139), das in unvermittelten Übergängen Verschiedenartiges miteinander verknüpft.
So erscheint ihr die Lesung der Messe an „einem ganz nah an die Chorschranke gerückten Tisch (...) angesichts der Versammelten“ (SB 156) einmal als „ein schwerer Verstoß“ (SB 157), weil er die „Würde“ des zelebrierenden Priesters, seine „Distanz zur (...) Menge“ (SB 156) und seine „innere Sammlung“ zu beeinträchtigen vermag (SB 157). Als „zweiten Pol“ beschreibt sie jedoch wenige Seiten später eine Messe in der Pariser Saint-Séverin-Kirche, wo „der Menge zugewandt“ zelebriert wird, ohne dass ein „Entgegenkommen“, gar „Herablassung dem Volke“ gegenüber stattfindet, das ja erhoben werden wolle. Diese Menge – „vorwiegend Proletariat“ übrigens – ist ihrerseits „geschult“ und „dem Alltag entzogen“. Als „eine lebendige Saint Chapelle (...) reagiert sie mit der Geschlossenheit eines Orchesters“ (SB 164 f.). Vorbildliche Form besteht hier also in der aktiven Mitfeier. Mit einer tendenziell Hierarchie-zentrierten Ekklesiologie und Gesellschaftslehre hat Annette Kolbs monitum zugunsten des gewachsenen Ritus jedenfalls nichts zu tun. Immer geht es ihr um eine Haltung dem Mysterium gegenüber, das sich in der Messe bekundet.
Tradition und Erneuerung bleiben dabei aufeinander bezogen. Wahrhaft schlimm nämlich ist „die Trennung zwischen Kirche und Kunst“ (SB 165). Kitsch, wie er die Gotteshäuser seit dem 19. Jahrhundert verunstaltet habe, sei der größte Feind des Religiösen. So setzt sie Hoffnungen in Strawinskys 1948 uraufgeführte Messe und empfiehlt Marie-Alain Couturier OP, den (ihr auch persönlich bekannten) Pionier der Einbeziehung moderner Kunst in die Kirche, der die Sakralbauten von Le Corbusier ermöglichte und bei seinen Projekten herausragende Künstler wie Léger, Braque, Rouault, Chagall und andere zur Mitwirkung gewann, als Vorbild für die „Notwendigkeit eines neuen Baustils“ (SB 160) – wobei übrigens just das von Annette Kolb so gerühmte Beispiel der Kapelle in Vence dem Heiligen Offizium nicht unbedingt gefiel.30
Im gleichen Kontext wird plötzlich noch ein anderer Ordensmann gepriesen, der Protagonist eines sozialen Katholizismus ist: Abbé Pierre, Gründer der Organisation „Emmaus“, besonders seiner Hilfsappelle für die Obdachlosen im Kältewinter 1953/54 wegen, als viele Menschen starben. Eine von Annette Kolbs Messfrömmigkeit offensichtlich untrennbare Dimension scheint hier auf.
Anfang August 1960 nimmt die Autorin am Eucharistischen Weltkongress in München teil. Auch hier macht sich ein spätzeitliches Bewusstsein geltend: „Wird vielleicht morgen das Ereignis vertuscht und vergessen werden? Über alle Wirrsal hinaus war es das Präludium einer besseren, schöneren und anderen Welt. War es der Inbegriff jener Abschiedsworte: ,Ich komme bald‘?“ (Z 206) Im Zusammenhang mit diesem Vers aus dem Buch der Offenbarung des Johannes im Neuen Testament heißt es an anderer Stelle: „Wir glauben, wir halten unseren Glauben aufrecht, er ist nicht leicht, wir geben ihn nicht preis.“31