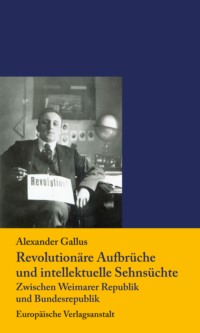Kitabı oku: «Revolutionäre Aufbrüche und intellektuelle Sehnsüchte», sayfa 2
Revolution! Revolution?
1.
Systemwechsel und Subjektivierung
Wiederentdeckung der Revolution von 1918/19 als politische Transformations- und Erfahrungsgeschichte
I. Einleitung
Wenn Historiker streiten, gilt nicht selten ein abgewandeltes Clausewitz-Wort: nämlich dass Geschichte dann als die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln erscheint. Auch und gerade die deutsche Revolution von 1918/19 war ein herausgehobenes Streitthema einer zankenden Historikerzunft während des Kalten Krieges. Es kam dabei zur Vermengung von geschichtswissenschaftlichen mit geschichtspolitischen, häufig den Geist der Zeit atmenden Argumenten. Von den einst heftig ausgefochtenen Debatten über ein Entweder-oder zwischen freiheitlicher Demokratie und Bolschewismus, über verpasste Chancen und nicht ausgeschöpfte Handlungsoptionen, über Dritte Wege und ein höheres Maß an Demokratisierung ist allerdings schon seit geraumer Zeit kaum noch etwas zu spüren. Der Forschungsstand präsentierte sich ab den 1980er Jahren als festgefahren, die ausgebliebene öffentliche Würdigung bot einigen Anlass, von einer „vergessenen Revolution“ zu sprechen.1 Überhaupt hält die 1918er-Revolution gelegentlich als Beleg dafür her, dass den Deutschen Revolutionen grundsätzlich nicht liegen und sie ihnen stets misslingen würden. Fünfzig Jahre nach der Novemberrevolution diagnostizierte Joachim C. Fest im Spiegel ein entsprechendes „Unvermögen“ der Deutschen, das am Beispiel des Umbruchs von 1918/19 besonders deutlich zum Ausdruck gekommen sei. Am Ende „proklamierte die Weimarer Verfassung eine Revolution“, urteilte Fest vernichtend, „die niemals stattgefunden hatte“.2
In jüngerer Zeit deutet sich indes ein Abschied von der erinnerungskulturellen wie historiografischen Revolutionslethargie an. Das Hundertjahres-Jubiläum 2018/19 trug dazu ebenso bei wie ein wieder gewachsenes Interesse an Krisen-, Umbruchs- und Revolutionsphasen in einer Zeit neuer Unsicherheiten.3 Hinzu kommt seit einigen Jahren ein zunehmend ergebnisoffener Blick auf die Weimarer Republik, der es ermöglicht, Interpretationen zur Novemberrevolution von normativen und quasi-teleologischen Einfärbungen zu befreien. Dies korrespondiert mit einer Sichtweise auf die gesamte Zwischenkriegszeit als Periode, die sich mithilfe der räumlichen Metapher eines „Laboratoriums“ für die Erprobung politischgesellschaftlicher Ordnungsmodelle gut einfassen lässt. Schon Tomáš Masaryk kam das Europa nach 1918 wie ein „auf dem großen Friedhof des Weltkriegs errichtetes Laboratorium“ vor.4 Ein krisengeschüttelter Liberalismus forderte ebenso wie erodierende monarchische Legitimationsmuster zum Experimentieren mit neuen Varianten politischer Repräsentation heraus, zumal vor dem Hintergrund des Spannungsfelds von Imperium und Nation am Ende des Ersten Weltkriegs.5 Dies beförderte nicht zuletzt gewaltgestützte Dynamiken von Revolution und Gegenrevolution. Fast kurios mutet dabei an, dass nicht nur die Anhänger des Kommunismus einerseits und die Verfechter westlicher Zivilisation wie Demokratie andererseits transnationale Ansprüche hegten und grenzüberschreitende Netzwerke pflegten, sondern auch radikal-nationalistische Paramilitärs.6
Ich deute diese Perspektiven nur an, um mich doch auf die Vorgänge im Herzen des Deutschen Reiches zu konzentrieren. Wie vollzog sich dort der Wandel im Einzelnen? Welche Schritte der Transition lassen sich nachvollziehen, wie sind ereignisgeschichtliche Abläufe behutsam (ohne Übernahme des berühmt-berüchtigten Politologenjargons) mit strukturellen Überlegungen zu Ursachen und Verlaufsformen des politischen Systemwechsels zu verbinden.7 Dieser Zugang ist gleichsam als Ergänzung oder auch Begrenzung des umstrittenen, regelmäßig politisch aufgeladenen Begriffs der Revolution zu verstehen. Er konzentriert sich auf Transformationen zwischen verschiedenen Staatsformen, erörtert insbesondere die Ursachen für das Ende des alten Regimes, die Übergänge zum neuen und dessen Konsolidierung.8 Eine so zugeschnittene Analyse trägt zur Systematisierung, Entnormativierung und Versachlichung bei und verabschiedet sich von einem maximalistischen Revolutionsbegriff. Ein solcher nämlich beansprucht einen weit über die staatliche und politische Ordnung hinausgehenden, fast „totalen“ Geltungsanspruch, der Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur umschließt und häufig mit dem Ziel eines utopisch anmutenden Endzustands verkoppelt ist.9 Neben dem Systemwechsel-Zugang will ich einen weiteren Weg zur Wiederbelebung der Revolution im Zeichen der Erfahrungsgeschichte, die den subjektiven Wahrnehmungswelten der Zeitgenossen zu ihrem Recht verhilft, aufzeigen und hier und da beispielhaft in die Darstellung einbinden. Wie im Falle des Systemwechsels ist dies kein gänzlich neuer Weg, aber seine Erkundung verdient eine Intensivierung, gerade weil durch eine konsequente Historisierung – so paradox es zunächst klingen mag – eine Aktualisierung gelingen kann, ohne bloß gegenwärtige Problemkonstellationen in die Geschichte zurückzuprojizieren.10 Die zwei Grundgedanken des Beitrags lassen sich also mit den beiden Schlagworten „Systemwechsel“ und „Subjektivierung“ knapp einfangen.
II. Ursachen und Verlauf des langen Novembers der Revolution11
Auch wenn der Chefredakteur des liberalen Berliner Tageblatts Theodor Wolff am 10. November 1918 euphorisiert von der „größten aller Revolutionen“ sprach und diese mit einem plötzlichen „Sturmwind“ verglich, so greift diese Sicht eines spontanen Umbruchs als Produkt der Kriegsniederlage doch zu kurz.12 Vielmehr reifte die Umwälzung schon „lange im Schoße der wilhelminischen Gesellschaft“ heran, wie es Volker Ullrich einmal formulierte, und blieb ihr verhaftet.13
Ein schleichender Legitimitätsverfall der monarchischen Ordnung zeigte sich an verschiedenen Symptomen, so an der Verlagerung der Entscheidungsgewalt vom Monarchen auf die Militärspitze im Verlauf des Weltkriegs und in Form einer Systemkrise angesichts der gesteigerten Kriegsmüdigkeit, der Hungerrevolten und Massenproteste im Januar 1918. Arthur Rosenberg erkannte darin bereits eine Generalprobe für die Novemberrevolution.14 Ungeachtet solcher Vorboten wirkte das Eingeständnis der Niederlage durch die Oberste Heeresleitung Ende September 1918 wie ein Schock auf Öffentlichkeit und Politik. Schließlich hatte nicht zuletzt der Friedensschluss von Brest-Litowsk mit Sowjetrussland im Frühjahr 1918 nochmals Hoffnungen auf einen deutschen Sieg genährt.
Eine erste, von „oben“ gelenkte Transformationsphase begann im Spätsommer 1918, als die Oberste Heeresleitung einen Waffenstillstand gemäß den „Vierzehn Punkten“ des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson forderte, wie dieser sie im Januar 1918 formuliert hatte.15 Die Entente-Mächte waren zu diesem Zeitpunkt allerdings zu einem solchen Entgegenkommen nicht mehr bereit und boten einen Waffenstillstand an, der einer umfassenden Kapitulation gleichkommen sollte. Außerdem wollten sie nicht länger mit Vertretern des deutschen Militärs verhandeln, verlangten vielmehr die Schaffung einer demokratisch legitimierten Regierung. Insofern wirkte Wilsons Notenoffensive auf die Parlamentarisierung des Reiches ein, ohne dass diese Initiative sogleich zu einer „Revolution von außen“ zu stilisieren ist. Weitere Aspekte sind in Betracht zu ziehen.
So befürwortete erstens die militärische Führung des Reiches, wenn auch nicht ohne den Hintergedanken der bald ins Leben gerufenen „Dolchstoßthese“16, eine Verfassungsrevision in Richtung Parlamentarismus; zweitens plädierten insbesondere die Mehrheitsfraktionen im Interfraktionellen Ausschuss des Reichstags – Sozialdemokraten, die liberale Fortschrittliche Volkspartei und das katholische Zentrum – für eine solche Entwicklung, auch um das „Chaos“ einer revolutionären Massenbewegung von unten zu verhindern. Die neu gebildete Regierung unter Reichskanzler Prinz Max von Baden, der auch Vertreter der Sozialdemokratie, des Zentrums und der Liberalen angehörten, brachte vor dem Hintergrund des durch den Notenwechsel Wilsons ständig gesteigerten Drucks die Verfassungsreform auf den Weg.17 Am 28. Oktober traten die sogenannten Oktoberreformen in Kraft, die den Übergang von der konstitutionellen zur parlamentarischen Monarchie markierten.
Wenngleich die Novemberrevolution im Lichte der Oktoberreformen in verfassungsformaler Hinsicht gleichsam als überflüssig erscheint, so war sie dies politisch keinesfalls. Dem Staatsformen-Wechsel vom Oktober fehlte in der öffentlichen Wahrnehmung durch die Zeitgenossen der Zäsurcharakter – und im juristischen Sinne war dies auch noch keine Revolution, weil sich der Wandel bis hierhin legal im Rahmen der Bismarck’schen Reichsverfassung vollzogen hatte. Vor allem aber war angesichts der materiellen Nöte, einer grassierenden Grippe-Epidemie18 und der Verarbeitung der Niederlage wenig Raum für eine theoretisch anmutende Diskussion über politische Ordnungsvorstellungen. Die öffentliche Stimmung war nicht dazu angetan, sich mit einer papiernen Verfassungsreform zufrieden zu geben. Ihr fehlte der Eros des Auf- und Durchbruchs. Oder anders ausgedrückt: Diesem Anfang wohnte noch kein Zauber inne. Auch deshalb mag man hinter Arthur Rosenbergs These von der „wunderlichsten aller Revolutionen“, bei der die Massen – im Angesicht der Oktoberreformen – wenig später „eigentlich gegen sich selbst“ rebelliert hätten, ein Fragezeichen setzen.19
Die ebenfalls Ende Oktober einsetzende „Revolution von unten“ drängte auf die Abdankung des Kaisers als stärkstes Symbol für das Ende der alten Ordnung. So diffus die „Programmatik“ der neu ins Leben gerufenen Arbeiter- und Soldatenräte, die in jener Zeit übrigens in ihrer Mehrheit überaus friedfertig, diszipliniert und in engem Verbund mit der Sozialdemokratie agierten, auch war, so zielten sie doch auf die dauerhafte Überwindung des Ancien Régimes. Die Bildung von „Räten“ war der äußeren Form nach durch die Revolution in Russland motiviert. Diese Nachahmung war in den meisten Fällen jedoch lediglich ein von spontaner Euphorie getragener Wunsch, der keineswegs auf die Übernahme des Bolschewismus zielte.20 Räte zu gründen schien einer allgemeinen Mode zu entsprechen. Mit spöttischem Unterton notierte der Heidelberger Mediävist Karl Hampe am 14. November 1918 in seinem Tagebuch: „Man überbietet sich allenthalben in Gründungen von allen möglichen Räten: Bauernräte, Bürgerräte, geistige Räte, Kunsträte, Theaterräte. Die deutsche Vereinsmeierei ist in die Arme der Revolution geflüchtet!“21
Der Vorwurf, „russische Verhältnisse“ schaffen zu wollen, stand gleichwohl im Raum. Auch deshalb hob beispielsweise der Vorsitzende des Hamburger Arbeiter- und Soldatenrates Heinrich Laufenberg mehrfach hervor, wie sehr sich die deutsche von der russischen Situation unterschied. Er verband ein vages Rätewollen – dabei selbst in klarer Distanzierung zur Mehrheitssozialdemokratie – ausdrücklich mit der Ablehnung der „politischen Methode der Bolschewisten“, die in seinen Augen bisweilen terroristische Züge annehmen konnte. Solche „extremste Gruppen“, von denen er sprach und wie sie sich zum Teil innerhalb der deutschen sozialistischen Arbeiterschaft fanden, suchte er auf Distanz zu halten.22
Begonnen hatte die Aufstandsbewegung in den ersten Novembertagen als Militärstreik und Matrosenrevolte in Wilhelmshaven, dann bald verstärkt und durchdringend in Kiel. Harry Graf Kessler notierte am 7. November über die „Physiognomie der Revolution“ in seinem Tagebuch: „allmähliche Inbesitznahme, Ölfleck, durch die meuternden Matrosen von der Küste aus“.23 Das Bild, das diese oder eine ähnliche Metaphernsprache zeichnet, trifft es ganz gut. Und doch verweist es auf eine Frage, die von der Forschung weiter zu bearbeiten ist, nämlich wie sich von einem lokalen Aufstand ausgehend innerhalb kurzer Zeit eine weit ausgreifende, überwiegend friedlich sich darbietende Revolutionsdynamik entfalten konnte. Das betrifft Fragen nach der noch wenig ausgeschöpften Kommunikations- und Mediengeschichte der Revolution ebenso wie nach dem Akteur „der Massen“ an sich. Die Mobilisierung der Massen und die damit verbundenen Partizipationsansprüche harren noch der weiteren Untersuchung.24
Angeregt von den Ereignissen der Münchner Räteherrschaft veröffentlichte Ernst Toller sein Dramenwerk Masse Mensch über den Charakter der „sozialen Revolution des 20. Jahrhunderts“ und gab diesem Akteur damit bereits einen zeitgenössischen, ebenso politischen wie kunstvollen Ausdruck.25 Am 7. November 1918 wurden in Bayern Regierung wie Monarchie gestürzt, zugleich rief Kurt Eisner die Republik („Freistaat“) aus.26 Am 9. November schließlich erfasste die Revolution Berlin: Prinz Max machte an jenem Tag komprimierter Geschichte – ohne offizielle Autorisierung und wenige Stunden vor dem Entschluss Wilhelms II. – die Abdankungserklärung des Kaisers sowie des Kronprinzen öffentlich. Das Amt des Reichskanzlers übertrug er dem Führer der Mehrheitssozialdemokraten Friedrich Ebert. Von den Sozialdemokraten war im Vorfeld der Druck auf Kanzler und Kaiser, die Abdankung zu vollziehen, in ultimativer Weise erhöht worden. Auf Anraten der Obersten Heeresleitung flüchtete Wilhelm am 10. November nach Holland, unterzeichnete die Thronentsagung aber erst am 28. November.
Diesem formalen Vorgang kam keine entscheidende Bedeutung mehr zu, da die Durchbrechung der Normenkette in staatsrechtlicher Sicht bis dahin schon längst im Gange war. Spätestens die unmittelbare Übertragung der Reichskanzlerschaft von Prinz Max auf Friedrich Ebert stellte einen eklatanten Bruch mit der Reichsverfassung von 1871 dar. Diese „Diskontinuität der Rechtsordnung“, das betonte der Rechtshistoriker Horst Dreier, war in staatsrechtlicher Hinsicht nichts anderes als Revolution. Schließlich bedürfen „Revolutionen im juristischen Sinne“, das ergänzte er, „nicht unbedingt des Blutvergießens und des Schlachtenlärms, der Barrikadenkämpfe und der Volksstürme“.27 Vergleichbares gilt für den Systemwechsel-Ansatz.
Systemwechsel benötigen Symbole, gerade um längerfristig ihre Wirksamkeit zu entfalten. Philipp Scheidemann sorgte für eine besonders symbolträchtige Szene, als er, wenngleich zu Eberts Leidwesen, am 9. November 1918 nachmittags gegen zwei Uhr von einem Balkon des Reichstagsgebäudes die Republik ausrief.28 Mit seiner improvisierten Rede verdeutlichte Scheidemann zweierlei: erstens den Führungsanspruch der Mehrheitssozialdemokraten innerhalb der Revolution, zweitens die Auffassung, dass die Revolution aus Sicht seiner Partei bereits an ihr Ziel gelangt sei und es fortan um die parlamentarisch-demokratische Legitimierung und Festigung der neuen republikanischen Ordnung gehe. Spätestens war dieser Moment gekommen, als die Führer der Mehrheitssozialdemokratie „um der Wirkung auf die Massen willen“ – so ein berühmtes Wort Ernst Troeltschs – die Revolution, die sie an sich nicht wollten und die sie nicht in Gang gesetzt hatten, „adoptierten“.29 Sie hatten mit dem Vorwurf zu leben, „den Revolutionären die Revolution gestohlen“ zu haben, wie es Otto Wels später einmal aus einer Abwehrhaltung heraus während des Münchner „Dolchstoß“-Prozesses im Jahr 1925 ausdrücken sollte.30 Die Scheidemann-Rede verbreitete sich jedenfalls rasch über Mundpropaganda und entfaltete noch am Tage selbst eine deutliche Wirkung bei den demonstrierenden Arbeitern und Soldaten, die wenigstens kurzzeitig an die siegreich beendete Revolution glaubten.31 Dieses Signal wurde um so begieriger aufgegriffen, als nicht zuletzt unter den Soldaten nach vier Jahren Krieg der „Drang“ groß war, „ins normale Leben zurückzukehren“32 und „heim zu Muttern zu kommen“.33
Wie wenig nur die Republik auf einem stabilen Konsens der Überzeugungen begründet werden konnte, belegt schon – erneut vorrangig in symbolischer Weise – die Tatsache, dass rund zwei Stunden nach Scheidemann der bekennende Revolutionär und „Spartakist“ Karl Liebknecht im Lustgarten vor dem Schloss die „freie sozialistische Republik Deutschland“ verkündete.34 Er kürte sie zur Zwischenetappe auf dem Weg zur kommunistischen Weltrevolution. Selbst angesichts dieses weit ausgreifenden Machtanspruchs formierte sich im übrigen kein royalistischer Widerstand zum Erhalt der Monarchie. Es floss kaum Blut, der Revolution wohnte insofern – wie schon der Politikwissenschaftler Thomas Ellwein vor vielen Jahrzehnten bemerkte – eine „gewisse Liebenswürdigkeit“ inne: „In den meisten deutschen Ländern“, hieß es mit leicht süffisantem Unterton, „bemühte man sich sehr, die Gebote der Höflichkeit zu achten, Fürsten und Revolutionäre verkehrten in einer gewissen Resignation miteinander und in manchen Fällen sprachen die neuen Machthaber den abgedankten Monarchen ihren Dank aus.“35 Manch einem Beobachter unter den revolutionären Arbeitern behagte diese Gutmütigkeit nicht, einem erschienen die Novemberereignisse im Rückblick als „fast unblutig, vielleicht zu unblutig“.36 Der Kommentator der unabhängigsozialdemokratischen Chemnitzer Volkszeitung begrüßte dagegen am 16. November 1918 den unblutigen Charakter, der vielen älteren Revolutionen auch gut angestanden hätte: „Die gewaltigste soll zugleich auch die friedlichste und ordnungsgemäßeste Revolution sein.“37
Allgemein entbrannte gerade innerhalb des linken politischen Spektrums ein Streit über die künftige Gestaltung der neuen Ordnung. Ebert an der Spitze der Regierung wie der Mehrheitssozialdemokratie versprach die baldige Einberufung einer verfassunggebenden Nationalversammlung. Es galt, wie immer geartete Räte-Experimente und erst recht eine Revolution bolschewistischen Typs in Deutschland zu vereiteln.38 „Bolschewismus“ war eine vielfach vernehmbare Leitvokabel in zeitgenössischen Texten 1918/19. So wenig damals eine tatsächliche Bolschewisierung drohte, ist der Begriff als Erfahrungs- und Wahrnehmungskategorie doch von großer Bedeutung.39 Selbst der „rote Graf“ Kessler hielt am 5. Januar 1919 in seinem Tagebuch fest: „Die Welle des Bolschewismus, die von Osten kommt, hat etwas von der Überflutung durch Mohammed im siebenten Jahrhundert. Fanatismus und Waffen im Dienste einer unklaren neuen Hoffnung, der weithin nur Trümmer alter Weltanschauungen entgegenstehen. Die Fahne des Propheten weht auch vor Lenins Heeren.“40 Der deutsche Lenin hieß Liebknecht, und um ihn rankte sich bald der Mythos eines mächtigen Hohepriesters der Revolution, der in keinem Verhältnis zu seiner realen Machtposition stand.41
Die Spaltung der sozialdemokratischen Partei im Verlauf des Ersten Weltkriegs hat in unumkehrbarer Weise den Boden für die Auseinandersetzungen während der Revolutionstage bereitet. Heinrich August Winkler nannte die Spaltung der Arbeiterbewegung, so paradox dies anmutete, sowohl eine gravierende „Vorbelastung“ als auch eine entscheidende „Vorbedingung“ der ersten deutschen Demokratie42; letzteres deswegen, weil das innerlinke Schisma erst die Voraussetzung für eine Übereinkunft zwischen gemäßigt sozialdemokratischen und liberal-bürgerlichen Kräften geschaffen habe. Dabei ist zu ergänzen, dass es zu einfach wäre, das Lager der Linken nach einem binären Schema zu scheiden. In den Blick geraten müssten mindestens vier unterschiedlich starke, sich teilweise überschneidende Kraftzentren, nämlich MSPD und USPD, die beide wiederum ein breites Spektrum in den eigenen Reihen aufwiesen, „Spartakus“ und diverse linksradikale Gruppierungen, die an der Jahreswende 1918/19 die KPD begründeten,43 sowie die Revolutionären Obleute.44
Es fiel schon den Zeitgenossen nicht leicht, zu einem gerechten Urteil über diese verschiedenen Aktivisten-Gruppen zu gelangen. Für Käthe Kollwitz galt es zu bedenken, dass es neben den Matrosen und Soldaten (deren politische Positionierung kaum auf einen Nenner zu bringen war) die links der Mehrheitssozialdemokratie stehenden Aufständischen waren – ob innerhalb der Gruppe der Unabhängigen, der Revolutionären Obleute oder im Spartakusbund –, die den Umbruch und das unwiederbringliche Ende des Kaiserreichs forciert hatten. Für manchen Beobachter war es deshalb schwer, sich eindeutig auf eine Seite zu stellen. Die allgemein mit pazifistischen und sozialistischen Positionen liebäugelnde Künstlerin fühlte sich bei dem Versuch einer gerechten Würdigung hin- und hergerissen. Letztlich findet sich am 8. Dezember 1918 in ihrem Tagebuch ein versöhnliches Urteil notiert:
„Eben sage ich mir noch, wenn Wahl zwischen Diktatur Ebert und Diktatur Liebknecht, ich bestimmt Ebert wählen würde. Auf einmal aber fällt mir ein, was die eigentlich Revolutionären doch geleistet haben. Ohne diesen steten Druck von links hätten wir auch keine Revolution gehabt, hätten wir den ganzen Militarismus nicht abgeworfen. Die Mehrheitspartei hätte uns davon nicht erlöst. Sie wollte immer nur evolutionieren. Und die Konsequenten, die Unabhängigen, die Spartakusleute sind auch jetzt wieder die Pioniere. Sie drängen immer vorwärts, wie es auch liegt. Auch wenn es Blödsinn ist, auch wenn Deutschland darüber kaputt geht. Man wird sie jetzt knebeln müssen um aus dem Chaos herauszukommen und es besteht ein gewisses Recht dazu. Sieger werden voraussichtlich die Gemäßigten bleiben. Ich selbst würde es wünschen. Nur darf man nicht vergessen, daß die zu Knebelnden das eigentlich revolutionäre Ferment sind, ohne die wir überhaupt keine Umwälzung gehabt hätten. Daß es tapfere Menschen sind, die ohne weiteres sich Maschinengewehren aussetzen, daß es hungernde entrechtete Leute sind, die immer zu kurz gekommen sind. Daß es vor allem Leute sind, die, hätten sie damals schon die Macht von heute gehabt, den Krieg verhindert hätten. Kurz und gut, es sind die Leute des revolutionären Prinzips, dem sie mit Unentwegtheit anhängen. Natürlich haben sie faktisch Unrecht. Faktisch muß man mit den Mehrheitssozialisten gehen. Es sei denn, daß einem der gänzliche Zusammenbruch Deutschlands ganz schnuppe ist.“45
Die Mehrheitssozialdemokratie pochte auf Kontinuität im Wandel und geordnete, parlamentarisch-demokratisch legitimierte Transformationswege. Die erfolgreiche Einberufung einer verfassunggebenden Nationalversammlung blieb daher zunächst das vorrangige Ziel. Ausschließlich dort sollten die Grundentscheidungen zur künftigen Ausgestaltung von Staat und Gesellschaft erfolgen. Der erste Reichskongress der Arbeiter- und Soldatenräte Deutschlands, der vom 16. bis 21. Dezember 1918 zusammentrat, stimmte schließlich mit großer Mehrheit der Forderung nach Wahlen zur Nationalversammlung am 19. Januar 1919 zu. Aus staatsrechtlicher und demokratietheoretischer Perspektive spricht einiges dafür, die Sozialdemokratie für ihr Verantwortungsbewusstsein und ihr unbeirrtes Festhalten am Ziel der parlamentarischen Demokratie zu loben. Darin sind Weichenstellungen ganz grundsätzlicher Natur zu erkennen, die durch Eberts eigenes Wort von der Konkursverwaltung in keiner Weise angemessen eingefangen werden.46
Und doch erscheint das Vorgehen der Sozialdemokratie in mancher Hinsicht als allzu vorsichtig. So haben die Furcht vor dem Chaos und ihr Beharren auf Verwaltungskontinuität, überhaupt ein „starres, institutionenfixiertes Denken“47 insbesondere den alten Verwaltungs- und Militärapparat in einem Maße verschont, das nicht notwendig gewesen wäre. Andererseits lässt sich die kontrafaktische Frage nicht eindeutig beantworten, ob ein stärkerer Elitenaustausch nicht ein ebenfalls erhebliches Desintegrationspotenzial mit sich gebracht hätte. Viele Aufständische empfanden die erste Phase der Revolution aufgrund eines unzureichenden Wechsels der Herrschaftseliten und geringer sozioökonomischer Wandlungen jedenfalls als eine „Zeit der Enttäuschungen“, wie es Detlev Peukert einmal pointiert zusammenfasste.48 Dies rief Sehnsüchte nach einer „zweiten Revolution“ wach.49
Noch im Dezember 1918 verdichteten sich die Signale einer fortan zunehmend von Dissens und Gewalt geprägten Revolution. Die Mitglieder der USPD im Rat der Volksbeauftragten schieden Ende Dezember 1918 wegen schwerwiegender Meinungsverschiedenheiten und veranlasst durch den Militäreinsatz gegen die „Volksmarinedivision“ an Weihnachten aus der Regierung.50 Nach der Entlassung des Berliner Polizeipräsidenten Emil Eichhorn, einem linken USPD-Mann, brachen neue Massenproteste aus. Bald forderten der Berliner USPD-Vorstand, Liebknecht und Teile der KPD-Führung, aber auch die Revolutionären Obleute in ihrer Proklamation zum Generalstreik während der ersten Januartage dazu auf, die rein mehrheitssozialdemokratische Regierung Ebert-Scheidemann zu stürzen – sogar: sie „ins Zuchthaus, aufs Schafott“ zu schaffen.51 Die Volksbeauftragten, nun mit dem in Kesslers Worten „schnurrbartschnauzenden“ Noske52 in ihren Reihen, trieben ihrerseits den Verbalradikalismus voran. Und mehr als das: Sie zeigten sich entschlossen, diese Januaraufstände, die sich in den Geschichtsbüchern gelegentlich noch unter dem so nicht zutreffenden Rubrum „Spartakusaufstand“ eingetragen finden, gewaltsam niederzuschlagen. Entschiedener Widerstand war notwendig, die ausgeübte Gewalt im Verbund mit aggressiven Freikorps-Verbänden, die am 15. Januar 1919 Liebknecht und Luxemburg ermordeten, keineswegs. Diese Vorgänge trugen zur Eskalation der Gewalt im Frühjahr 1919 bei und versetzten Deutschland in einen bürgerkriegsähnlichen Zustand. Die sich radikalisierende Massenbewegung geriet in zunehmenden Gegensatz zur Reichsregierung, die zur Sicherung ihrer Autorität von nun an verstärkt auf militärische Mittel angewiesen war und sich dabei in der „Stunde der Abrechnung“ – von der fataler Weise die Rede war – mit skrupellosen Freikorps-Verbänden verbündete, ohne sie wirklich bändigen zu können.53
Dies ist deutlich kritikwürdiger als der sagenumwobene Ebert-Groener-Pakt. Ebert hatte am 10. November 1918 mit Generalquartiermeister Groener telefonisch eine Absprache über die Loyalität des Militärs gegenüber der neuen Regierung getroffen. Dieses Agreement war nachvollziehbar und folgte einem rationalen Kalkül, nämlich die neu gewonnene politische Machtbastion in einer völlig ungewissen Anfangsphase notfalls militärisch sichern zu können. Ähnliches gilt für Eberts Agieren am 10. Dezember 1918, als er die heimkehrenden Truppen mit den Worten „Kein Feind hat Euch überwunden“ begrüßte, was – einer kritischen Auslegung zufolge – dazu beitrug, die Dolchstoßthese „in den Köpfen zu verankern“.54 In weniger düsterem Licht sieht Ebert dagegen, wer in dessen Worten ein Angebot an das Feldheer sieht, sich in das neue politische System zu integrieren. Das Bild hellt sich noch weiter auf, sobald man nicht nur den berühmten Halbsatz zitiert, sondern auch die weiteren Ausführungen berücksichtigt. Keinen Zweifel lässt der Volksbeauftragte nämlich an der „Übermacht der Gegner an Menschen und Material“ als Ursache für die Kriegsniederlage aufkommen. Und in seiner Eröffnungsrede zur Nationalversammlung am 6. Februar 1919 hob er nochmal unzweideutig heraus: „Wir haben den Krieg verloren. Diese Tatsache ist keine Folge der Revolution.“55
Die Interpretation der Militärpolitik der Revolutionsregierung gehört weiterhin zu den herausgehobenen Streitfragen rund um die Umbrüche von 1918/19. Selbst wer das militärische Vorgehen Anfang 1919 als „Politik der Stärke“ rubriziert und für „unausweichlich“ hält, muss die falsche Wahl der „Bundesgenossen“ konzedieren.56 Mark Jones beschreibt die Gründungsgewalt und ihre öffentliche Legitimierung seitens der Regierung als einen fatalen, stilbildenden Prozess und als eine wesentliche Belastung für die Weimarer Republik, die den Weg ins „Dritte Reich“ und den „von ihm angerichteten Horror“ begünstigt habe.57 Auch wer eine solche historische Linienziehung ablehnt, kann nicht übersehen, in welch hohem Maße sich das Militär Eigenständigkeit bewahrte und als Staat im Staate fühlen konnte. Dies sollte sich während des Kapp-Putsches zeigen und gipfelte gegen Ende der Republik in den Querfront-Ambitionen eines Generals Kurt von Schleicher.58 Die ausgebliebene Schaffung einer schlagkräftigen republikanisch-loyalen „Volkswehr“ präsentiert sich vor diesem Hintergrund als ein entscheidendes Versäumnis, ja als „katastrophaler Fehler“ und das „große Übel“ der Revolution, wie sie von den führenden Mehrheitssozialdemokraten betrieben worden sei. Hier wurde für Joachim Käppner die Chance verpasst, dem Militarismus in Deutschland einen mächtigen Dämpfer zu verpassen.59
Aus diesem Blickwinkel besaß die gewaltsame Phase der Revolution in den ersten Monaten des Jahres 1919 samt einer fehlgeleiteten Militärpolitik, die es verpasste, „der Freiheit Waffen zu geben“60, eine anhaltende Prägekraft. Aus der politischen Systemwechsel-Perspektive, die Veränderungen des Regierungssystems in den Mittelpunkt stellt, erscheint dagegen die erste Phase der Revolution mit strukturbildenden Entscheidungen im November und Dezember 1918 gleichwohl von erheblicher formgebender Kraft.61 Ungeachtet der Versäumnisse der ersten Revolutionsperiode sind über diese politischen Transformationsleistungen hinaus wenigstens segmentäre soziale Reformen zu erwähnen wie das Stinnes-Legien-Abkommen vom 15. November samt Einführung des Acht-Stunden-Tags.62 Die getroffenen Regelungen waren zugleich ein zentraler Schritt auf dem Weg zur Sozialpartnerschaft in Deutschland.63 Dies sind Indizien dafür, wie wenig sich die Sozialdemokratie bei aller Ablehnung einer weit ausgreifenden sozialen Revolution (denn nur diese hasste Ebert wie die Sünde64) mit dem Erreichen einer liberalen Demokratie zufriedengeben wollte. Sie dachte darüber hinaus über die Ausgestaltung einer sozialen Demokratie konkret nach.
In der linken Arbeiterschaft wuchs dagegen ein Gefühl der Frustration. Vielerorts und insbesondere in den industriellen Zentren kam es zu General- und Massenstreiks, in Bremen und in München gründeten sich Räterepubliken. Nicht vor Mai 1919 beruhigte sich mit der Niederschlagung der zweiten Münchner Räterepublik vorerst die politische Lage, wobei die unheilvolle Dynamik aus „rotem“ und vor allem „weißem Terror“, der an Härte und Erbarmungslosigkeit kaum zu überbieten war, nicht nur hohe Opferzahlen hervorbrachte, sondern auch tiefe Furchen in die politische Kultur der jungen Republik zog. Attentate und Putschversuche belasteten sie bis ins Jahr 1923 weiterhin akut. Mit der ausgeprägten paramilitärischen Gewalt des Nachkriegs gegen nunmehr sogenannte „innere Feinde“ gingen zwischen 1919 und 1922 mehrere hundert politische, von Rechtsterroristen verübte Morde einher.65