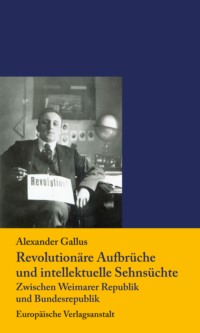Kitabı oku: «Revolutionäre Aufbrüche und intellektuelle Sehnsüchte», sayfa 3
Aber nochmals zurück in der Chronologie: Bei den Wahlen zur Nationalversammlung am 19. Januar 1919 – erstmals in der deutschen Geschichte unter Beteiligung von Frauen – hatten die Parteien der „Weimarer Koalition“ (MSPD, Zentrum und DDP) immerhin mehr als drei Viertel der Stimmen auf sich vereinigt. Auch wenn diese Koalition bekanntlich 1920 wieder zerbrach, gab sie doch einer breiten Mehrheit im gemäßigt linken und bürgerlich-liberalen Spektrum Ausdruck. Schließlich konnte die USPD bei den Wahlen nur 7,6 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen, während die MSPD 37,9 Prozent, die Deutsche Demokratische Partei 18,5 und das Zentrum 19,7 Prozent erzielten. Diese Kräfteverhältnisse gilt es in Rechnung zu stellen, wenn man im Bruch der MSPD-USPD-Allianz einen besonders verhängnisvollen Vorgang sieht. Eine gewisse Fixierung der Revolutionsforschung auf Gruppierungen der Arbeiterbewegung im weitesten Sinne geht mit einer vergleichsweise randständigen Berücksichtigung anderer politischer Lager und Milieus in jener Zeit einher, ohne die sich jedoch kein adäquates Stimmungsbild dieser Wendezeit einfangen lässt.66
Mit der Unterzeichnung des Versailler Vertrags am 28. Juni sowie mit der Verabschiedung der Weimarer Reichsverfassung am 31. Juli 1919 im Parlament sind schließlich die äußeren und inneren Rahmenbedingungen – es ließe sich auch von den zwei Grundgesetzen der Republik sprechen – für die weitere Entwicklung der ersten deutschen Demokratie fixiert worden. Die wesentlich vom liberalen Staatsrechtslehrer Hugo Preuß entworfene Weimarer Verfassung konstituierte das Reich als parlamentarische Republik. Auch das Verfassungswerk war von Anfang an umstritten: „In manchen juristischen Kollegien wird gescharrt, wenn das Wort ‚Reichsverfassung‘ fällt“, hielt Ernst Troeltsch bereits im Januar 1920 fest.67 Vor allem aber sollte es sich mit der Zeit herausstellen, wie sehr Verfassungstheorie und Verfassungswirklichkeit auseinanderklaffen konnten. Die Parteien der Weimarer Republik taten sich schwer damit, die zentrale Konfliktlinie eines parlamentarischen Systems, die zwischen Regierungsmehrheit und oppositioneller Minderheit verläuft, zu verinnerlichen. Vielmehr klammerten sie sich an die alte Trennlinie der konstitutionellen Monarchie – zwischen der Regierung auf der einen Seite und dem Reichstag auf der anderen.
Der Systemwechsel war mithin vollzogen, ohne dass damit die Funktionslogik des neuen parlamentarisch-demokratischen Modus sogleich verinnerlicht worden wäre. Dies bedurfte der Zeit und eines Lernprozesses, der zwischenzeitlich durchaus erkennbare Fortschritte verzeichnete.68 Dies mag auch erklären helfen, weshalb in Deutschland – anders als in Italien – die Demokratie ungeachtet der schwerwiegenden Krisen bis in den Herbst 1923 hinein eine ganze Weile bestehen blieb. Und sicherlich ist es gerechtfertigt, ihrer weiteren Erprobung in Deutschland frei von einem pessimistischen Narrativ einige Aufmerksamkeit zu schenken. Gegen die These vom unwiderstehlichen Sog des Autoritär-Totalitären während der Zwischenkriegszeit, worin der Demokratieentwicklung wenig Eigenständigkeit, sondern vielmehr ein eher reaktiver Überlebenskampf als Grundmotiv zugewiesen wird,69 stehen solche Initiativen, die die Demokratie als Idee wie Handlungskategorie in den Mittelpunkt rücken. Sie sei die „fragile Normalität“ gewesen, die in eine „Hegemoniekrise“ geraten konnte und, vor allem ab der Weltwirtschaftskrise in den Jahren ab 1929, auch geriet.70 Es gilt mithin, die Weimarer Demokratie wie die Demokratien der Zwischenkriegszeit allgemein erst noch zu historisieren: jenseits von statischen Typologien und deterministischen Verfallstheorien. Ein solches Bestreben, das sei an dieser Stelle betont, lässt sich gut mit der Systemwechsel-Perspektive wie mit dem erfahrungsgeschichtlichen Ansatz einer Subjektivierung der Wahrnehmungswelten kombinieren.
III. Bilanz eines erfolgreichen, aber vielgestaltigen und widersprüchlichen Systemwechsels
Von Anfang an blieb der Systemwechsel von 1918/19 eine ungeliebte Revolution. Es ist daher im Grunde erstaunlich, dass eine Revolution, die von allen politischen Richtungen – wenn auch aus ganz unterschiedlichen Motiven – abgelehnt wurde, letztlich insoweit erfolgreich war, als es ihr gelang, Deutschland erstmals in eine parlamentarische Demokratie zu verwandeln. In struktureller, institutioneller und kategorialer Hinsicht waren dies beträchtliche Errungenschaften. Aus zeitgenössisch-gesellschaftlicher Perspektive sollte sich aber bitter rächen, dass mit den politischen Umbrüchen kein legitimierender, kraftvoller Gründungsmythos, sondern vielmehr ein gehöriges Maß an hartnäckiger Dissensstiftung verbunden war.
Schon ein Jahr nach der Revolution notierte der einst so euphorisierte Theodor Wolff nüchtern: „Aber man sollte sich auch klar darüber werden, daß doch eigentlich erst die Revolution, so getrübt ihre Sonne auch aufging, dem deutschen Volke die Rechte und die schweren Pflichten mündiger Nationen gesichert hat. Das sollte man zugeben, auch wenn man ihr den festlichen Erinnerungskranz versagt.“71 Eine spätere erinnerungspolitische Wende – wie im Falle anderer erfolgreicher Revolutionen – trat im Übrigen nicht ein. An sich ist es nämlich mit Blick auf Systemwechsel allgemein keineswegs ungewöhnlich, dass auf die Euphorie des Anfangs Phasen der „Ermüdung und Enttäuschung“72, der Skepsis und Distanz folgen, in denen strukturelle wirtschaftliche, soziale und soziokulturelle Blockaden erkannt und in den Mittelpunkt gestellt werden. Doch während der Weimarer Jahre verstärkte sich der Kampf um die Symbole und den richtigen nationalen Feiermodus eher noch.73
Wie fällt nun die Bilanz zu den vielförmigen und vieldeutigen Vorgängen des langen November 1918 aus der Perspektive des politischen Systemwechsels aus? Die tieferen Ursachen für das Ende der alten politischen Ordnung lagen in zahlreichen Ambivalenzen und Widersprüchlichkeiten des deutschen Kaiserreichs begründet, die unter dem Druck des Ersten Weltkriegs in eine Systemkrise führten. Mit Blick auf seine Verlaufsformen entspricht dieser Systemwechsel einem stark gemischten Typus. Es lassen sich Ansätze für eine evolutionäre Demokratisierung finden, berücksichtigt man das allgemeine Wahlrecht, Vorgänge einer schleichenden Parlamentarisierung und vielfältige rechts- und verfassungsstaatliche Strukturen, aber auch industriegesellschaftliche Kontinuitäten seit dem Kaiserreich, auf die besonders früh und energisch schon Eduard Bernstein und dann Richard Löwenthal mit seiner Formel vom „Anti-Chaos-Reflex“ hingewiesen hatten.74
Es lassen sich ebenso Argumente für einen von den alten Regimeeliten gelenkten Systemwechsel finden, berücksichtigt man das Engagement der Obersten Heeresleitung, aber auch das hohe Maß an Kontinuität zwischen dem Parteiensystem des Kaiserreichs und der Weimarer Republik, das in der Arbeit des Interfraktionellen Ausschusses deutlichen Ausdruck fand. Wer nicht von einer „Lenkung“ sprechen will, muss zumindest ausgeprägte Züge eines zwischen alten und neuen Eliten ausgehandelten Systemwechsels in Rechnung stellen. Und doch gestaltete sich die „heiße“ revolutionäre Phase im November 1918 als ein von unten forcierter Systemwechsel, der sich erst aufgrund des Regime-Kollapses und der aus massiver Erschöpfung geborenen Friedenssehnsucht am Ende des Ersten Weltkriegs entfalten konnte. Diese Melange der Ursachen und Verlaufsformen verweist auf einen Mangel an Eindeutigkeit, der die weitere Transformation hin zu einer funktionierenden Demokratie belastete, aber keineswegs von vornherein zum Scheitern verurteilte.
Die Transition in institutioneller, verfassungsrechtlicher sowie politisch-ideologischer Hinsicht verlief unterschiedlich erfolgreich. Die ersten beiden Komponenten wurden von der Weimarer Republik durchaus erfüllt, und dies sollte nicht gering geschätzt werden, indem man eine überhöhte normative Erwartungshaltung an jene frühe Phase der Revolution und eine junge, im Grunde unerfahrene Regierung unter titanischem Problemdruck anlegt. Mit diesem fragwürdigen Richtmaß ging bald eine Aberkennung des Ehrentitels „Revolution“ einher. Die „wirkliche“ Revolution galt vielmehr gerade unter „freischwebenden“ Intellektuellen als noch anzustrebender Sehnsuchtsort. Zeitgenössische Stimmen aus dem rechts- wie linksintellektuellen Milieu lassen sich für diese skeptische Sichtweise zum Beleg leicht anführen. Autoren wie Spengler oder Moeller van den Bruck setzten auf eine „konservative Revolution“ und einen „preußischen“ oder „deutschen Sozialismus“,75 während ein Autor wie Kurt Tucholsky mit viel Wortwitz das Auseinandertriften von „Ideal und Wirklichkeit“ der neu geschaffenen politischen Ordnung beklagte und hartnäckig in Frage stellte, dass überhaupt eine Revolution stattgefunden hatte.76
So unterschiedlich die Motive waren, waren sich rechte wie linke Kritiker doch nicht nur in der Missbilligung der tatsächlichen Revolution von 1918/19 einig, sondern sie erweiterten diese Kritik um ein Verlangen nach Revolution an sich. Dies gab gleichsam einer doppelten Verschiebung der Revolution Ausdruck: hier als noch nachzuholend in der Zukunft und in gewisser Weise als Vollendung der Novemberrevolution gedacht, dort unter völlig gewandelten Vorzeichen als „konservative“ oder „nationale Revolution“ gefordert, dabei nicht zuletzt von Nationalsozialisten in diametralen Gegensatz zur Novemberrevolution gesetzt. Dies deutet bereits darauf hin, dass die Verwirklichung des weiteren Systemwechsel-Aspekts letztlich misslang oder wenigstens steckenblieb: nämlich die Etablierung einer der parlamentarischen Demokratie aus Überzeugung gewogenen politischen Deutungskultur, wodurch erst der längerfristige Erfolg einer gesamtstaatlichen Demokratisierung im Übergang von einem autoritären zu einem demokratischen politischen System ermöglicht wird. Früh erkannte im Übrigen Ernst Troeltsch, wie wichtig neben der parlamentarisch-demokratischen Staats- und Institutionenordnung die Herausbildung einer „geistigen Revolution“ und einer auf liberalen Werthaltungen beruhenden öffentlichen Meinung sei.77 Durch sie gelinge es erst – so die mit dem Systemwechsel-Ansatz übereinstimmende Einsicht –, Demokratien krisenfest gegen autoritäre Kehrtwenden zu machen. Der politisch-ideologische Wandel verlief nicht dergestalt, dass damit eine breite Akzeptanz der neuen Ordnung, ihrer Prozeduren, Spielregeln und normativen Grundlagen einhergegangen wäre. Eine „zivilgesellschaftliche“ politische Kultur als beste Immunabwehr gegen Systemkrisen in der Demokratie bildete sich nur ungenügend aus. Es mangelte aber nicht von vornherein und allerorten an Versuchen dazu.
IV. Erfahrungsgeschichtliche Sichtweisen aus einer vergangenen Zukunft
Um diese zu erfassen, ist das weitere Hineinhören in zeitgenössische, prinzipiell ergebnisoffene Selbstverständigungsdiskurse wichtig. Eine solche Revolutionsbetrachtung fasst die turbulente Phase des Übergangs 1918/19 als eine Orientierungskrise auf, die zu einer Vielzahl von Gegenwartsdiagnosen und zeitgenössischen Kommentaren herausforderte. In seiner ebenso konzisen wie ausgezeichneten Revolutionsgeschichte aus dem Jahr 2009 bemerkte Volker Ullrich zu Recht: „Die Historiker haben solchen zeitgenössischen Berichten aus der Umbruchzeit bislang zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt.“78
Die Erwartungen, Erfahrungen und Vorstellungswelten der historischen Akteure – die „Kronzeugen“ dieses Textes von Kessler über Kollwitz zu Troeltsch und Wolff dienten als punktuelle Belege – besaßen historische Prägekraft. Es war eben mit den Worten des großen Bielefelder Begriffshistorikers Reinhart Koselleck zunächst die „vergangene Zukunft“ der damaligen Zeitgenossen.79 Jene Zeitspanne, als in Deutschland Revolution war, präsentiert sich dann als eine Phase aufregender, ungewisser Entwicklung, die auch Paradoxien zu erfassen vermag, wie sie sich etwa im Verhältnis zwischen Alltagswelt und politischer Gewalt auftaten.
Nur kurze Zeit nach den Unruhen des Januars wunderte sich Troeltsch beispielsweise, mit wieviel Gleichmut das Berliner Großstadtleben trotz blutiger Kämpfe und omnipräsentem Gewehrfeuer voranschritt: Not und Unsicherheit herrschten, notierte er ein wenig konsterniert, und doch spielten die Theater unverdrossen weiter und wurde allerorten getanzt.80 Nur zwei Tage nach der Ermordung Luxemburgs und Liebknechts machte Harry Graf Kessler ganz ähnliche Beobachtungen. Er verglich Berlin, so ist seinem Tagebuch vom 17. Januar 1919 zu entnehmen, mit einem Elefanten, der mit dem Taschenmesser gestochen wurde, sich kurz schüttelte, um schließlich unbeeindruckt weiterzumarschieren.81
Die Revolution im Speziellen und Weimar im Allgemeinen nicht quasi-pathologisch zu untersuchen, sondern als offene historische Situation voller Lebendigkeit und Risiken gleichermaßen, die von den Zeitgenossen verlangte, Widersprüche und Widrigkeiten auszuhalten, könnte uns helfen in Zeiten, die selbst vom Gefühl neuer Krisenhaftigkeit gekennzeichnet sind. Das Zeitklima unserer Gegenwart kommt der Wiederentdeckung der Revolution von 1918/19 in jedem Fall zugute, sollte uns aber nicht dazu verführen, simple Analogien zu ziehen und allerorten Wiederholungsszenarien von Weimarer Verhältnissen zu erkennen.82
Unsere Aufmerksamkeit für 1918/19 als zentrale, zukunftsweisende Zäsur, die nicht nur im Schatten von 1914, 1917 und 1933 stehen sollte, mag dies indes nicht schmälern. Diese Jahreswende erlebte – ein letztes Mal in Troeltschs Worten – die „erste durchdringende Revolution großen Stils in Deutschland überhaupt,“83 weil mit ihr ungeachtet aller Mängel und Versäumnisse ein politischer Systemwechsel hin zu einer modernen demokratischen Staatsform vollzogen wurde. In der langen Perspektive signalisierte dieser – wie wir heute wissen – also eher einen Anfang als ein Ende.84 Um allerdings nicht zum Schluss in den Jubel eines überhöhten Demokratiebegründungsnarrativs zu verfallen, ist das erfahrungsgeschichtliche Korrektiv der Subjektivierung nochmals hochzuhalten. Dann entgehen wir der Gefahr, Geschichte vom Ziel her – ob des Scheiterns oder der Ankunft – zu schreiben. Der zeitgenössische Blick verkürzt die Sichtweite, hält die Geschichte offen und unruhig. Davon können nicht zuletzt auch wir berufsbedingt zur nachträglichen Besserwisserei neigenden Historiker einiges lernen.
2.
Zum historischen Ort der deutschen Revolution von 1918/19
Ein Wendepunkt in der Gewaltgeschichte?
I. Einleitung: eine Revolution zwischen Debatte, Desinteresse – und neuer Deutung?
Jahrzehntelang war es in der öffentlichen Erinnerung still geworden rund um das Thema der Novemberrevolution, und auch die Forschung über die Umbrüche von 1918/19 schien ins Stocken geraten zu sein. Eine Erklärung für diese Aufmerksamkeitsflaute bot der Spiegel anlässlich des Hundertjahresjubiläums der Ereignisse im Herbst 2018: die Scheu der Deutschen vor Revolutionen ganz allgemein. Sie litten an einer regelrechten Revolutionsaversion. Das Hamburger Wochenmagazin setzte dieses Thema an prominente Stelle und widmete ihm die Titelgeschichte „Revolution. Warum die Deutschen so oft scheitern“.1 In gewisser Weise knüpfte es damit an eine Würdigung an, die Joachim C. Fest schon fünfzig Jahre zuvor an derselben Stelle in einem ebenfalls sehr grundsätzlichen Bericht über die revolutionären Misserfolge der Deutschen formuliert hatte: „Das deutsche Gedächtnis kennt weder geköpfte Könige noch erschlagene Gauleiter, keine Straßenschlachten, keinen Bastillesturm oder siegreich durchgestandenen Verfassungskonflikt. Eher geniert bewahrt es die Erinnerung an einige halbherzige Erhebungen und einen selbstquälerisch wankelmütigen Widerstand, alles in Jammer und Bitternis endend. Nicht einmal der Rückblick auf große Niederlagen ist ihm vergönnt, es kennt nur den Katzenjammer kläglichen Scheiterns.“2
Gerade im Epochenjahr 1968 präsentierte sich die Streitgeschichte rund um die seit jeher „umkämpfte Revolution“ von 1918/19 besonders vital.3 Das historische Szenario traf im Verlauf der dynamischen 1960er Jahre auf ein gewandeltes Meinungsklima, das Räteideen und der Suche nach Alternativen zwischen den großen gesellschaftlich-politischen Systemblöcken bis in die 1970er Jahre hinein eine vermehrte Aufmerksamkeit sichern sollte. Der „Republikanische Club Westberlin“, der führende Köpfe der Außerparlamentarischen Opposition versammelte, beschäftigte sich besonders intensiv mit der „revolutionären Situation 1918“ und erörterte die Möglichkeit, ein halbes Jahrhundert später daran anzuknüpfen. Es galt, so hieß es damals, die „Ausgangslage der Novemberrevolution“ genau zu studieren, um daraus Lehren für eine erneut in Aufruhr geratene Gegenwart zu ziehen und nicht „alle grundlegenden strategischen und konzeptionellen Fragen kurzfristigen Tagesstrategien unterzuordnen oder ganz zu opfern“.4 Dieses Bestreben fügte sich 1968 gut in die „Winterkampagne“ des Clubs ein: „50 Jahre Konterrevolution sind genug“.5 Ernst Fraenkel, der große Pluralismus-Theoretiker und nach seiner Rückkehr aus dem amerikanischen Exil an der Freien Universität Berlin lehrende Politikwissenschaftler, war angesichts solcher Tendenzen beunruhigt und warnte vor einem neuen „Rätemythos“ – auch deswegen, weil er wieder in Mode geratenen Ideen eines Dritten Wegs zwischen Kapitalismus und Kommunismus und einer alternativen sozialistischen Demokratie nichts abgewinnen konnte, sie sogar für demokratiegefährdend hielt.6
Wie wir wissen – dies mochte auch Fraenkels Sorge um den Bestand des westlich-pluralistischen Demokratiemodells abmildern – blieb es bei Gedankenspielen. Sie fügten sich in die Debatte rund um die Novemberrevolution, wie sie bis in die 1980er Jahre hinein geführt wurde: als Geschichte im Optativ. Mehr Demokratisierung und weniger verpasste Chancen seien in einer Zeit möglich gewesen, als führende Politiker ihre Handlungsmöglichkeiten nur unzureichend genutzt hätten, so lautete eine der regelmäßig vorgetragenen Thesen.7 Zudem gelangte der Verratsvorwurf gegenüber der Mehrheitssozialdemokratie zu großer Prominenz, verfocht diese These publikumswirksam doch der wortgewandte, geschickt argumentierende historische Publizist Sebastian Haffner. Sein 1969 erstmals erschienenes Buch Die verratene Revolution, das sich zu einem Langzeitbestseller (später unter dem nicht mehr thesenhaften, einen nüchternen Tatsachenbericht suggerierenden Titel Die Deutsche Revolution 1918/19) entwickelte, war eine fulminante Abrechnung mit Friedrich Ebert und den führenden Mehrheitssozialdemokraten, die – statt sie zum Erfolg zu führen – die Revolution niedergeschlagen hätten.8
Der Streit über den historischen Ort der Novemberrevolution orientierte sich zunehmend weniger an neuen Quellen und Erkenntnissen als an miteinander konkurrierenden normativen Grundannahmen. Zu dieser Form des historischen Wunschkonzerts bemerkte Conan Fischer später leicht süffisant, es sei 1918/19 vor allem nicht jene Revolution gewesen, die sich nachgeborene Historiker gewünscht hätten.9 Bald jedoch waren auch solche Wunschvorstellungen kaum noch vernehmbar. Über die Novemberrevolution wurde nicht länger gestritten. Im Laufe der 1980er Jahre verlor das Thema an Bedeutung, weder die breite Öffentlichkeit noch die Historiker schienen sich fortan dafür zu interessieren. Angesichts der Nichtpräsenz zu ihrem 90. Jubiläum im Jahr 2008 mochte es sogar angebracht erscheinen, in ihr eine „vergessene Revolution“ zu erkennen.10
Dieses Desinteresse an einem über Jahrzehnte hinweg geschichtspolitisch polarisierenden Thema ist nicht leicht zu erklären. Ein Grund dürfte in der Entwicklung der Bundesrepublik selbst auszumachen sein. Die während der ausgedehnten Nachkriegszeit vorherrschende Sorge darüber, wie stabil das neue Staatswesen sein werde, schwand allmählich. Die Bundesrepublik verabschiedete sich im Laufe der 1980er Jahre von ihrem Provisoriumscharakter und damit auch von „Weimar“ als Gegenwartsargument mit identitätsstiftender Kraft.11 An diesem Trend änderte nicht einmal die friedliche Revolution von 1989 etwas Grundlegendes. Anders als man hätte erwarten können, belebte diese neue Novemberrevolution nicht das Interesse an der alten Novemberrevolution. Es traf sogar das Gegenteil zu, zumal bei jenen, die im Wandel von 1989/90 nur eine „nachholende Revolution“12 erkannten und damit eher einen End- als einen Anfangszustand begrifflich fassten. Dies korrespondierte mit der viel zitierten Annahme, es sei nunmehr ein „Ende der Geschichte“13 erreicht. In der Konsequenz gerieten Revolutionen schlechthin aus der Mode.
Seit einigen Jahren wandelt sich dieser Trend und die Beachtung der Novemberrevolution von 1918/19 nimmt wieder zu. Das liegt zum einen an dem mächtigen Sog einer Hundertjahrfeier, zum anderen an gewandelten Zeitläuften. Aufgrund aktueller zeitdiagnostischer Impulse und eines Gefühls neuer Verunsicherung stoßen revolutionäre Auf- und Umbrüche wieder auf stärkere Resonanz. Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 ff. und der damit einhergehenden Globalisierungs- respektive Kapitalismuskritik rücken Fragen nach grundsätzlichen Alternativen politisch-gesellschaftlicher Ordnung stärker in den Fokus: Sie spiegeln sich in institutionellen Legitimations- und Repräsentationskrisen wie in den Herausforderungen eines neuen Populismus. Auch die Rede von einer Rückkehr der Geschichte und von „Weimarer Verhältnissen“ ist wieder häufiger zu vernehmen.14 Vor diesem Panorama kann das gewachsene Interesse an den dynamischen, bisweilen chaotisch erscheinenden Zeiten nach dem Weltkriegsende 1918 kaum verwundern. Es ist das Interesse an einer am Anfang stehenden Geschichte, die gerade erst begonnen hat, neue Wege zu beschreiten, ohne dass ihr Ausgang von vornherein gewiss erscheint.
Diese kräftigen Gegenwartimpulse dürften mit dazu beigetragen haben, dass die Revolutionsforschung mittlerweile aus ihrem ausgedehnten Dornröschenschlaf erwacht ist.15 In gewisser Weise stehen die Geschichtsschreiber vor einem einst schockgefrosteten, nun durch die Jubiläumswärme des 100. Geburtstags und durch das erhitzte Klima der Gegenwartskrisis wieder aufgetauten Forschungsstand. Originäre Forschungen zu dieser nunmehr nicht länger vergessenen, ausgeblendeten oder „verdrängten“ Revolution16 kommen erst wieder in Gang. Es gilt neue Perspektiven und Fluchtpunkte der Geschichtsdeutung zu fixieren, während weiterhin Reflexe der alten Schlachten auftreten. Die Politik- und Arbeiterbewegungsgeschichte rund um die Zentren Berlin und München dominiert nach wie vor die Darstellungen. Sichtweisen der Kultur-, Medien- oder Intellektuellengeschichte, der Alltagsund Mentalitätsgeschichte melden Nachholbedarf an und werden die komplexe Lage des „langen Novembers“ der Revolution weiter entschlüsseln helfen.17
Nicht nur der Mangel an Detailforschungen wurde indes wiederholt kritisiert, sondern vor allem das Fehlen aktueller Gesamtdarstellungen zu einem so außerordentlichen Vorgang wie der Revolution von 1918/19.18 Mehr als dreißig Jahre nach Ulrich Kluges Synthese-Schrift in Hans-Ulrich Wehlers Reihe „Neue Historische Bibliothek“19 sind nun gleich mehrere neue Studien erschienen, die eine umfassende Würdigung der Novemberrevolution beanspruchen.20 Sie zielen mehr oder weniger explizit auf eine Neu- oder Umdeutung der Ereignisse von 1918/19 und – damit verknüpft – des Charakters der Weimarer Republik sowie auf eine je unterschiedliche Lokalisierung des Knotenpunkts der Novemberrevolution innerhalb der Kontinuität der modernen deutschen Geschichte. Ein demokratiegeschichtliches konkurriert dabei insbesondere mit einem gewaltgeschichtlichen, auf Willkürherrschaft und Diktatur zielenden Paradigma. Daraus entspringen unterschiedliche Narrative über den weiteren Verlauf der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert.21
Dieser Aufsatz skizziert beide Interpretationslinien, problematisiert aber vor allem die These von der Gründung der Weimarer Republik als Wendepunkt der Gewalt. Begrifflichtypologische Überlegungen werden dabei ebenso in den Blick genommen wie Fragen nach dem Charakter der soldatischen Formationen und dem zivil-militärischen Kräfteverhältnis während der Revolution und der Frühphase der Republik. Paradoxien der zeitgenössischen Wahrnehmung zwischen Eskalation und Deeskalation, Erwartung und Erfahrung im liberal-bürgerlichen Spektrum, das häufig weniger Aufmerksamkeit erhält als Positionen der verschiedenen Gruppierungen der Arbeiterbewegung, finden sich in einem nächsten Schritt erfasst. Abschließend werden regionale Abweichungen (von den Zentren Berlin und München) und transnationale Gewichtungen innerhalb des Tableaus der Verliererstaaten des Ersten Weltkriegs zumindest knapp und kursorisch erörtert.
Die Kritik richtet sich insbesondere gegen die Marginalisierung von Kontexten und Motivlagen in aktuellen „Political-Violence“-Studien, deren Stärke in der dichten Beschreibung spezifischer Gewaltexzesse besteht. Entscheidende Rahmenbedingungen wie der Zusammenbruch der staatlichen Autorität am Ende des Ersten Weltkriegs und einander widerstreitende multiple Herrschaftsansprüche bleiben als übergeordnete Probleme dagegen unscharf. Abschließend gilt es ein Fazit zu formulieren, ob und in welcher Weise das Szenario 1918/19 eine wegweisende Zäsur der Gewaltgeschichte darstellte, von der aus sich eine quer durch die Weimarer Republik hindurchlaufende Transversale hin zur Diktatur zeichnen lässt.