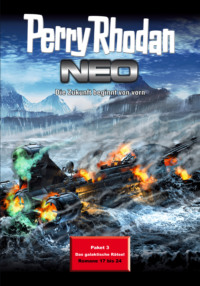Kitabı oku: «Perry Rhodan Neo Paket 3: Das galaktische Rätsel», sayfa 19
Gualls Lächeln wurde rätselhaft. »Vielleicht, weil Sie es mir eben gesagt haben.« Er setzte sich auf und blickte auf die schlafende Sue. »Meine Rolle unter Mördern endet in dieser Stunde, Perry Rhodan.«
Bull öffnete den Mund. »Perry, er macht es schon wieder! Woher kennt er deinen Vornamen? Was ist das für eine Gabe? Liest er unsere Gedanken?«
Rhodan zögerte kurz, dann grinste er. »Ich glaube, ich verstehe Sie, Guall.«
»Ihr seid es wirklich«, flüsterte Lossoshér ergriffen. »Ihr seid der erste Thort. Ihr habt den Blick und werdet den Frieden bringen.«
Rhodan sah Guall fest an. »Werden Sie uns helfen, Guall? Sich und Ihrem Volk?«
Guall stand auf wie ein Mann, der nach langer Zeit der Krankheit seine ersten Schritte tat. Er wandte sich von Rhodan ab. »Ich sagte es schon. Ich will nur sterben. Ruhe haben. Aber ich werde nicht sterben. Ich helfe Ihnen, Perry Rhodan, und meinem Volk. Nicht weil ich es beabsichtige, sondern weil ich weiß, dass es geschehen wird.«
8.
Gefangen
18. September 2036, irgendwo in den USA
Der Boden war kalt, es stank nach Verfaultem und Unrat. Gucky öffnete ein Auge. Unangenehmer Zugwind traf auf die Netzhaut. Er schloss das Lid rasch wieder und dachte über den ersten Eindruck nach. Ein Gitter, davor ein langer Gang. Überall Kacheln an den Wänden. Das sieht nicht nach einer Wohnung aus.
Gehörten Kacheln nicht auf den Boden? In diesem Gang lagen sie überall, außer an der Decke, dort herrschte Holz vor. Grelles Licht fiel von einer röhrenförmigen Deckenlampe und erhellte einen schmutzigen Untergrund. An manchen Stellen klebte dunkles Rot, wie getrocknetes Blut.
Gucky schüttelte sich, es klirrte leise. Dabei spürte er ein unangenehmes Gefühl am Hals. Etwas Schweres schloss ihn ein, drückte auf seinen Kehlkopf und die Wirbelsäule. Ein Halsband. Was für eine Frechheit. An dem Band hing eine in der Wand verankerte Metallkette.
Dieser Monk hatte ihn verschleppt und eingesperrt. Mit Grauen erinnerte sich Gucky an den Moment, als der hochgewachsene Mann mit dem Kreuz am Hals abdrückte. Offensichtlich hatte es sich um Betäubungsmunition gehandelt. An der Stelle, wo sie eingedrungen war, schmerzte Guckys Schulter. Das Kleinohr hat mich kalt erwischt. Aber einen Gucky hält man nicht fest!
Gucky sammelte sich, stellte sich ein freies Gelände unweit des Gebäudes vor und sprang. Er öffnete die Augen, erwartete ein Feld oder eine Wiese mit Blumen um sich zu sehen – und sah stattdessen die Gitterstäbe, das grelle Licht, den schmutzigen Boden, die roten Einsprengsel.
Angst kroch in seine Brust, die Nackenhaare stellten sich auf. Was ist denn los? Das klappt doch sonst immer! Nervös blinzelte er und versuchte es erneut. Mit demselben Ergebnis. Gucky blieb, wo er war. Ihm fielen mehrere menschliche Schimpfwörter ein, die er von Reginald Bull gelernt hatte. Sein Schädel dröhnte, und die Augen schmerzten nicht nur von der Zugluft. Bohrende Kopfschmerzen meldeten sich von der Kopfinnenseite und griffen den Sehnerv an. Vor ihm verschwammen die Metallstäbe. Warum war er so schwach?
Es müssen Nachwirkungen der Betäubung sein, tröstete er sich. Auch der Retter des Universums kann durch so was geschwächt werden.
Erschöpft entspannte er seine Muskeln. So, wie es aussah, saß er in diesem Gefängnis fest, bis er sich erholt hatte. Erneut schaute er in den Gang. Es gab an einer Seite ein offenes Zwischenstockwerk unter dem Dach, in dem er gelbe Ballen erkennen konnte. Sein Gefängnis war das mittlere von dreien, die anderen beiden schienen leer zu sein. Unter ihm lag Stroh auf dem Boden. Hoffentlich gab es keine Flöhe oder Schlimmeres. Bei der Vorstellung begann sein Fell zu jucken. Er hatte gelesen, dass Flöhe ganz furchtbare Krankheiten übertragen konnten. Wer wusste schon, ob sein Organismus nicht dafür anfällig war?
Gucky vertrieb den beunruhigenden Gedanken, richtete sich auf, konzentrierte sich und setzte seine telepathischen Kräfte ein. Die Kopfschmerzen wurden stärker, doch er ließ in seinen Bemühungen nicht nach. Fast sofort empfing er verworrene Gedanken. Es gab viele Menschen um ihn, da war er sich sicher. Eine unerklärliche Mischung aus Angst und Wut bildete die Grundstimmung. Angespannt versuchte Gucky, einzelne Gedanken zu lesen, um die Hintergründe der Gefühle zu erfahren, doch es gelang ihm nicht.
Ermattet ließ er sich in das Stroh sinken. Was sollte er tun? So, wie es aussah, blieb ihm keine Wahl, als weiter das Tier zu spielen. Sicher ging es ihm bald wieder besser, und seine Kräfte kehrten mit dem gewohnten Elan zurück. Dann konnte er fliehen und diesen Monk eine lange Runde fliegen lassen. Er dachte wieder an die Mündung, die Monk auf ihn gerichtet hatte. Der aufsteigende Zorn brachte die Haare an seinen Wangen zum Zucken. Monk wird höher fliegen als alle anderen zuvor, und am höchsten Punkt lasse ich ihn los.
Ausgelaugt fiel Gucky in einen unruhigen Schlaf. Die fremde Umgebung und die Ungewissheit, was mit ihm geschehen würde, setzten ihm zu.
Als er erwachte, spürte er, dass er nicht allein war. Er schreckte mit dem Kopf hoch, stützte sich auf die Arme und ließ sich rasch wieder zurückgleiten, um sich nicht verdächtig zu machen.
Genau vor seinem Käfig stand der große, schwarz gekleidete Mann mit dem offenen Ledermantel. Monk hielt die Arme vor der Brust verschränkt und starrte Gucky mit diesen toten Augen an. Über seine Lippen kam kein Wort, er machte keine Anstalten, sich zu bewegen. Wie ein Dämon aus den menschlichen Mythen ragte er im grellen Licht auf, ein dunkler Fleck zwischen schmutzigem Weiß. Dieses Mal trug er ein anderes schwarzes Oberteil mit v-förmigem Ausschnitt. Gucky konnte seine glatt rasierte Brust unter den Schlüsselbeinen sehen. Dort prangte der Leidensmann, eingebrannt in wachsweiße Haut.
Monks Verhalten war Gucky unheimlich. Was sollte dieser Blick bedeuten? Wenn er die menschliche Mimik besser verstehen könnte, wüsste er es vielleicht. Normalerweise konnte Gucky bei Unsicherheiten in die Gedanken der Menschen eindringen. Dieses Mal gelang es ihm nicht.
Gucky wollte nur fort. Seine Nase juckte entsetzlich. Er versuchte erneut zu teleportieren und scheiterte. Jetzt reicht es aber. Langsam muss ich es doch wieder können. Verängstigt fühlte er in sich hinein. Noch nie hatte sein Körper ihn derart im Stich gelassen. Es kratzte an seiner Souveränität.
Monk blieb eine halbe Stunde vor dem Gitter stehen, aufrecht und starr wie ein Mahnmal. Dann drehte er sich um und verließ ohne ein Wort die Scheune. Sein Gesichtsausdruck blieb Gucky ein Rätsel.
Erneut spionierte Gucky die Umgebung telepathisch aus – mit demselben niederschmetternden Ergebnis. Sein Kopf schmerzte höllisch, es blieb ihm nichts anderes übrig, als sich wieder auszuruhen. Dabei begann das Licht, ihm zuzusetzen. Im ersten Augenblick hatte Gucky es für einen Vorteil gehalten, Licht zu haben, und er war dankbar darüber gewesen. Inzwischen wurde das Licht zum Folterinstrument. Dadurch, dass um ihn niemals Nacht herrschte, kam sein Organismus durcheinander. Neue Kraft durch Regeneration zu schöpfen wurde unmöglich. Irgendwann fiel er in einen nervösen Schlaf, durchsetzt von Albträumen, in denen der schwarze Monk ihn durch eine unwirkliche Landschaft jagte, um ihn mit langen Nägeln an ein Kreuz zu schlagen.
Ein Klirren am Gitter weckte ihn. Vor den Stäben stand ein großes Menschenweibchen mit hellem Kopffell, einer löchrigen blauen Hose und einem rosafarbenen Oberteil. Eine Maus mit runden Ohren war auf dem Stoff abgebildet.
Das Weibchen lächelte ihn an. »Na, mein Kleiner? Du hast sicher großen Hunger, was?« Seine Stimme klang angenehm wie ein Singsang und zugleich wie die eines Kindes. Allerdings erschien Gucky die Menschenfrau vom Aussehen her erwachsen. Sie musste mindestens achtzehn Jahre alt sein, vielleicht auch älter. So genau wusste er es nicht. Es fiel ihm immer noch schwer, das Alter von Menschen zu schätzen. Die älteren Exemplare hatten ausgebleichte Kopfhaare und Knitter im Gesicht. Das felllose Gesicht vor ihm dagegen war ganz glatt.
Linkisch beugte sich das Weibchen vor, hellblaue Augen strahlten ihn an. »Betty gibt dir was, Betty ist gut zu dir.« Sie schob einen Metallnapf mit einer undefinierbaren braunen Masse durch das Gitter. Dafür benutzte sie sicherheitshalber nicht die Hand, sondern den Fuß, der in einem derben braunen Stiefel steckte.
Gucky hatte Hunger, aber dieser Fraß setzte der Fehlbarkeit der menschlichen Küche die Krone auf. Igitt, ist das widerlich. Das kriege ich nie runter. Er wandte den Kopf ab und blickte von Betty fort.
Bettys Stimme klang enttäuscht. »Willst du dein Fresschen nicht? Ist ein gutes Fresschen, ja.«
Dann friss es doch selbst, dachte Gucky zornig. Ich will Pommes frites. Viele Pommes frites. Und Ketchup. Und meine Freiheit.
Guckys Metallleine war zu kurz, um Betty oder den Ausgang zu erreichen. Stattdessen nutzte er die Chance, Bettys Gedanken zu erkunden. Aber wieder erlebte er einen Misserfolg. Er konnte Betty nicht ausspionieren. Seine Gedankenfinger prallten an einer Wand ab. Die Angst in ihm wuchs. Wieso gelang ihm nicht einmal mehr das?
Betty brachte ihm frisches Wasser und verschwand wieder.
In Gucky breitete sich Verzweiflung aus. Er fühlte sich noch immer nicht gestärkt. Dieses Mal dauerte es lange, bis er einschlafen konnte. In seinen Träumen schwebte er über blutverschmierten Kacheln und wurde von einem schwarzen Schatten gejagt.
Als er zitternd erwachte, stand Monk am Gitter und starrte ihn hasserfüllt an, ohne ein Wort zu sagen. Erwartete der Schwarzgekleidete etwas Bestimmtes von ihm, oder wollte er ihn nur quälen?
Gucky ignorierte ihn. Aber er dachte die ganze Zeit darüber nach, was Monk von ihm wollen könnte. War das wirklich Hass in seinem Blick? Schickte das Kleinohr ihm mit seinen Augen eine Botschaft, die er nicht verstand?
Nachdem Monk wieder verschwunden war, fühlte er intensiv in sich – und wusste, er würde immer noch nicht entkommen können. Das Teleportieren wurde zu einer Unmöglichkeit. Hoffnungslosigkeit überkam ihn und leistete der Verzweiflung unerwünschte Gesellschaft. Gucky begann mit dem Stützschwanz nervös auf den Boden zu schlagen. Das leise Geräusch der aufschlagenden Schwanzspitze war der einzige Ton in der Stille. Die Zeit verging zäh, Gucky wusste nicht, wie viele Stunden vergingen.
Irgendwann tauchte Betty auf, redete mit ihm wie mit einem Tier und brachte ihm erneut frisches Wasser. Sie machte ein betrübtes Gesicht, als sie den vollen Fressnapf sah. »Mag das Wauzi kein Nassfutter? Soll ich dem Wauzi lieber Trockenfutter holen? Aber Wauzi hat doch nur einen Zahn …«
Sie plapperte weiter vor sich hin, mehr zu sich als zu ihm. Gucky tröstete es, ihre Stimme zu hören. Zumindest machte Betty ihm keine Angst. Sie summte eine Melodie vor sich hin, während sie den Boden reinigte. Ihre naive, freundliche Art rührte ihn. Betty kam ihm nicht böse vor. Ob sie eine Gefangene an diesem Ort war wie er? Obwohl er ihre Gedanken nicht lesen konnte, erschien es ihm so. An Betty war etwas Ungewöhnliches, was sie von anderen Weibchen ihres Alters gravierend unterschied. Gucky hatte Sue kennengelernt. Um wie viel reifer wirkte Sue im Vergleich zu diesem Kleinohr im Maus-Oberteil.
Eigentlich ist sie gar keine ausgewachsene Menschenfrau. Sie ist wie ein Junges, gefangen im Körper einer Ausgereiften. Ob Betty geistig zurückgeblieben war? Gucky betrachtete nachdenklich die verzottelten hellen Haare, die unordentlich zu einem Zopf zusammengefasst waren. Betty trug weder künstliche Farben im Gesicht, noch besprühte sie sich mit lockenden Duftstoffen wie Mildred. Sie wirkte natürlich, aber keineswegs elegant. Die hellblauen Augen blickten verträumt und oft abwesend. Ihre Schultern waren immer ein Stück hochgezogen, der Rücken rund, als würde sie sich mit dieser Geste vor der Welt schützen.
Sie wirkt so unerfahren. Wie jemand, der nie vor die Haustür kam. Der Eindruck bestärkte das Gefühl, in Betty eine Art Mitgefangene vor sich zu haben.
Mehrere Stunden vergingen. Vielleicht sogar ein ganzer Tag. Je öfter Monk vor dem Gitter auftauchte, desto größer wurde Guckys Angst. Warum konnte er nicht springen? Hatte Monk damit zu tun? Der große Mensch machte keine Anstalten zu zeigen, dass er in Gucky mehr sah als ein Tier. Wollte er Gucky gezielt verängstigen? Aber warum? Vielleicht überlegt er die ganze Zeit, ob es nicht besser wäre, mich zu beseitigen.
Nachdem Monk verschwunden war, würgte Gucky ein winziges bisschen von dem Nassfutter hinunter. Die Beleidigung seiner Geschmacksnerven wurde nebensächlich. Er hatte Hunger. Während er gegen den Brechreiz ankämpfte, entschloss er sich, einen erneuten Fluchtversuch zu wagen.
Nur wenige Minuten später versuchte er zu springen – und scheiterte erneut.
Er suchte nach menschlichen Gedanken. Tatsächlich fand er verschiedene, die dieses Mal etwas deutlicher zu verstehen waren.
Na endlich, dachte er erleichtert. Eine Besserung.
Seine Freude erstickte im Keim, als Gucky begriff, warum er diese Gedanken besser lesen konnte. Da hatte jemand Todesangst! Intensiv versuchte Gucky, in die Gedanken einzudringen, und fand einen Namen: William Tifflor! Julians Vater! Er hatte Tiffs Vater gefunden! War das Tifflor, der in Todesangst war? Oder jemand, der an Tifflor dachte?
Seine Schwäche und die damit verbundene Hilflosigkeit machten Gucky wütend. Obwohl es unvernünftig war, versuchte er mit aller Macht, mehr herauszufinden. Seine Kopfschmerzen explodierten, er sah rote Funken vor Augen. Irgendwann hielt er den Schmerz nicht mehr aus und brach wimmernd zusammen. Der nachfolgende Schlaf, tief und traumlos, erschien ihm gnädig.
Bettys Stimme weckte ihn. »Das Wauzi ist aber eine Schlafmütze, was? Immer wenn ich komme, pennt es. Und es hat wieder kaum gefressen.« Ihre Stimme klang liebevoll und vorwurfsvoll zugleich. »Das geht doch nicht. Wauzi wird immer dünner. Aber schau mal, Wauzi, was ich für dich gebacken habe.« Betty legte mehrere runde Kekse in den Metallnapf und schob ihn mit dem Fuß in seine Richtung durch die Gitterstäbe.
Gucky beugte sich wie ein Hund mit langem Hals darüber und kaute vorsichtig daran. Das schmeckte erträglich. Zwar bitter, aber auch gesund, nicht nur nach künstlichen Stoffen und Schleim. Pommes mundeten deutlich besser, doch diese Kekse ließ er sich gefallen.
»Ja, fein, Wauzi, ganz fein. Bist ein braves Hundi. Betty hat dir Karotten-Bananen-Kekse gebacken, zusammen mit Müsli, Mehl und Öl. Das mag Wauzi, was? Ach, ich würde so gern mit dir raus auf die Felder Gassi gehen, aber das darf die Betty nicht. Er wäre böse.«
Gucky vermutete, dass Betty mit »er« Monk meinte. Dankbar aß er die Kekse. Er ließ keinen Krümel übrig.
Betty strahlte ihn an. »Feines Wauzi. Wenn du die magst, bringe ich dir morgen was besonders Gutes mit. Das wirst du lieben.«
Gucky wollte nicht daran denken, noch einen Tag in Gefangenschaft zu verbringen. Er musste doch irgendwann entkommen können und herausfinden, ob William Tifflor auch vor Ort war. Zumindest fühlte er sich zum ersten Mal seit Tagen satt und damit gleich ein Stück besser.
Leider hielt der Zustand nicht lange an. Monk tauchte auf, kaum dass Betty gegangen war.
Guckys Pein begann erneut. Inzwischen erreichte das Gefühl von Angst und Hilflosigkeit Ausmaße, die der Ilt so nicht kannte. Noch nie hatten seine Paragaben ihn derart frappierend und grundlos im Stich gelassen. Gucky verstand es einfach nicht, es ließ ihn am ganzen Körper zittern. Sein Zahn begann vor Furcht zu schmerzen, als würde sich der Knochen auflösen.
Irgendwann ging Monk wieder. Gucky versuchte erneut, Gedanken aufzufangen, scheiterte, wand sich in fürchterlichen Kopfschmerzen. Dieses Mal erschöpfte er sich bewusst, um schlafen zu können.
Das Erwachen brachte keine Linderung. Das helle Licht beleuchtete seine Qual ungnädig in allen Einzelheiten. Es setzte ihm kontinuierlich zu.
Inzwischen spürte Gucky, wie seine Wahrnehmungsfilter sich veränderten. Jedes Geräusch wurde zur potenziellen Bedrohung und dröhnte in gesteigerter Intensität in den Ohren. Die Augen hatten sich in der Zugluft entzündet und schmerzten, das Sehen wurde anstrengend. Manchmal tauchten im Gang Schemen auf, die nicht da waren. Sie tanzten vor den Gitterstäben, winkten ihm und verschwanden. Gucky schrieb es dem Mangel an gesundem Schlaf zu. Obwohl er sich viel ausruhte, regenerierte er nicht.
Er freute sich auf Bettys Besuche, ihre warmherzige Stimme. Es kam nicht darauf an, was sie sagte, nur wie. Betty wurde zum einzigen wahren Lichtblick in diesem viel zu grellen Elend.
Bei ihrem nächsten Auftauchen brachte Betty nicht nur einen frisch gefüllten Futternapf mit. Ein geflochtener Holzkorb hing an ihrem Arm. »Da bin ich, Wauzi. Betty ist da. Und ich hab dir was mitgebracht.« Sie hob eine orangefarbene, harte Wurzel mit grünen Blättern aus dem Korb. »Probier das mal, Wauzi. Betty mag es. Die anderen sagen, Betty spinnt, aber du magst die Kekse, was? Dann magst du die auch.« Sie hielt Gucky die Wurzel so durch das Gitter hin, dass er sie mit dem Mund erreichen konnte.
Gucky biss beherzt zu und zog das orangefarbene Etwas in den Käfig. Seine Augen weiteten sich. Das schmeckte köstlich! Besser als Pommes. Süß, einfach lecker. Für wenige herrliche Momente vergaß er die Gefahr, in der er sich befand. Seine Geschmacksknospen öffneten sich und schenkten ihm ein Feuerwerk aus Glücksgefühlen. Er fraß drei der harten Stangen. Nur das Grün spuckte er aus.
Betty lachte. »Das sind Karotten, Wauzi. Köstlich, was? Ich hab noch mehr!« Betty hob eine Dose aus dem Korb. Auf einem bunten Etikett stand das Wort Babymöhrchen. Mit einer harten Geste kippte Betty die Dose aus, gut fünfzig Möhrchen purzelten auf den dreckigen Boden.
Gucky erstarrte. Sollte er das Gemüse vom Boden fressen? Die Karotten einzeln aus dem vergammelten Stroh klauben? Warum hatte Betty sie nicht in den Napf gefüllt? Die Geste passte nicht zu ihr.
Fassungslos blickte Gucky die Köstlichkeiten im Dreck an. Da bewegte sich eine von ihnen und stieg in die Luft. Mit geweiteten Augen beobachtete Gucky, wie die anderen Karotten folgten. Sie gruppierten sich, bildeten Buchstaben und schließlich ganze Wörter. Guckys Herz schlug bis zum Hals. Er las, was da stand.
»Ich weiß, dass du kein Tier bist. Betty Toufry.«
Ein weiterer Tag verging. Die Hoffnung, Mildred und Tiff würden ihn finden und befreien, hatte Gucky abgeschrieben. Er setzte auf Betty Toufry. So unbedarft die Menschenfrau wirkte, sie schien ein großes Herz zu haben. Gucky spürte deutlich, dass sie ihm helfen wollte. Es gelang ihm, das Stroh telekinetisch zu Worten zu formen. Jeder einzelne Halm fühlte sich an wie ein ganzes Auto, doch Gucky gab nicht auf. Er nahm die Schmerzen in Kauf in der Hoffnung, dass Betty einen Weg kannte, zu entkommen. Sie dagegen benutzte eine neue Dose Möhrchen. Die Karotten vom Vortag hatte sie ihm gewaschen und in den Napf gefüllt, ehe sie gegangen war. Gucky freute sich schon beim Lesen auf den Augenblick, in dem Betty ihm auch diese Möhren zum Essen überlassen würde.
Nach einer knappen Begrüßung kam er gleich auf einen für ihn wesentlichen Punkt. Sorgfältig formte er Sätze aus dem Stroh. Dabei bildete er immer nur ein Wort aus einer begrenzten Anzahl an Halmen.
»Warum sprichst du nicht laut? Werden wir überwacht?«
»Mister Moncadas mag keine Kameras«, antwortete Betty mit den Möhren. »Er hält sie für die Augen des Teufels. Aber zur Sicherheit hat er eine Akustiküberwachung installiert. Sie haben im Haupthaus darüber geredet.«
Gucky formte ein Fragezeichen. Betty verstand und schrieb rasch weiter.
»Wir sind auf einer Farm. Mister Moncadas lässt keinen von uns raus. Aber ich will raus. Fliehst du mit mir?«
Guckys Herz schlug schneller. Sein Nagezahn blitzte mit einem vertrauten Kribbeln. »Und wie ich das werde. Ich teleportiere uns fort.«
»Das kannst du nicht. Mister Moncadas ist ein Antimutant. Er blockiert unsere Fähigkeiten. Wenn er sich auf uns konzentriert, kann er die Gabe in seiner Nähe ganz wegnehmen.«
Ein Antimutant. Gucky staunte. Davon hörte er zum ersten Mal. Das erklärte seine Schwäche, und es beunruhigte ihn zutiefst. Damit war auch die letzte Hoffnung zunichte, aus eigener Kraft zu fliehen. »Wer ist dieser Monk? Was will er von uns?«
»Er sammelt Menschen mit besonderen Gaben. Dich hält er für ein Tier mit Mutantenkraft. Ich glaube, er weiß noch nicht, was er mit dir machen soll. Mister Moncadas ist verrückt. Er glaubt an ein Jüngstes Gericht. Dafür will er uns bereithalten. Wir sollen sein Heer sein, um ihm zu dienen. Er hat Fanatiker um sich gesammelt, mindestens fünfzig Stück. Sie halten uns gefangen und schirmen das Gelände nach außen ab. Die Farm liegt gut fünfzig Meilen vom nächsten Haus entfernt. Keiner kommt freiwillig. Mister Moncadas ist als religiöser Spinner bekannt. Er glaubt, mit der Ankunft der Aliens kommt das Ende aller Tage.«
»Nenn ihn nicht immer Mister Moncadas«, wies Gucky Betty mit den Strohhalmen zurecht. »Das Kleinohr ist Abschaum. Schreib Monk.«
Auf Bettys Gesicht erschien eine zarte Röte. »Du hast recht. Ich bin es bloß gewohnt, respektvoll zu sein, gegenüber den Erwachsenen.«
Gucky wunderte sich. »Du bist selbst erwachsen, Betty, oder?«
Betty zögerte. Unsicherheit stand ihr ins Gesicht geschrieben. Gucky verstand nicht, warum Betty so etwas Gravierendes über sich selbst nicht wusste. Gab es nicht eine Altersgrenze, an der sich das festmachen ließ? Es fiel ihm schwer, sich zu konzentrieren. Er hatte vom Einsatz der Telekinese bestialische Kopfschmerzen. Seine Nase brannte wie Feuer. »Was machen wir, Betty? Hast du einen Plan?«
Ein Geräusch lenkte Betty ab. »Das ist Stevens. Ich muss weg, sie beobachten mich. Ich darf nicht so lang bei dir bleiben, Gucky. Das ist verdächtig. Morgen. Morgen planen wir die Flucht.«
Zum ersten Mal seit seiner Ankunft im Käfig schlief Gucky gut. Er träumte von einer Stadt aus Möhren, geleitet von einer hellhaarigen Bürgermeisterin im Mickymaus-Oberteil, deren blassblaue Augen liebevoll um sich blickten. Als er erwachte, fühlte er sich besser. Die Anwesenheit von Monk war leichter zu ertragen.
Endlich kam Betty wieder.
»Ich will mehr über die Anlage und die Umstände wissen«, teilte ihr Gucky über die aus Strohhalmen geformten Worte mit.
»Monk hält ein Dutzend Mutanten und etwa genauso viele weitere Gefangene fest. Er hat die Gabe des Blockierens. Allerdings kann er nicht überall zugleich wirken, deshalb kann ich in der Scheune meine Telekinese benutzen. Ich bin die stärkste Mutantin unter den Gefangenen, aber mehr als das Schreiben kriege ich zurzeit nicht hin. Meine Telepathie ist wie tot. Ein furchtbares Gefühl.«
Gucky konnte dem nur zustimmen. Er litt mit Betty.
Betty brauchte eine kurze Pause, dann bewegten sich die mitgebrachten Möhrchen erneut. »Ich habe den Verdacht, dass Monk uns Drogen ins Wasser tut. Deshalb trinke ich meistens Wasser vom Hof, aus der Viehtränke, wenn mich keiner sieht. Die anderen sind wie ruhiggestellt. Dir habe ich auch anderes Wasser gegeben, wann immer es möglich war. Bisher hat es niemand bemerkt. Sie glauben, ich würde alles tun, was sie sagen. Sie denken, ich wäre dumm. Eine Flucht traut mir keiner zu.«
Gucky spürte einen Anflug von Scham. Auch er hatte Betty für ein wenig zurückgeblieben gehalten, aber das war sie nicht. Betty zeichnete sich durch Intelligenz und eine wache Beobachtungsgabe aus. Sie mochte vom Reifeprozess und ihrem Selbstbewusstsein her noch nicht erwachsen sein, doch ihre kognitiven Fähigkeiten waren für ein menschliches Weibchen voll entwickelt. »Du bist nicht dumm. Wie gehen wir vor?«
Betty sah auf sein Halsband und die Metallkette, ehe sie weiterschrieb. »Ich besorge den Schlüssel für das Halsband, dann versuchen wir zu entkommen. Wenn es dunkel ist, werde ich mich aus meinem Zimmer schleichen. Neben der Scheune ist ein langes Nebengebäude. In seinem Schatten können wir nah an den Zaun heran. Dort habe ich angefangen, telekinetisch ein Loch zu graben, und es verdeckt. Die Erde ist noch drin, aber sie ist ganz locker. Wir holen sie raus und zwängen uns durch. Danach versuchen wir, so weit zu kommen wie möglich.«
»Danke, dass du mir hilfst.«
Sie errötete. »Ich kann dich nicht in Gefangenschaft sehen. Irgendwie bist du anders als die anderen. Halt durch! Ich komme dich holen.«
Gucky sah ihr sehnsüchtig nach, als sie an den Kacheln entlang den hell erleuchteten Gang hinunterging. Er fieberte dem Moment der Freiheit entgegen.
Washington D. C., 21. September 2036
Mildred Orsons
Mildred hielt es nicht mehr aus. Drei Tage waren vergangen. Gucky musste etwas zugestoßen sein, eine andere Erklärung gab es nicht. Die ganze Zeit über hatten sie sich eingeredet, der Ilt habe die Lage unter Kontrolle. Dabei ahnten sie, dass sie sich belogen. Tiff hatte angefangen, Nachforschungen anzustellen. Inzwischen wusste er, wo Maro wohnte. Leider hatten sie Maro aber nie persönlich angetroffen. Mildred hatte den Verdacht, dass Maro sehr wohl wusste, dass sie nach ihm suchten, und sich vor ihnen versteckte.
Sie hatten in einem Hotel nahe dem Supreme Court eingecheckt und wurden jeden Tag nervöser. Unruhig ging Mildred in dem schlicht eingerichteten Zimmer auf und ab. Ihr Blick ging immer wieder zum Kleiderhaken. Dort hing ihre Wolljacke, in der ihr Pod war.
»Es reicht, Tiff. Wir machen uns etwas vor. Gucky steckt in der Klemme. Wir müssen Homer G. Adams und Mercant um Hilfe bitten. Vielleicht haben sie eine Idee. Wir brauchen unbedingt Unterstützung. Nur dann haben wir eine Chance, Gucky zu finden.«
Tiff zögerte. Sein Gesicht bekam einen grimmigen Ausdruck, er schien zu allem entschlossen. »Aber nicht, bevor wir alles versucht haben. Wir nehmen uns Maro vor. So oder so wird er den Namen des Hehlers ausspucken, und wenn ich ihm ein Messer unter die Nase halten muss.«
»Und wie willst du Maro finden?«
Tiff schnaubte verächtlich. »Der sitzt doch sicher jeden Abend in seiner Wohnung. Er macht nur keinem auf. Mit Freundlichkeit allein kommen wir nicht weiter.« Er hob den Kopf. »Wir sind ins Lakeside eingestiegen, Mildred. Wollen wir da wirklich vor der Wohnung dieses Verbrechers haltmachen?«
Mildred zögerte einen Augenblick, dann hatte sie sich mit allen Konsequenzen entschieden. »Nein. Wir holen uns Maro.« Und wenn es ihr Leben gefährdete. Sie waren es Gucky schuldig.