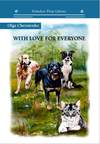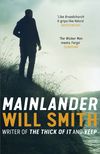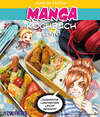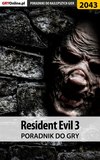Kitabı oku: «Jugendgerichtsgesetz», sayfa 16
2. Anordnung der Maßregel
2
Der Wortlaut des Abs. 1 („können“) ist so zu verstehen, dass von den Maßregeln der Besserung und Sicherung des allgemeinen Strafrechts lediglich die des § 61 Nr. 1, 2, 4 und 5 StGB angeordnet werden dürfen (BGH MDR 1991, S. 1188 f.). Die Entscheidung, ob diese Maßnahmen ausgesprochen werden, richtet sich ausschließlich nach den entsprechenden Vorschriften des allgemeinen Rechts. Soweit deren Anordnung nach allgemeinem Strafrecht bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen zwingend vorgesehen ist (§§ 63 und 69 StGB), räumt Abs. 1 dem Richter also kein Ermessen in dem Sinne ein, dass er trotz Vorliegens der materiell-rechtlichen Voraussetzungen von der Anordnung absehen könnte (BGH NStZ 1991, 384 m.w.N.; BGHSt 37, 373 ff., 374 = BGHR StGB § 63 Gefährlichkeit 14; BGH NStZ 1994, 178 [Detter]; Ostendorf § 7 Rn. 3; Eisenberg § 7 Rn. 6; LG Oldenburg NStZ 1985, 447; 1988, 491 [jeweils bei Böhm]; missverständlich OLG Zweibrücken StV 1989, 314). Das schließt im Hinblick auf § 62 StGB nicht aus, dass die besonderen Gesichtspunkte des Jugendstrafrechts beachtet werden müssen und die Anordnung der Maßregeln der Besserung und Sicherung, namentlich der Unterbringung, gerade bei Jugendlichen besonders sorgfältiger Prüfung bedarf (allg. M.; vgl. BGH NJW 1951, 450 f.; NStZ 1991, 384 m.w.N.; BGHSt 37, 373; BGH Beschl. v. 9.12.1992 – 3 StR 434/92 m.w.N.; s. Rn. 4 m.w.N.). Diese Prüfung hat aber im Rahmen der rechtlichen Subsumtion nach den jeweils einschlägigen Vorschriften des allgemeinen Strafrechts (§§ 63, 64, 68, 69 StGB) zu erfolgen. Sind diese Tatbestände auch unter Berücksichtigung der jugendtümlichen Besonderheiten des Falles erfüllt, so muss das Gericht danach entscheiden (ständige Rspr. des BGH, s. BGH Beschl. v. 26.4.1996 – 2 StR 138/96; BGH NStZ 1999, 123 f.; 1998, 185, 505 [Detter]; NStZ 1996, 428; NStZ 1995, 173, 489; NStZ 1994, 178; BGH MDR 1991, S. 1188 f.; StV 2005, 63). Die Anordnung der übrigen Maßregeln in Abs. 1 steht im Ermessen des Gerichts. Zum gebundenen Ermessen bei der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt nach § 64 s. Rn. 7 ff. Ein irgendwie gearteter Vorrang der Maßnahmen des JGG vor den Maßregeln der Besserung und Sicherung besteht, wie schon § 5 Abs. 3 zeigt, nicht. Zum Verhältnis zu Zuchtmitteln und Jugendstrafe s. § 5 Rn. 15 ff., 18. Zur Unzulässigkeit, Maßregeln der Besserung und Sicherung durch eine Weisung nach § 10 anzuordnen oder deren gesetzlichen Voraussetzungen zu umgehen vgl. § 10 Rn. 16–19.
II. Einzelne Maßregeln der Besserung und Sicherung
1. Allgemeines
3
Für die einzelnen Maßregeln der Besserung und Sicherung gelten die jeweils einschlägigen Vorschriften des StGB (insbesondere auch § 62 und § 67 StGB), so dass auf die dazu vorliegende Literatur und die Rechtsprechungsnachweise verwiesen werden kann. Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich auf durch das JGG veranlasste Besonderheiten. Zur verfassungsrechtlichen Problematik der Anordnung von Maßregeln, wenn der Täter nicht therapiefähig ist, eine Behandlung ablehnt oder der Mittel eines psychiatrischen Krankenhauses nicht bedarf, s. etwa Kruis StV 1998, 94.
2. Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus
4
Die Voraussetzungen der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, die sich allein nach § 63 StGB bestimmen, sind gerade bei Jugendlichen besonders sorgfältig zu prüfen, insbesondere hinsichtlich seiner Gesamtpersönlichkeit, wobei bei Sexualtätern insbesondere die Pubertät zu berücksichtigen ist, hinsichtlich der Art seiner Erkrankung, seines Vorlebens und seiner Lebensbedingungen und aller sonst in Frage kommenden Umstände (BGH NJW 1951, 450 f.; BGHSt 37, 373; NStZ 1993, 527 [Böhm]; SchlHOLG SchlHA 1957, 161; ThürOLG Beschl. v. 29.1.2007 – 1 Ws 16/07). Von der Vernehmung hierfür in Betracht kommender Auskunftspersonen kann nicht mit der Begründung abgesehen werden, dass ein bestimmtes Verhalten als wahr unterstellt wird (SchlHOLG a.a.O.). Je länger die Unterbringung dauern soll, desto strenger werden die Voraussetzungen für die Verhältnismäßigkeit des Freiheitsentzuges sein (BVerfG StV 1986, 160). Zur Unterbringung bei fehlender strafrechtlicher Verantwortlichkeit (§ 3) s. § 3 Rn. 28–30).
5
Da Anordnung und Fortdauer der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus von dem mit Verfassungsrang ausgestatteten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beherrscht werden, nach dem das Sicherungsbedürfnis der Allgemeinheit und der Freiheitsanspruch des Einzelnen gerechten Ausgleich verlangen (BVerfG StV 1986, 162), darf eine Abhilfe der Gefährdung der Rechtsordnung nicht auf andere Weise als die Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus zu schaffen sein; dabei ist zu prüfen, ob eine ausreichende Sicherung in diesem Sinne etwa durch Familienmitglieder, ggf. mit Unterstützung durch das Jugendamt, erreicht werden kann (BGH NJW 1951, 450 f.) oder ob der Zweck der Maßregel nicht auch durch die weniger beschwerende Maßregel der Unterbringung in einer Erziehungsanstalt erreicht werden kann (BGH NStZ 1993, 527 [Böhm]). Erst wenn über die Unmöglichkeit solcher weniger einschneidender Maßnahmen Klarheit geschaffen ist, hat das Gericht eine ausreichende Grundlage für die Entscheidung über eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus (BGH NJW 1951, 450 f.). Die Unterbringung eines 17-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus kann immer nur in besonderen Ausnahmefällen gerechtfertigt sein (BGH NStZ 1991, 384 = MDR 1991, 1188 f.; BGHR JGG § 5 Abs. 3 Absehen 1). All diese Gesichtspunkte sind in der Hauptverhandlung festzustellen und im Urteil darzulegen.
6
Es genügt die bestimmte Wahrscheinlichkeit, der Jugendliche werde die Rechtsordnung künftig unmittelbar bedrohen (BGH GA 1959, 339 [Herlan]). Nicht erforderlich ist indessen, dass verbindlich vorhergesagt werden kann, der Jugendliche werde anschließend keine Gefahr mehr für die Sicherheit der Allgemeinheit sein. Fehlende Erfolgsaussichten stehen – anders als bei der Unterbringung nach § 64 StGB (Rn. 7) – der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nicht grundsätzlich entgegen, weil diese Maßregel in erster Linie dem Schutz der Allgemeinheit dient und die Heilung nur ein erwünschter Nebenzweck ist (für Erwachsene: HansOLG Hamburg MDR 1995, 947 f. m.N.). Grundsätzlich zur Anordnung der Unterbringung eines Jugendlichen in einem psychiatrischen Krankenhaus vgl. BGH MDR 1991, S. 1188 f.
3. Unterbringung in einer Entziehungsanstalt
7
Die Voraussetzungen der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt (§ 7; § 61 Nr. 2 StGB) bestimmen sich nach § 64 StGB. Außerdem gelten die zu Rn. 2 dargelegten Grundsätze. Die Maßregel wird in einer Einrichtung vollzogen, in der die für die Behandlung suchtkranker Jugendlicher erforderlichen besonderen therapeutischen Mittel und sozialen Hilfen zur Verfügung stehen (§ 93a). Liegen die Voraussetzungen des § 64 StGB vor, so hat das Gericht grundsätzlich die Unterbringung anzuordnen, selbst wenn eine aus seiner Sicht geeignete Anstalt nicht gefunden werden kann (BGHSt 28, 327; BGH NStZ 1990, 102; s. § 5 Rn. 10; a.A. Ostendorf § 7 Rn. 5).
8
Die Anordnung nach § 64 steht im gebundenen Ermessen des Gerichts („soll“), so dass sie bei Vorliegen aller Voraussetzungen ergehen muss, wenn nicht besondere Gründe eine Ausnahme erforderlich machen. Es muss sich um therapiebezogene Ausnahmegründe handeln, um Fälle also, in denen zwar eine Erfolgsaussicht gerade noch bejaht werden kann, die Ausgangsbedingungen aber derart ungünstig sind, dass durch ein Absehen von der Unterbringung der Maßregelvollzug von einem faktisch nicht zu leistenden Therapieaufwand, der für die aussichtsreicheren Fälle die knappen Ressourcen entzöge, entlastet werden kann (BT-Drucks. 16/1344, S. 12 f.). Nach der Vorstellung des Gesetzgebers kann dies der Fall sein, wenn die Verständigung mit dem Probanden nicht oder nur über einen Dolmetscher möglich, die Ausweisung des Straftäters zu erwarten oder bei diesem eine Disposition zur Begehung von Straftaten festgestellt ist, die nicht wesentlich auf den Hang zu übermäßigem Drogenkonsum, sondern auf andere oder weitere Persönlichkeitsmängel zurückzuführen ist (BT-Drucks. 16/1344, S. 12 und Bericht des Rechtsausschusses BT-Drucks. 16/5137, S. 10). Vor diesem Hintergrund wird die bisherige Rechtsprechung des BGH, nach der mangelhafte oder fehlende Sprachkenntnisse des Angeklagten bei der Unterbringungsanordnung außer Betracht zu bleiben haben, in dieser Allgemeinheit nicht mehr aufrecht zu erhalten sein (BGH StV 2008, 138).
9
Ein fehlender Therapieplatz in einer vorhandenen Anstalt ist danach auch nach der Änderung des § 64 in eine „Soll“-Vorschrift (Gesetz v. 16.7.2007, BGBl. I, S. 1327) kein ausreichender Grund für ein Absehen von der Unterbringung oder für einen Vorwegvollzug der Jugendstrafe entgegen § 67 Abs. 1 StGB (BGH MDR 1978, 803 [Holtz]; Beschluss v. 13.10.1981 – 1 StR 491/81; BGH NStZ 1981, 492; NStZ 1982, 132; s. auch Rn. 17). Es ist aber andererseits nicht verfassungswidrig, wenn die Vollstreckung der Jugendstrafe, die ursprünglich nach der Maßregel vollzogen werden sollte, angeordnet wird, nachdem sich herausgestellt hat, dass es an einer geeigneten Entziehungsanstalt fehlt (BVerfG JMBlNW 1977, 222). Ebenso ist es auch weiterhin rechtsfehlerhaft, von einer Unterbringung nach § 64 StGB, deren rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, abzusehen, weil das Tatgericht eine freiwillige Therapie für sinnvoll hält (ständige Rspr. des BGH, vgl. Nw. bei Detter a.a.O.). Auch hängt die für eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt erforderliche Erfolgsaussicht nicht alleine von der Therapiemotivation des Angeklagten ab, sondern ist auf der Grundlage einer Gesamtwürdigung seiner Persönlichkeit einzuschätzen (BGH 4 StR 318/07 = ZJJ 2007, 415). Zur Unzulässigkeit der Anordnung der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt mangels Erfolgsaussicht (§ 64 Satz 2 StGB) oder zum Abbruch einer Entziehungskur wegen Aussichtslosigkeit (§ 67d StGB) s. auch § 93a Rn. 4 und die Rechtsprechungsnachweise bei Fischer, StGB, in den entsprechenden Erläuterungen zu § 64 StGB.
4. Führungsaufsicht
10
Die Anordnung der Führungsaufsicht richtet sich nach § 68 Abs. 1 StGB. Der Richter hat bei der Ausübung des ihm gem. § 68 Abs. 1 StGB eingeräumten pflichtgemäßen Ermessens neben den vorgenannten Grundsätzen (Rn. 2) die für die Rechtsfolgen des JGG allgemein geltenden Gesichtspunkte (§ 5 Rn. 5–10) zu beachten. Die §§ 68 bis 68g StGB gelten auch insoweit, als sie „Freiheitsstrafe“ voraussetzen (allg. M., s. etwa Brunner/Dölling § 7 Rn. 9, 10; Ostendorf § 7 Rn. 14). Dabei ist die „Freiheitsstrafe“ der Jugendstrafe gleichzustellen (allg. M.). Dies gilt insbesondere auch für die von Gesetzes wegen eintretende Führungsaufsicht nach § 68f StGB. Der automatische Eintritt von Führungsaufsicht nach Vollverbüßung einer Jugendstrafe von mehr als zwei Jahren, oder von mehr als einem Jahr wegen einer Tat nach § 181b StGB findet in § 7 JGG, § 68f StGB eine ausreichende gesetzliche Grundlage (BVerfG NStZ-RR 2008, 217 m. Anm. Sommerfeld NStZ 2009, 247 ff.).
11
Führungsaufsicht gem. § 68f StGB (der verfassungsgemäß ist, BVerfG NStZ 1981, 21 f.) tritt auch dann ein, wenn es sich bei der für die Dauer von 2 Jahren vollständig vollstreckten „Freiheitsstrafe“ i.S.v. § 68f Abs. 1 S. 1 StGB um eine einheitliche Jugendstrafe nach § 31 Abs. 1 oder Abs. 2 handelt; dass mindestens für eine der einbezogenen Taten eine Jugendstrafe von 2 Jahren verwirkt wäre, ist nicht erforderlich (OLG München NStZ-RR 2002, 183; LG Berlin ZJJ 2008, 80; Ostendorf § 7 Rn. 14; Fischer StGB § 68f Rn. 3, 4 zur Gesamtfreiheitsstrafe; Brunner/Dölling § 7 Rn. 11; Eisenberg § 7 Rn. 66; OLG Hamm NStZ 1998, 61; OLG Karlsruhe NStZ 1981, 182; OLG Dresden NStZ-RR 2005, 153: es muss mit Sicherheit ausgeschlossen werden können, dass für eine der Straftaten weniger als zwei Jahre verhängt worden wären; LG Hamburg StV 1990, 508). Das gilt auch, wenn es sich bei einer der einbezogenen Straftaten um eine Fahrlässigkeitstat handelt (insoweit anders OLG München NStZ-RR 2002, 183). Diese hier seit jeher vertretene Auffassung hat schließlich durch die Neufassung des § 68f StGB durch Art. 1 des Gesetzes v. 13.4.2007 (BGBl. I, S. 513), mit der die Freiheits- und die Gesamtfreiheitsstrafe für die Anwendung von § 68f StGB gleichgestellt wurden, ihre Bestätigung gefunden (insoweit instruktiv LG Berlin ZJJ 2008, 80). Die bisher bestehenden Auslegungszweifel, die hinsichtlich der Anwendbarkeit des § 68f StGB auf die Einheitsjugendstrafe bestanden, sind durch diese Klarstellung des Wortlauts beseitigt worden (BVerfG NStZ-RR 2008, 217). Eine besondere zusätzliche jugendstrafrechtliche Verhältnismäßigkeitsprüfung unter Berücksichtigung des Unrechts- und Schuldgehalts der Tat ist gesetzlich nicht vorgesehen (s. auch Rn. 13; so offenbar aber Eisenberg Rn. 66), zumal die Anwendung von § 68f StGB mit seinen formalen Voraussetzungen der Vollstreckung von immerhin zwei Jahren Jugendstrafe bereits Taten mit besonderem Unrechts- und Schuldgehalt voraussetzt (s. auch Rn. 12), und der Entfall der Maßnahme unter den Voraussetzungen des § 68f Abs. 2 angeordnet werden kann. Ist dies nicht möglich, ist die Führungsaufsicht gerade auch aus erzieherischen Gründen vom Gesetzgeber als wertvolle Weiterhilfe beim Übergang in die Freiheit (Brunner/Dölling, Rn. 11) nach § 2 Abs. 2, § 7 Abs. 1 JGG i.V.m. § 68f StGB gesetzlich zwingend vorgesehen.
12
Dem entspricht auch der gesetzliche Zweck der Vorschrift, zumal das Jugendstrafrecht für Tätergruppen von Jugendlichen, die eine Jugendstrafe von über 2 Jahren verbüßen, ansonsten keine Formen der nachgehenden Betreuung vorsieht (BVerfG NStZ 2008, 217, 218). Während also durch die Vorschriften über die Anordnung der Sicherungsverwahrung erreicht werden sollte, dass die Anwendung dieser Maßregel auf Fälle wirklich schwerer Kriminalität beschränkt und ihr Charakter als äußerstes Mittel der Strafrechtspflege herausgehoben wird (BGHSt 26, 155; 24, 243, 245), kommt es bei dem Institut der Führungsaufsicht darauf an, ungünstig prognostizierten Straftätern, die gerade deswegen nicht in den Genuss der Aussetzung des Strafrestes zur Bewährung gekommen sind, Hilfe und Überwachung bei dem Übertritt in die Freiheit zu gewähren (OLG München NStZ RR 2002, 183, 184; OLG Hamm MDR 1979, 601; HansOLG Hamburg JR 1979, 116; MDR 1982, 689; OLG Düsseldorf MDR 1981, 336; OLG Stuttgart NJW 1981, 2710; OLG Nürnberg MDR 1978, 858; Zipf Anm., JR 1979, 117 f.). Nach dieser Rechtsprechung genügt es daher für die Anwendung des § 68f StGB, dass eine einheitliche Jugendstrafe von mindestens zwei Jahren vollständig vollstreckt worden ist. Denn gleich, ob zwei Jahre wegen mehrerer leichterer oder einer schweren Strafe voll verbüßt worden sind, hat sich durch die zur Ablehnung der Reststrafenaussetzung führende negative Prognose gezeigt, dass die Einflussnahme während des Strafvollzuges trotz beträchtlicher Strafzeit nicht ausgereicht hat zu erproben, ob der Täter außerhalb des Strafvollzuges keine Straftaten mehr begehen wird (OLG Hamm MDR 1979, 601). Die infolge längerer Strafverbüßung eintretenden Schwierigkeiten beim Übergang in die Freiheit bestehen nämlich unabhängig davon, ob es sich um eine Einzel- oder eine Gesamtstrafe handelt (HansOLG JR 1979, 116 und die soeben zit. Obergerichte). Das Rechtsinstitut der Führungsaufsicht bezweckt – im Gegensatz zu der eindeutig dem Sicherungszweck Vorrang gebenden Sicherungsverwahrung – vornehmlich Betreuung und Überwachung derjenigen Straftäter, die so ungünstig prognostiziert sind, dass die zweijährige Verbüßung einer Freiheitsstrafe angezeigt war (Zipf a.a.O.).
13
Zur unterschiedlichen Sichtweise der Oberlandesgerichte für den Fall der Gesamtfreiheitsstrafe s. etwa OLG Düsseldorf NStZ-RR 1999, 138 einerseits und andererseits KG NStZ-RR 1999, 138, jeweils mit weiteren Fundstellenangaben. Die Rechtsprechung des BGH zu § 66 Abs. 1 Nr. 1 StGB, wonach eine einheitliche Jugendstrafe nach § 31 StGB nur dann die Voraussetzungen des § 66 Abs. 1 Nr. 1 StGB erfüllt, wenn sie erkennen lässt, dass der Täter wenigstens bei einer der ihr zu Grunde liegenden Straftaten eine Jugendstrafe von mindestens einem Jahr verwirkt hätte (BGHSt 26, 152 ff.), ist auf § 68f StGB nicht übertragbar. Dies ergibt sich bereits aus der unterschiedlichen Fassung der Tatbestände. § 66 Abs. 1 StGB setzt voraus, dass der Täter zu Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt worden ist und zusätzlich, dass er für „die Zeit von zwei Jahren Freiheitsstrafe verbüßt hat. § 66 Abs. 1 StGB stellt damit neben der Dauer der Verbüßung auf den Unrechtsgehalt der einzelnen Tat ab. Demgegenüber genügt nach § 68f Abs. 1 S. 1 StGB, dass gegen den Täter „eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren vollstreckt worden“ ist, so dass es insoweit lediglich auf die Dauer des Vollzuges ohne Aussetzung des Strafrestes zur Bewährung, nicht auf den Unrechtsgehalt der abgeurteilten Straftaten ankommt (s. auch Rn. 11; a.A. Eisenberg § 7 Rn. 66; Schönke/Schröder-Stree 27. Aufl., § 68f Rn. 4, jedoch wie hier Schönke/Schröder-Kinzig, 30. Aufl., Rn 4a).
14
Gemäß Art. 303 EGStGB darf Führungsaufsicht nur wegen Taten angeordnet werden, die seit dem 1. Januar 1975 begangen worden sind. Die Regelung des § 7 lässt die Vorschriften über die kraft Gesetzes eintretende Führungsaufsicht (§§ 67b, 67c, 67d Abs. 2, 4, 5 und § 68f StGB) unberührt (§ 68 Abs. 2 StGB).
5. Entziehung der Fahrerlaubnis
15
Die Anordnung der Entziehung der Fahrerlaubnis folgt wie die anderen gem. § 7 statthaften Maßregeln der Besserung und Sicherung ausschließlich den hierfür geltenden Vorschriften des StGB (§§ 69, 69b). Die in § 69 Abs. 2 StGB enthaltene Regelvermutung gilt auch im Jugendstrafverfahren, sie widerspricht insbesondere nicht dessen Grundsätzen (Die gesetzliche Vermutung in § 69 Abs. 2 StGB gilt auch im Rahmen des § 7 (absolut h.M, s. etwa Brunner/Dölling Rn. 14; Ostendorf Rn. 15; Meier/Rössner/Trüg/Wulf-Rössner Rn. 13 auch unter zutreffender Hervorhebung des Sicherheitsbedürfnisses der Allgemeinheit; Wölfl NZV 1999, 69 ff.). Die abweichende Auffassung, wonach entgegen der Regelvermutung des § 69 Abs. 2 StGB eine einzelfallorientierte, jugendspezifische Einzelfallprüfung zu erfolgen habe (Eisenberg § 7 Rn. 73; LG Oldenburg NStZ 1985, 447; 1988, 491 [jew. Böhm]; kritisch Molketin Blutalkohol 1988, 310), widerspricht der gesetzlichen Regelung und kann auch nicht auf das „Wesen des Jugendstrafrechts“ (Eisenberg Rn. 73) gegründet werden. Sie lässt zudem unbeachtet, dass § 69 Abs. 2 StGB eine solche Prüfung keineswegs ausschließt. Die Regel des § 69 Abs. 2 StGB knüpft an schwerwiegende Verkehrsstraftaten an, die wegen ihrer Art den Schluss auf die charakterliche Ungeeignetheit besonders nahe legen und bei deren Verwirklichung der Gesetzgeber nur besondere Ausnahmegründe für die Annahme gelten lassen will, der Täter sei dennoch zum Führen von Kraftfahrzeugen charakterlich geeignet. Der Jugendrichter ist somit von einer einzelfallbezogenen Prüfung der charakterlichen Verfassung des Jugendlichen – auch einer etwaigen Nachreife – letztlich nicht entbunden, wenn entsprechende Anhaltspunkte für eine solche Ausnahme vorliegen. Denn die Entscheidung darüber, ob eine Anordnung nach §§ 69, 69a StGB zu treffen ist, verlangt eine Gesamtwürdigung der Persönlichkeit des Täters, soweit sie in der Tat zum Ausdruck kommt (BGH Urt. v. 6.4.1977 – 2 StR 93/77). Hierbei ist von der zur Aburteilung stehenden Tat auszugehen, aus der sich der Eignungsmangel in erster Linie ergeben muss. Daneben müssen aber die Gesamtpersönlichkeit des Täters, seine bisherige Fahrweise oder einschlägige Vorstrafen und sonstige Umstände, die einen Schluss auf die Eignung zulassen, zur Beurteilung herangezogen werden (BGHSt 6, 183 ff., 185). Darüber hinaus sind Gründe für eine unterschiedliche Behandlung der charakterlichen Bildung in straßenverkehrsrechtlicher Hinsicht von Erwachsenen einerseits und Jugendlichen andererseits nicht ersichtlich. Liegen nach diesen Maßgaben die Voraussetzungen des § 69 StGB vor, bedarf es gem. § 69 Abs. 1 S. 2 StGB daher auch keiner weiteren Prüfung nach § 62 StGB. Individuelle, jugendspezifische und erzieherische Gesichtspunkte – wie auch die Untersuchung der Rückfallwahrscheinlichkeit (Eisenberg § 7 Rn. 74 ff.) – haben nach der Systematik des Gesetzes bei der Entscheidung über die Dauer der Sperre für die Erteilung einer Fahrerlaubnis (§ 69a StGB) Beachtung zu finden.
16
Der Entzug der Fahrerlaubnis oder die (isolierte) Sperre für die Erteilung einer solchen (§ 69a Abs. 1 S. 3 StGB) ist, wie sich aus § 69 Abs. 1 S. 1 StGB ergibt, auch bei fehlender Altersreife gem. § 3 anzuordnen, wenn die Voraussetzungen des § 69 StGB vorliegen, weil dort nur eine rechtswidrige Tat vorausgesetzt ist. (BGHSt 6, 394 ff., 397; allg. M.).