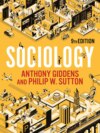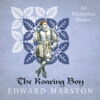Kitabı oku: «Kartell Compliance», sayfa 28
dd) Fallgruppen mit vertikalem Schwerpunkt: Insbesondere Nichtbelieferung von Abnehmern (Geschäfts- und Lieferverweigerung) sowie Bezugsverweigerung gegenüber Lieferanten
80
Grundsätzlich ist jedes Unternehmen auf der Grundlage der Vertragsfreiheit darin frei, seine Handelspartner auszuwählen. Auch ein marktbeherrschendes Unternehmen darf daher Verkäufe, Belieferungen und Geschäftsabschlüsse ablehnen sowie die Abnahme von Produkten bei Lieferanten so regeln, wie es dies für wirtschaftlich richtig und sinnvoll hält.[137] Davon umfasst ist auch die grundsätzliche Möglichkeit eines Unternehmens, potenzielle Abnehmer unter qualitativen oder quantitativen Gesichtspunkten auszugrenzen (sog. selektiver Vertrieb).[138] Auch die Beendigung von Geschäftsbeziehungen steht grundsätzlich einem jeden Unternehmen frei.
81
Allerdings kommt einem marktbeherrschenden Unternehmen eine besondere Verantwortungsstellung zu, die sich im Behinderungs- und Diskriminierungsverbot des Art. 102 AEUV bzw. § 19 GWB manifestiert. Danach können Geschäfts- und Lieferverweigerungen sowie Bezugsverweigerungen unter bestimmten, engen Voraussetzungen als missbräuchlich eingestuft werden.
(1) Nichtbelieferung von Abnehmern
82
Eine Lieferverweigerung kann auch bei rein vertikaler Ausrichtung sowohl in Form einer Behinderung als auch einer Ungleichbehandlung vorliegen. Unter die Fallgruppe der Geschäfts- und Lieferverweigerung fallen dabei sowohl die Fälle des Abbruchs bereits bestehender Geschäftsbeziehungen als auch die Weigerung der Aufnahme neuer Lieferbeziehungen.
83
Der Grad der Marktmacht ist dabei von erheblicher Bedeutung. So kann ein Unternehmen insbesondere dann von einem marktbeherrschenden Unternehmen verlangen, beliefert zu werden, wenn von ihm gleichartige Unternehmen ebenfalls beliefert werden. Eine Lieferverweigerung wäre in dem Fall nur dann rechtmäßig und nicht vom Diskriminierungsverbot umfasst, wenn das marktbeherrschende Unternehmen sachliche Rechtfertigungsgründe vorbringen kann, die gerade im Hinblick auf das die Belieferung begehrende Unternehmen vorliegen. Rechtfertigungsgründe in diesem Sinne können zum Beispiel Kapazitätsprobleme, Vertriebsbindungen oder eine mangelnde Bonität des potenziellen Abnehmers sein. In die in diesem Zusammenhang vorzunehmende Interessenabwägung müssen die Interessen beider Unternehmen berücksichtigt und gegenübergestellt werden. Interessen des potenziellen Abnehmers können dabei zum Beispiel die Bedeutung der Ware für das Unternehmen, die Auswirkungen auf angrenzende Tätigkeiten oder eine Existenzgefährdung sein. Ein Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot ist regelmäßig dann abzulehnen, wenn andere zugängliche Lieferquellen bestehen oder die in Rede stehenden Produkte ohne Weiteres durch andere frei zugängliche Waren ersetzt werden können.[139]
84
Bei einem Abbruch von Lieferbeziehungen kann sich auch bei einer grundsätzlichen Zulässigkeit der Geschäftsbeendigung die Pflicht ergeben, dem Vertragspartner eine angemessene Kündigungs- bzw. Auslauffrist zu gewähren. Dabei muss die genaue zeitliche Komponente anhand der Umstände des Einzelfalls bestimmt werden. In dem Zusammenhang ist zu beachten, dass das Missbrauchsverbot nicht auf einen allgemeinen Sozialschutz gerichtet ist, so dass der Vertragspartner jedenfalls nicht in die Lage versetzt werden muss, seine getätigten Investitionen vollumfänglich zu erwirtschaften. Allerdings sind seine Investitionen (insbesondere, wenn sie auf Veranlassung des Lieferanten getätigt wurden) in die Entscheidung einzubeziehen. Im KFZ-Vertrieb geht die Rechtsprechung beispielsweise von einer Übergangsfrist von etwa ein bis zwei Jahren aus.[140]
85
Der selektive Vertrieb marktbeherrschender Unternehmen ist regelmäßig nach den gleichen Grundsätzen wie eine allgemeine Lieferverweigerung zu beurteilen. Im Rahmen der anzustellenden Interessenabwägung ist einerseits die Freiheit des Herstellers, seinen Vertrieb nach seinen Vorstellungen umzusetzen, und andererseits die Seite des betroffenen Geschäftspartners, der durch die Selektion ausgesondert und nicht beliefert wird, zu berücksichtigen. Eine qualitative Selektion ist grundsätzlich als zulässig zu erachten, wenn die Anforderungen an die Händler sachgerecht und angemessen sind und sie diskriminierungsfrei ausgestaltet sind. Eine quantitative Selektion lässt sich hingegen nur in absoluten Ausnahmefällen rechtfertigen. Dies kann dann der Fall sein, wenn das zu vertreibende Produkt eine zahlenmäßige Begrenzung der Händler erforderlich macht. Dabei ist jedoch immer zu prüfen, ob die Zahl nicht auch anhand qualitativer Kriterien begrenzt werden kann.[141]
(2) Bezugsverweigerung gegenüber Lieferanten
86
Im Rahmen der Bezugsverweigerung gegenüber Lieferanten ist die Rechtsprechung zurückhaltender mit der Bejahung einer Abnahmepflicht durch das marktbeherrschende Unternehmen. So besteht im Falle von Nachfragemacht nur im Ausnahmefall ein Kontrahierungszwang. Denn der Bezugsfreiheit der Nachfrager ist grundsätzlich ein größerer Spielraum einzuräumen als der Belieferungsfreiheit auf der Anbieterseite. Ein Kontrahierungszwang kann daher wohl nur angenommen werden, wenn "mildere", d.h. die Entscheidungsfreiheit des Marktbeherrschers weniger beschränkende Verhaltenspflichten, nicht in Betracht kommen. Dabei ist insbesondere an eine Verpflichtung des Normadressaten zu denken, das abhängige Unternehmen in den engeren Kreis der nach bestimmten objektiven Auswahlkriterien zu berücksichtigenden Anbieter einzubeziehen.[142]
ee) Behinderung beim Zugang zu wesentlichen Einrichtungen („essential facility“)
87
Sowohl im nationalen als auch im europäischen Recht kennt das Missbrauchsverbot das Verbot der Verweigerung des Zugangs zu wesentlichen Einrichtungen. Während diese Rechtsfigur im europäischen Recht unter dem Begriff der „essential facility doctrine“ von der Kommissionspraxis und der Rechtsprechung herausgebildet wurde[143], findet sich im nationalen Recht eine ausdrückliche Normierung in § 19 Abs. 2 Nr. 4 GWB. Danach liegt ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung vor, wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen sich weigert, einem anderen Unternehmen gegen angemessenes Entgelt Zugang zu den eigenen Netzen oder anderen Infrastruktureinrichtungen zu gewähren, wenn es dem anderen Unternehmen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ohne die Mitbenutzung nicht möglich ist, auf dem vor- oder nachgelagerten Markt als Wettbewerber des marktbeherrschenden Unternehmens tätig zu werden. Diese Vorschrift wurde im Zuge der 6. GWB-Novelle als Antwort auf die zunehmende Bedeutung der Netzindustrien aufgenommen. So gibt es einige Märkte, auf denen eine Betätigung nur über die Mitbenutzung kostspieliger Infrastruktureinrichtungen möglich ist. Klassische Beispiele dafür sind Märkte im Bereich der Telekommunikation, der Energie und des Verkehrs.
88
Ein Netz in diesem Sinne ist ein Unterfall der Infrastruktureinrichtung. Darunter ist eine physische oder virtuelle Verbindung zwischen zwei Orten, die im Zuge der Leistungserbringung erreicht werden müssen, zu verstehen.[144] Das Tatbestandsmerkmal der Infrastruktureinrichtung erfüllt im Verhältnis zum Netzbegriff eine Auffangfunktion. Dabei geht der Begriff der Infrastruktureinrichtung über den des Netzes hinaus. Es ist keine Verbindung zwischen mehreren Orten der Leistungserbringung erforderlich, sondern es reicht aus, wenn eine Einrichtung in Anspruch genommen werden muss, um eine Wettbewerbshandlung vorzunehmen.[145] Für beide Begriffe ist kennzeichnend, dass sie selbst keine Dienstleistungen, aber die Voraussetzung für die Erbringung von Dienstleistungen sind.
89
Eine Einrichtung in diesem Sinne gilt dann als wesentlich, wenn es dem Nachfrager ohne ihre Mitbenutzung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist, auf dem vor- oder nachgelagerten Markt tätig zu werden. Für die Tätigkeit ist die Einrichtung unabdingbar, wenn sie weder duplizierbar noch substituierbar ist, es also keinerlei Ausweichmöglichkeiten gibt.[146] Daran fehlt es jedenfalls, wenn die Einrichtung von besonders leistungsfähigen Wettbewerbern errichtet werden kann.[147] Dem Zugang begehrenden Unternehmen darf es ohne die Mitbenutzung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich sein, auf dem nachgelagerten Markt tätig zu werden. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das Unternehmen selbst keine Möglichkeit hat, sich die Einrichtung selbst zu erbauen, z.B. weil eine weitere Schaffung aufgrund fehlender Genehmigung aus rechtlichen Gründen oder aus ökonomischen Gründen wirtschaftlich nicht zumutbar oder sinnvoll ist.
90
In der Praxis zu § 19 Abs. 2 Nr. 4 GWB finden sich Fälle zu Stromnetzen,[148] Fährhäfen,[149] Mobilfunk und Telekommunikation,[150] Fahrplanauskunftssystemen[151] und Kartenvorverkaufsnetzen.[152]
91
Dem anbietenden Unternehmen steht ein angemessenes Entgelt zu. Die Angemessenheit bestimmt sich dabei nach ökonomischen Gesichtspunkten.[153] Der Zugang kann nach § 19 Abs. 2 Nr. 4 HS 2 GWB verweigert werden, wenn dem marktbeherrschenden Unternehmen die Mitbenutzung aus betriebsbedingten oder sonstigen Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Dies kann insbesondere im Fall fehlender Kapazitäten[154] bzw. im Fall von Störungen des Betriebs bei Mitbenutzung problematisch sein. Dabei sind aber zumutbare Möglichkeiten der Schaffung von Kapazitäten ggf. auszuschöpfen.[155] Für die fehlende Zumutbarkeit kommt es auf eine allgemeine Interessenabwägung an, wobei die Beachtung der Freiheit des Wettbewerbs als Zielsetzung des Wettbewerbsrechts zu berücksichtigen ist.[156]
C. Verbotenes Verhalten von Unternehmen mit relativer oder überlegener Marktmacht
I. Behinderungs- und Diskriminierungsverbot für marktstarke Unternehmen (§ 20 Abs. 1 GWB)
92
§ 20 Abs. 1 GWB soll Situationen einer Machtungleichgewichtung erfassen, in denen zwar eine marktbeherrschende Stellung des Unternehmens i.S.d. § 19 GWB nicht festzustellen ist, kleine oder mittlere Unternehmen (KMUs) aber von einem anderen Unternehmen bilateral derart abhängig sind, dass sie nicht über ausreichende und zumutbare Ausweichmöglichkeiten verfügen. Nach § 20 Abs. 1 GWB gilt das Diskriminierungs- und Behinderungsverbot des § 19 Abs. 1 i.V.m. § 19 Abs. 2 Nr. 1 GWB daher auch für Unternehmen mit relativer Marktmacht in der gleichen Weise wie für marktbeherrschende Unternehmen. Der AEUV enthält keine vergleichbare Regelung.
93
Eine relative Marktmacht im Vertikalverhältnis ist nach § 20 Abs. 1 GWB dann zu bejahen, wenn kleine oder mittlere Unternehmen als Anbieter oder Nachfrager von einem Unternehmen abhängig sind, weil keine ausreichenden und zumutbaren Ausweichmöglichkeiten bestehen. Ob ein Unternehmen als kleines oder mittleres Unternehmen einzustufen ist und es damit in den Schutzbereich der Vorschrift fällt, lässt sich nicht schematisch anhand bestimmter Umsatzgrößen festmachen. Vielmehr sind die Umstände des Einzelfalls entscheidend, wobei hier die Umsatzgrößen bei der Bewertung jedenfalls miteinbezogen werden.
94
Im Rahmen des geforderten Abhängigkeitsverhältnisses unterscheidet man im Grundsatz zwischen vier Abhängigkeitskonstellationen, die sich in der Rechtsprechung herausgebildet haben: Die sortimentsbedingte, unternehmensbedingte, nachfragebedingte und mangelbedingte Abhängigkeit.[157]
95
Hauptanwendungsfall des § 20 Abs. 1 GWB ist die sog. sortimentsbedingte Abhängigkeit. Diese liegt dann vor, wenn Handelsunternehmen bestimmte Waren und insbesondere Markenartikel in ihrem Sortiment führen müssen, um weiterhin wettbewerbsfähig zu sein. Dabei unterscheidet man regelmäßig zwischen einer Spitzenstellungsabhängigkeit und einer Spitzengruppenabhängigkeit. Von einer Spitzenstellungsabhängigkeit spricht man dann, wenn ein Hersteller aufgrund der Qualität und Exklusivität seines Produktes ein solches Ansehen genießt und eine solche Bedeutung auf dem Markt erlangt hat, dass der nachfragende Händler in seiner Stellung als Anbieter darauf angewiesen ist, gerade dieses Produkt zu führen. Das Fehlen des Produkts in seinem Angebot würde zu einem Verlust an Ansehen und zu einer gewichtigen Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit des Händlers führen.[158] Eine Spitzengruppenabhängigkeit ist im Gegensatz dazu davon geprägt, dass ein Händler zwar nicht eine bestimmte Marke, aber dafür mehrere führende Marken im Sortiment führen muss, um wettbewerbsfähig zu sein.[159]
96
Eine unternehmensbezogene Abhängigkeit besteht insbesondere, wenn der Abnehmer hinsichtlich seines Bezuges seinen Betrieb derart auf einen Vertragspartner ausgerichtet hat, dass er nur unter Inkaufnahme erheblicher Wettbewerbsnachteile auf die Produkte eines anderen Lieferanten ausweichen kann.[160] Eine unternehmensbezogene Abhängigkeit liegt häufig zwischen KFZ-Vertragshändler und Automobilhersteller, sowie zwischen einem Franchisenehmer und einem Franchisegeber vor.[161]
97
Von einer nachfragebedingten Abhängigkeit[162] spricht man im umgekehrten Fall, in welchem ein Unternehmen darauf angewiesen ist, dass seine Produkte oder Leistungen von marktstarken Nachfragern abgenommen werden, weil es selbst nicht über ausreichende und zumutbare andere Abnehmer als Ausweichmöglichkeit verfügt. Ein solches Abhängigkeitsverhältnis findet sich insbesondere bei Zulieferern der Automobilindustrie, im öffentlichen Beschaffungswesen oder bei Lieferanten großer Handelsgruppen.[163]
98
Eine mangelbedingte Abhängigkeit liegt vor, wenn ein Unternehmen wegen einer generellen Verknappung auf dem entsprechenden Markt, Waren nicht mehr in ausreichender Menge oder gar nicht mehr erhält, so dass es nicht mehr unter konkurrenzfähigen Bedingungen auf andere Anbieter ausweichen kann.[164]
99
Gem. § 20 Abs. 1 S. 2 GWB wird vermutet, dass ein Anbieter einer bestimmten Art von Waren oder gewerblichen Leistungen von einem Nachfrager abhängig ist, wenn dieser Nachfrager bei ihm zusätzlich zu den verkehrsüblichen Preisnachlässen oder sonstigen Leistungsentgelten regelmäßig besondere Vergünstigungen erlangt, die gleichartigen Nachfragern nicht gewährt werden.[165]
II. Anzapfverbot für marktstarke Unternehmen (§ 20 Abs. 2 GWB)
100
Über § 20 Abs. 2 GWB ist der Tatbestand des Missbrauchs durch Aufforderung oder Veranlassung zur Gewährung von Vorteilen (Anzapfverbot)[166], der nach § 19 Abs. 2 Nr. 5 GWB für marktbeherrschende Unternehmen gilt, auch auf marktstarke Unternehmen anwendbar. Damit wird diesen untersagt, unter Ausnutzung ihrer Marktstärke, die von ihnen abhängigen Unternehmen dazu aufzufordern oder zu veranlassen, ihnen ohne sachlich gerechtfertigten Grund Vorteile zu gewähren. § 20 Abs. 2 GWB bezieht sich dabei nur auf den Abhängigkeitstatbestand des Abs. 1, ist aber seinem Wortlaut folgend nicht auf kleine oder mittlere Unternehmen begrenzt. Die Abhängigkeitsvermutung des § 20 Abs. 1 S. 2 GWB gilt nicht im Rahmen des Abs. 2.
III. Behinderungsverbot für Unternehmen mit überlegener Marktmacht (§ 20 Abs. 3, 4 GWB)
101
Die Vorschrift des § 20 Abs. 3, 4 GWB spricht ein besonderes Behinderungsverbot für Unternehmen mit überlegener Marktmacht aus und stellt damit ein Pendant zu Abs. 1 im horizontalen Bereich dar. Danach dürfen Unternehmen mit gegenüber kleinen und mittleren Unternehmen überlegener Marktmacht ihre Marktstellung nicht dazu ausnutzen, solche Wettbewerber unmittelbar oder mittelbar unbillig zu behindern.[167] § 20 Abs. 4 GWB enthält zugunsten der behinderten Unternehmen eine Beweiserleichterung bei der Feststellung des verbotenen Verhaltens.[168]
102
§ 20 Abs. 3 S. 2 GWB enthält drei nicht abschließende Regelbeispiele. Danach wird jedenfalls dann von einer unbilligen Behinderung ausgegangen, wenn Lebensmittel unter Einstandspreis verkauft werden (Nr. 1), wenn andere Waren oder gewerbliche Leistungen nicht nur gelegentlich unter Einstandspreis verkauft werden (Nr. 2) oder wenn ein Unternehmen von KMUs, mit denen es auf dem nachgelagerten Markt beim Vertrieb von Waren oder gewerblichen Leistungen im Wettbewerb steht, für deren Lieferung einen höheren Preis fordert, als es selbst auf diesem Markt anbietet (Nr. 3), es sei denn es liegt eine sachliche Rechtfertigung vor.
D. Ausblick
103
Das Verbot des Missbrauchs von Marktmacht steht im Zentrum aktueller Diskussionen. Wird das Kartellrecht als rechtliches Mittel verstanden, um wirtschaftliche Giganten zu kontrollieren und ihre Macht einzuschränken, nimmt die Rolle der Missbrauchsaufsicht – sowohl auf nationaler als auch europäischer Ebene – deutlich zu. Dabei nimmt die digitale Ökonomie im Rahmen der Missbrauchsaufsicht einen immer größer werdenden Stellenwert ein. Seit Jahren und auch aktuell erlebt sie eine besonders dynamische Entwicklung, insbesondere gekennzeichnet durch Neuerungen in Informations-, Kommunikations-, Datenspeicherungs- und verarbeitungstechnologien. Plattformmodelle, Informationsintermediäre und Netzwerkeffekte haben die digitale Ökonomie in das Bewusstsein von Politik und Öffentlichkeit treten lassen. Wie in vielen anderen Bereichen hat auch im Wettbewerbsrecht längst eine Diskussion begonnen, ob diese Veränderungen eine Anpassung des kartellrechtlichen Regelungsrahmens erfordern. Ausgangspunkt von Reformüberlegungen waren insbesondere verschiedene Missbrauchsverfahren, in denen digitale marktmächtige Unternehmen im Hinblick auf mögliche Marktmissbräuche überprüft wurden.[169] In diesen Verfahren wurde deutlich, dass sich die digitalen Märkte von denen der traditionellen Märkte unterscheiden und es einer Änderung bestehender Marktmissbrauchsmechanismen bedarf, um diese Fälle rechtlich umfänglich abdecken zu können.
104
Erste Änderungen wurden bereits im Zuge der 9. GWB-Novelle im nationalen Recht umgesetzt.[170] So stellt der neu eingefügte § 18 Abs. 2a GWB nunmehr klar, dass auch im Falle einer unentgeltlichen Leistungsbeziehung ein Markt vorliegen kann, während § 18 Abs. 3a GWB die Kriterien für die Bestimmung der Marktmacht von Plattformen und Netzwerken präzisiert. Doch die umgesetzten Änderungen werden bereits jetzt als ergänzungsbedürftig angesehen.[171] So hat sich die Bundesregierung im Koalitionsvertrag vom März 2018 insbesondere vorgenommen, die wettbewerblichen Rahmenbedingungen für die digitale Wirtschaft weiter zu entwickeln. Gebraucht werde eine „Modernisierung des Kartellrechts in Bezug auf die Digitalisierung und Globalisierung der Wirtschaftswelt. Die Wettbewerbsbehörde [müsse] Missbrauch von Marktmacht vor allem auf sich schnell verändernden Märkten zügig und effektiv abstellen können.“[172] Zur Vorbereitung der geplanten Änderungen, hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie eine Studie in Auftrag gegeben, um festzustellen, in welcher Weise das Wettbewerbsrecht zur Vorbereitung auf die weitere digitale Ökonomie angepasst werden muss.[173] Auch wurde im September 2018 durch die Bundesregierung eine „Kommission Wettbewerbsrecht 4.0“ eingesetzt.[174] Vor dem Hintergrund der zunehmenden Globalisierung und Digitalisierung soll sie als rechtspolitische Plattform für eine Debatte zur Weiterentwicklung des deutschen und europäischen Rechts dienen. Reformen sind daher nicht nur im Zuge der 10. GWB-Novelle zu erwarten,[175] sondern ebenfalls solche im europäischen Rechtsraum. Die deutsche und europäische Missbrauchsaufsicht wird daher auch in den kommenden Jahren voraussichtlich einem steten Wandel unterliegen.