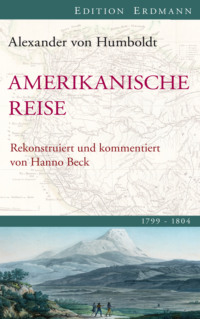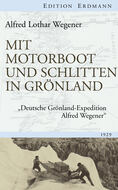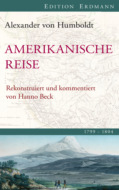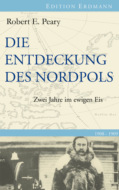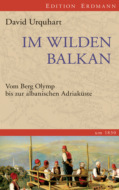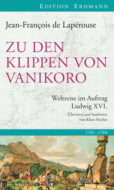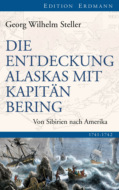Kitabı oku: «Amerikanische Reise 1799-1804», sayfa 6
10. DIE ABKEHR VON DER »LEBENSKRAFT«
Erfahrung, keine Spekulation
Bei allen Experimenten erhob sich die grundsätzliche Frage: Was ist das Leben? War eine selbständige Lebenskraft erwiesen? Er hatte an sie geglaubt. Seine Definition war in Lehrbücher übernommen worden, er selbst aber betrachtete sie nun als von Reil, Veit, Ackermann und Röschlaub gründlich widerlegt. Er gab dies offen zu und trennte sich damit von der Vorstellung der Lebenskraft, da er ihr Dasein nicht erweisen konnte. Das Leben betrachtete er als Gleichgewichtszustand und führte drei Ursachen an, die diesen erhalten könnten. Seine Feststellungen gipfelten in der methodischen Forderung, »physische Erscheinungen nicht nur physisch, sondern auch ohne Zuflucht zu einer unbekannten Materie zu erklären«.133 Von Lebenskraft zu sprechen, wagte er nicht mehr, »da sie sich vielleicht bloß durch das Zusammenwirken der im Einzelnen längst bekannten materiellen Kräfte erklärt«, glaubte aber umso sicherer, eine Definition belebter und unbelebter Stoffe ableiten zu können134: »Belebt nenne ich denjenigen Stoff«, schrieb er, »dessen willkührlich getrennte Theile, nach der Trennung, unter den vorigen äußeren Verhältnissen ihren Mischungszustand ändern. Das Gleichgewicht der Elemente in der belebten Materie erhält sich nur so lange und dadurch, daß dieselbe Theil eines Ganzen ist.«135 Humboldts Schlussfolgerungen bezeugen eine materialistische Tendenz, ohne materialistisch zu sein. Er hoffte, durch diese »Versuche« »die Masse unserer empirischen Erkenntnisse vermehrt zu haben«, obgleich er mit ehrlicher Bescheidenheit das große unbekannte Feld überschaute, das die Forschung noch erschließen musste. Aber: »Große und glänzende Entdeckungen können dem menschlichen Geiste nicht entgehen, wenn er kühn auf dem Wege des Experiments und der Beobachtung fortschreitet und unablässig sucht den ruhenden Pol in der Erscheinungen Flucht.«136
Die Versuche über die gereizte Muskel- und Nervenfaser waren bereits von einer Methode geprägt, die Humboldt nun nicht mehr preisgab: Er verband die rationalistische Empirie mit der vor allem von Kant137 herrührenden Überzeugung vom Naturganzen und der vom Geist der aufblühenden deutschen Klassik kommenden Idee der Harmonie eben dieses Ganzen zum kritischen Realismus seiner Naturforschung.138 Dabei bezeichnete die Ablehnung des Begriffs einer selbständigen Lebenskraft eine sehr wichtige Entwicklungsstufe. Der Rhodische Genius 1795 überstieg die Welt der Erfahrung und wurde daher in die Form einer Dichtung eingekleidet. »Die Lebenskraft wird als uralte, ehrwürdige Idee aufgefaßt – aber im Sinne eines Als-Ob. Während die Lebenskraft von vielen als eine fundamentale Neuerung, als Erkenntnisfortschritt gewertet wurde, bedeutete der ›Rhodische Genius‹ für Humboldt den Abschluss einer individuellen Geistesepoche. Die dichterische Fassung eines wissenschaftlichen Problems ist für die Wahrheitsliebe des Forschers die Krise. Es ist der Wendepunkt in Humboldts Leben …«139
All dies drückt sich vor allem in diesen Versuchen … aus, in der Sicherheit der gefällten Entscheidung zwischen Spekulation und Realismus. Humboldt stritt schon jetzt einer Naturphilosophie keine Verdienste ab, aber er selbst wollte sie nicht pflegen und in seiner Forschung auch keine spekulativen Elemente dulden. Er hatte damit eine Entscheidung getroffen, die der Lösung seines Lehrers und Freundes Georg Forster von der Rosenkreuzerei entsprach. Als er später auf die Zeit des ausgehenden 18. Jahrhunderts zurückblickte, hat er »das Bestreben, die Erscheinung der körperlichen Dinge in ihrem allgemeinen Zusammenhange, die Natur als ein durch innere Kräfte bewegtes Ganzes aufzufassen«, als »Hauptantrieb« bezeichnet.140 »Das Naturganze war für die Forschung Humboldts regulatives Prinzip und Grenzbegriff, in welchem sich die erfahrbare Wirklichkeit und die sie begründende Wahrheit überschneiden und durchkreuzen.«141
Infolge seiner Experimente musste Humboldt auch Stellung beziehen in dem Streit um das Wesen des Galvanismus, der ähnliches Aufsehen erregte wie der Vulkanismusstreit. Galvani meinte, die Elektrizität sei den Muskeln und Nerven eigen, während sein Gegner Volta die gleiche Erscheinung dem Kontakt ungleichartiger Metalle zuschrieb, auf die der Froschschenkel als Elektroskop reagiere. Humboldt wandte sich gegen die Kritik Voltas an den neuen Experimenten Galvanis, dem es gelang, mit einem einzigen an einen Nerv und einen Muskel angelegten Metallbogen Zuckungen zu erregen; das gleiche war ihm sogar ohne Metall bei bloßer Berührung von Nerven und Muskeln geglückt. Er erkannte aber bald, dass die Zuckungen beim Kontakt ungleichartiger Metalle wesentlich stärker waren als in den von Galvani zuletzt angegebenen Fällen. So stand er – ähnlich wie beim Vulkanismusstreit – zwischen den diskutierenden Parteien und war nach Wilhelm Wundts Zeugnis »der richtigen Lösung des Streits vielleicht näher als irgendeiner der Zeitgenossen«.142 »Während Volta das Hauptgewicht auf die physikalische Erklärung des Metall-Reizes legte, war Humboldts Augenmerk hauptsächlich auf die Reizempfänglichkeit des Organismus gerichtet. Der Galvanismus galt ihm in erster Linie als das hervorragende Mittel, die Erregbarkeit zu prüfen. Humboldt unterschied konsequent die Vorgänge, die der tierischen Elektrizität zugehören, von den galvanischen Reizerscheinungen.«143 Er stand zwar schließlich im Lager der Galvanisten, aber nicht als Eiferer, der aus Prinzip nur einen Weg ging, sondern von eigenen Experimenten überzeugt, die er nicht anders deuten konnte. Die galvanische Erscheinung leitete er von einem in den Tieren anwesenden Fluidum ab, das er nicht mit der Elektrizität zu identifizieren wagte. Die Metalle verursachen nicht den Reiz, sondern sie verstärken ihn nur. Vom damaligen Standpunkt aus war seine Theorie nicht unberechtigt, und er verkündete sie auch nicht mit Anspruch auf allgemeine Gültigkeit, sondern nur als Deutung, die den augenblicklichen Stand der Forschung bezeichnen konnte.
Drei Jahre später brachte die Entdeckung der Voltaischen Säule das Ende der Theorien über den physiologischen Ursprung galvanischer Erscheinungen. Damit war, um mit Du Bois-Reymond zu reden144, erst die Gleichung mit zwei Unbekannten aufgelöst: Der physikalische Galvanismus und die wirkliche Elektrizität der tierischen Teile waren bisher vermengt worden. Dessen ungeachtet enthielt Humboldts Werk wichtige Vorstufen für die Erforschung der Elektrophysiologie, die nun stark vernachlässigt wurde und 50 Jahre später, oft ohne Kenntnis vergangener Leistungen, wieder aufgenommen werden musste. Hin und wieder hatte er selbst bereits Voltaische Säulen konstruiert.
11. PASIGRAPHISCHE IDEEN UND SCHILLERS KRITIK
Humboldts drittes Forschungsprogramm
Während der Arbeit an seiner bisher umfangreichsten Veröffentlichung hatte Humboldt bald das Gefühl gehabt, dass die Sprache allein die Fülle seiner Versuche nicht genau beschreiben könne oder zu einer sinnverwirrenden pedantischen Ausführlichkeit führen müsse.145 So entwickelte er Buchstabenformeln, auf die er größten Wert legte. Er schrieb: »Weder das aufmerksamste Lesen meiner Arbeit, noch die Betrachtungen der Figuren machen es möglich, jene Fülle von Thatsachen mit einem Blicke zu umfassen. Es schien mir daher wichtig, eine Methode zu erfinden, welche diesem Mangel abhülfe. Die Bequemlichkeit, welche die Mathematik darbietet, durch analytische Zeichen viele Sätze in wenigen Zeilen darzustellen, reizte mich zu dem Versuche, die Abänderungen des galvanischen Apparats, bei dem fast alles auf der kettenförmigen Aneinanderreihung der Stoffe beruht, durch eine ähnliche Zeichensprache auszudrücken.«146 Von diesen Gedanken ausgehend, entwickelte er die Idee einer »Pasigraphie« (= allgemein verständliche Schriftzeichensprache) und verstand bald darunter die exakte, übersichtliche und leicht verständliche Darstellung geognostischer und geographischer Erscheinungen durch Buchstaben, Richtungspfeile, Symbole und abgekürzte Bezeichnungen für Formationen und Gesteine. Damit hatte sich auch die raumwissenschaftliche Tendenz, die den Kern seiner Forschung bezeichnete, wieder durchgesetzt. Die Pasigraphie schien zunächst ein reines Darstellungsproblem zu bedeuten. Aber sehr bald sollte sich unter dieser Bezeichnung ein wesentliches und tiefes Programm entfalten, eine ausgesprochene Lieblingsidee Humboldts. Er muss solche Gedanken nach den ersten Andeutungen sehr bald auf Geognosie und Geographie angewandt haben, und zwar so intensiv, dass er später improvisiert und aus dem Gedächtnis heraus darlegen konnte, wie er sich die Anwendung einer solchen Pasigraphie dachte.147 Sie bedeutete in Wahrheit die dritte Stufe eines umfassenden raumwissenschaftlichen Forschungsprogramms, das erst in der Zukunft in die Tat umgesetzt werden sollte. Nach dem Plan einer »Geschichte der Pflanzen« und eines Werks über die Konstruktion des Erdballs dachte Humboldt nun auch an eine »Pasigraphie«.
Als der erste Band von Humboldts Versuchen … (1797) vorlag, stieß sich Schiller an den vermittelnden Formeln und steigerte sich in einen ehrlichen Ärger hinein, der leicht gelindert worden wäre, wenn er eine Diskussion mit Humboldt gesucht hätte. Dabei wäre zutage getreten, dass diese pasigraphischen Darstellungsversuche durchaus den Zusammenhang des lebendigen Organismus nicht verstümmelten, sondern nur Vorläufer größerer Ideen waren. Goethe und Körner verstanden Humboldt besser, Schiller aber wandte sich energisch gegen die Buchstabenformeln. Sein Verhältnis zu Humboldt erschien schon nach der Publikation des Rhodischen Genius abgekühlt. Jetzt griff er Alexander scharf an. Als sich die Humboldts gerade in Dresden aufhielten, schrieb Körner an Schiller: »Alexander von Humboldt ist mir ehrwürdig durch den Eifer, mit dem er sein Fach betreibt. Für den Umgang ist mir Wilhelm genießbarer, weil er mehr Ruhe und Gutmüthigkeit hat. Alexander hat etwas Hastiges und Bitteres, das man bei Männern von großer Thätigkeit häufig findet. Wilhelm ist mir sehr lieb geworden, und ich habe mit ihm viele Berührungspunkte.«148 Schiller antwortete am 6. August 1797 und begrüßte, dass sich Körner so gut mit Wilhelm verstände, dem er gewiss mehr zu danken hätte als seinem jüngeren Bruder: »Ueber Alexander habe ich kein rechtes Urtheil; ich fürchte aber, trotz aller seiner Talente und seiner rastlosen Thätigkeit wird er in seiner Wissenschaft nie etwas Großes leisten. Eine zu kleine, unruhige Eitelkeit beseelt noch sein ganzes Wirken. Ich kann ihm keinen Funken eines reinen, objectiven Interesses abmerken – und wie sonderbar es auch klingen mag, so finde ich in ihm, bei allem ungeheuern Reichthum des Stoffes, eine Dürftigkeit des Sinnes, die bei dem Gegenstande, den er behandelt, das schlimmste Uebel ist. Es ist der nackte, schneidende Verstand, der die Natur, die immer unfaßlich und in allen ihren Punkten ehrwürdig und unergründlich ist, schamlos ausgemessen haben will und mit einer Frechheit, die ich nicht begreife, seine Formeln, die oft nur leere Worte und immer nur enge Begriffe sind, zu ihrem Maßstabe macht. Kurz, mir scheint er für seinen Gegenstand ein viel zu grobes Organ und dabei ein viel zu beschränkter Verstandesmensch zu sein. Er hatte keine Einbildungskraft, und so fehlt ihm nach meinem Urtheil das nothwendigste Vermögen zu seiner Wissenschaft, denn die Natur muß angeschaut und empfunden werden in ihren einzelnsten Erscheinungen wie in ihren höchsten Gesetzen. Alexander imponirt sehr vielen und gewinnt im Vergleich mit seinem Bruder meistens, weil er ein Maul hat und sich geltend machen kann. Aber ich kann sie dem absoluten Werthe nach gar nicht miteinander vergleichen, so viel achtungswürdiger ist mir Wilhelm.«149 Körner hielt nicht mit seinem gerecht abwägenden Urteil zurück und vertrat in auffälliger Weise Alexanders Standpunkt, als er am 25. August 1797 antwortete: »Dein Urtheil über Alexander von Humboldt scheint mir doch fast zu streng. Sein Buch über die Nerven habe ich zwar nicht gelesen, und kenne ihn nur aus dem Gespräch. Aber gesetzt, daß es ihm auch an Einbildungskraft fehlt, um die Natur zu empfinden, so kann er doch, däucht mich, für die Wissenschaft vieles leisten. Sein Bestreben, alles zu messen und zu anatomiren, gehört zur scharfen Beobachtung, und ohne diese gibt es keine brauchbaren Materialien für den Naturforscher. Als Mathematiker ist es ihm auch nicht zu verdenken, daß er Maaß und Zahl auf alles anwendet, was in seinem Wirkungskreise liegt. Indessen sucht er doch die zerstreuten Materialien zu einem Ganzen zu ordnen, achtet die Hypothesen, die seinen Blick erweitern, und wird dadurch zu neuen Fragen an die Natur veranlaßt. Daß die Empfänglichkeit seiner Thätigkeit nicht das Gleichgewicht hält, will ich wol glauben. Menschen dieser Art sind immer in ihrem Wirkungskreise zu beschäftigt, als daß sie von dem, was außerhalb vorgeht, große Notiz nehmen sollten. Dies gibt ihnen den Anschein von Härte und Herzlosigkeit.«150
Merkwürdigerweise hat man den Ursprung dieser Schillerschen Kritik bald ganz übersehen und sein geharnischtes Schreiben zusammenhanglos zitiert. Sein Ärger entzündete sich ausschließlich an Humboldts ersten pasigraphischen Versuchen, wie schon Palleske und Löwenberg erkannten.151 Eine Feindschaft hat der in dieser Beziehung empfindliche Schiller nie gegen Humboldt gehegt. Beide hatten medizinische Studien getrieben und oft über die Experimente zu den Versuchen … gesprochen.152 Insofern bedeutete Schillers Kritik keine Trennung, sondern nur ein Abrücken von Humboldt, der übrigens diese Ablehnung getrost hinnahm.
12. DER INNERE ZWECK DER WISSENSCHAFT
Rechtfertigung reiner Forschung
Schon nach dem Erscheinen des ersten Bandes war verschiedentlich Kritik laut geworden. Anderen wollten Versuche, die Humboldt beschrieben hatte, nicht gelingen. Damit waren diese natürlich nicht widerlegt, und offenbar erschienen Alexander selbst andere Einwände viel wichtiger. So hatte man auch nach dem praktischen Nutzen dieser Experimente gefragt. Worin sollte er denn liegen, was für einen Zweck hatte dieser Aufwand? Humboldt erteilte eine zugleich als Zeitkritik bedeutsame Antwort. Er glaubte, »in einem Zeitalter, wo man Früchte oft vor der Blüthe erwartet und vieles darum zu verachten scheint, weil es nicht unmittelbar Wunden heilt, den Acker düngt oder Mühlräder treibt«, dieser Frage nicht ausweichen zu können. Man nennt, sagte er, »die Cetomologie und die Conchiologie ein ergötzendes Spielwerk, weil beide Wissenschaften keinen unmittelbaren Bezug auf technische Gewerbe haben. Man hält den philosophischen Forschungsgeist zurück, die Bahn zu verfolgen, auf der er sich den innern Zusammenhang seiner Erkenntnis aufzufassen schmeichelt, und setzt ihm ein bestimmtes äußeres Ziel, nach dem er mittelbar hinarbeiten soll.«153 Humboldt gab eindeutig eine Antwort, die für seine wissenschaftliche Gesinnung richtungweisend bleiben sollte: »Man vergißt, daß Wissenschaften einen inneren Zweck haben, und verliert das eigentlich litterarische Interesse, das Streben nach Erkenntniß als Erkenntniß, aus dem Auge.« Denn: »Alles ist wichtig, was die Gränzen unseres Wissens erweitert und dem Geist neue Gegenstände der Wahrnehmung oder neue Verhältnisse zwischen dem Wahrgenommenen darbietet.«154 Damit wies er der zweckfreien Forschung, dem reinen Erkenntnisstreben, den Weg, ohne sich von der Aufklärung zu trennen, die eben viele Möglichkeiten der Stellungnahme kannte.
Das Urteil über Humboldts Werk war sehr stark durch die im ersten Band mitgeteilten galvanischen Versuche bestimmt, hauptsächlich wegen des modischen zeitgenössischen Interesses.155 Darauf deutet auch die Tatsache hin, dass der französische Übersetzer, der Arzt Jadelot, sich 1799 nur des ersten Bandes annahm, weil man auch in Frankreich »offenbar weit mehr am Galvanismus als an einer Erschließung der reizphysiologischen Forschungsprobleme interessiert« war.156
13. ANREGUNGEN FÜR FORSCHUNGSREISEN
IN DEN »VERSUCHEN«
Umriss einer medizinischen Geographie
In den Versuchen … kündigte sich auch die große Reise, die Humboldt nach den Tropen plante, an. Die Brüder Keutsch, vor allem der ältere dieses Geschwisterpaares, gehörten zu den meistgenannten Personen. Wir erfahren auch von dem wichtigen Buch über das Fallen und Streichen im mittleren Europa, von der weitgehenden Übereinstimmung im Fallen der Urgebirgsschichten, das gar nicht von der Gestalt der Berge abhänge, sondern von unbekannten Attraktionskräften im Innern des Erdkörpers hervorgerufen werde.157 Dazu wurde das Programm einer »medicinischen Geographie« entwickelt und dieser Begriff geprägt.158 Humboldt verstand darunter anthropogeographisch den Einfluss der Natur auf die Gesundheit des Menschen. Er forderte in dieser Hinsicht auch wissenschaftlich begründete Untersuchungen des offensichtlichen Unterschieds von Berg- und Talbewohnern (Beck, Bd. I, S. 23 f. m. Anm. 110). Hin und wieder folgte er allerdings stärker den herrschenden Ansichten. Er sprach von seinem Plan, »eudiometrische Stationen in verschiedenen Klimaten und Erdhöhen anzulegen, in denen man mit gleichen Instrumenten zu gleichen Zeiten (also nach wahrer Zeit) den Luftkreis zerlegte«, und sah es gern, dass der gutmütige Pater Murith, den er in dem Hospiz auf dem St. Bernhard kennenlernte, »mit einem guten Fontanaschen Eudiometer versehen seyn« wollte. »Wo ist ein Punkt in Europa, der ein wichtigeres physikalisches und meteorologisches Observatorium seyn könnte als dieses Kloster, welches 1063 Toisen über der Meeresfläche erhoben ist, auf der Scheidewand zwischen der nord- und südeuropäischen Luftregion liegt und von mehreren wohlwollenden Menschen bewohnt ist!«159 Er sprach vom »Palmenklima« und erläuterte seine Vorstellungen von der Luftzusammensetzung in den Tropen, deren Beständigkeit wahrscheinlich der Grund sei, dass in dieser Zone soviel Krankheiten wüteten.160 Woher kam das dauerhaftere Wohlbefinden der Küstenbewohner Perus und Chiles, der Hirtenvölker auf hohen Gebirgen? Kam es daher, dass sie weniger Schwankungen des Luftdruckes ausgesetzt sind »als die cultivirten Mittelregionen der gemäßigten Zone«?161 Woher kam die schädliche Wirkung gewisser Sumpfwässer und des Regens in den Tropen? Er begnügte sich »für jetzt diese Ideen unentwickelt hinzuwerfen«. Auf seiner großen Reise hoffte er, dies alles ergründen zu können. Obgleich die Geographen seiner Zeit einfach die Prägung des Menschen durch die Natur voraussetzten, legte er sich keineswegs fest, sondern deutete nur Einzelnes als möglich an (vgl. s.o.). Er folgte z. B. Georg Forster, wenn er sagte, Fischnahrung erwecke den frühen Geschlechtstrieb. Völker, die nur von Fisch oder Fleisch lebten, seien zügellos und muskelstark; die Inder, die bloß Kräuter äßen, seien von milderer Gemütsart.162 Doch wissenschaftlich begründet fand er das alles nicht. »Möge es der Nachwelt glücken, diesen geahnten Zusammenhang zwischen der materiellen und moralischen Welt in ein helleres Licht zu setzen!«163 So steckten in diesem Buch deutlich ausgesprochene geographische Anregungen für künftige Forschungen und der Umriss einer medizinischen Geographie. Die Auswahl der Literatur deutete oft auf Westindien hin.
In den Versuchen über die chemische Zerlegung des Luftkreises und über einige andere Gegenstände der Naturlehre (Braunschweig 1799) fasste Humboldt eine Reihe bereits veröffentlichter Aufsätze zusammen, um ihnen mehr Dauer zu verleihen. Er berichtete über seine chemischen Versuche, beschrieb ein Taschen- oder Senkbarometer sowie ein Absorptionsgefäß, das besonders als Kohlensäuremesser gebraucht werden konnte, behandelte die Kohlensäure, welche im »Luftkreis« verbreitet ist, und teilte Experimente über die Beschaffenheit der Atmosphäre in der gemäßigten Zone mit – z. B. an 164 Tagen angestellte Wetterbeobachtungen in Salzburg, wobei Eudiometer, Hygrometer, Thermometer, Barometer und Elektrometer abgelesen wurden. Bei aller Vorsicht, die er geognostischen Theorien gegenüber stets bewahrte, meinte er, die gesamte Erde sei einst mit Flüssigkeit bedeckt gewesen, aus der sich das feste Land abgesetzt habe. Dabei sei Wasserstoff nach physikalischen Gesetzen frei geworden. Die Fossilien der Flözgebirge unterschieden sich von denen der ursprünglichen Gebirge und deuteten auf ein vormals wärmeres Klima des nördlichen Landes hin.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.