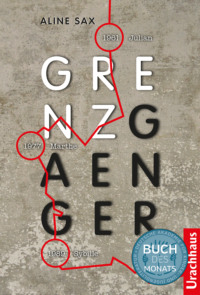Kitabı oku: «Grenzgänger», sayfa 3
SECHS
Durch die Wohnung zog Kaffeeduft, als ich am Morgen aufwachte. Statt noch eine Weile liegen zu bleiben, um die gestrigen Ereignisse zu überdenken, stand ich sofort auf.
Im Wohnzimmer saß Vater am Esstisch, vor sich eine Tasse Kaffee und eine Scheibe Schwarzbrot mit Butter und Marmelade. Und in der Hand die Zeitung, von der er bei meinem Eintreten nicht aufblickte.
»Morgen.« Ich setzte mich an meinen Platz.
Er brummte etwas vor sich hin.
Mutter kam mit der Kaffeekanne herein.
»Wie war’s in der Datsche?«, fragte ich.
»Herrlich. Marthe und Florian hatten viel Spaß. Und wir sind im See geschwommen. Die Bundmanns waren übrigens auch da.« Sie wirkte munter und aufgeräumt, ganz so als wäre überhaupt nichts passiert.
»Liegt Franziska immer noch im Bett?« Vater schlug mit einem ärgerlichen Laut die Zeitung zu. »Schlafen und faulenzen, mehr macht die zurzeit nicht.«
»Das Mädchen hat Ferien«, versuchte meine Mutter zu beschwichtigen, aber vergeblich.
»Als ich jung war, konnten wir nicht bis acht im Bett rumlungern. Da hieß es raus und arbeiten! Vor allem im Sommer, die Ernte musste rein und die Kartoffeln …«
»Franz, sie fährt bald weg, gönn ihr doch einfach die paar Tage zum Ausruhen«, unterbrach Mutter ihn.
Ich hatte gar nicht mehr daran gedacht, dass Franziska am Wochenende mit der FDJ zum Ernteeinsatz fahren würde. Im Sommer half die sozialistische Jugend bei der Ernte, das fördere den Zusammenhalt von Stadt und Land, fand die Partei.
»Wird Zeit, dass sie lernt, was Arbeiten heißt«, knurrte Vater. »Bisher hat sie mir nur auf der Tasche gelegen, und womöglich macht sie schon irgendwelchen Burschen schöne Augen …«
»Julian, du bist gestern so früh schlafen gegangen. Hast du dich nicht wohlgefühlt?«, fragte Mutter.
»Ich war nur müde.«
»Was wird jetzt mit deiner Stelle, Junge?«, hakte Vater ein, nachdem das Thema Arbeiten nun einmal auf dem Tisch war.
»Vielleicht lassen sie mich ja weiter über die Grenze.«
Aber das glaubte ich selbst nicht. Die gezückten Waffen, der Stacheldraht und die Betonpfähle hatten eine deutliche Sprache gesprochen. Die Grenze würde so schnell nicht wieder geöffnet werden.
Dennoch zog es mich dorthin. Als Vater zur Arbeit gegangen war, wusch ich mich und machte mich dann per Rad in Richtung Westen auf.
Die Aufregung vom Vortag hatte sich gelegt. Ich sah Leute, die zur Arbeit gingen oder fuhren, die vor Läden Schlange standen. Und eine Gruppe Jugendliche in FDJ-Uniform marschierte singend vorbei.
Man ließ mich nicht in den Westen. Auch nicht, als ich erklärte, ich würde dort an meiner Arbeitsstelle erwartet und bestimmt entlassen, wenn ich nicht auftauchte. Auch nicht, als ich wütend wurde und die Grenzwächter lauthals beschimpfte. Erst als sie ihre Waffen gegen mich richteten, gab ich auf. Die Grenze war zu – daran war nichts zu ändern.
Ich schwang mich auf mein Rad und fuhr davon.
Von einem Tag auf den anderen hatte ich Heike, meine Freunde und meine Arbeit verloren.
Wohin jetzt? Und was tun?
Die Zeit dehnte sich wie eine dunkle Öde vor mir aus. Ziellos fuhr ich durch die Straßen. Alles kam mir fremd vor, so als wohnte ich nicht hier, als gehörte ich nicht hierher.
»Julian!«
Erst war ich mir unsicher, ob ich mir die Stimme nicht nur eingebildet hatte.
»Julian!«
Ich drehte mich um – und sah sie! Es war keine Täuschung, keine Fata Morgana, keine Halluzination.
Da stand Heike.
Sie war hier.
Auf meiner Seite der Grenze.
Sie rannte auf mich zu und warf sich in meine Arme. Ich hielt sie fest umklammert und küsste ihr Haar, ihre Wangen, ihren Mund. »Die Grenze ist doch … bist du’s wirklich?«
»Ich bin kein Traum!« Sie lachte.
»Ich hab gestern stundenlang auf dich gewartet. Wie bist du …« »Ein paar Grenzübergänge sind noch offen«, sagte sie. »Westberliner dürfen weiterhin nach Ostberlin. Das heißt, man braucht eine Erlaubnis. Die kriegt man eigentlich nur, um Verwandte zu besuchen. Aber ich hab einfach behauptet, wir beide wären verlobt.«
Sie hielt mir die linke Hand hin, an der ein breiter goldener Ring glänzte.
»Der hat meiner Oma gehört.«
Wieder küsste ich sie. Sie war es wirklich. Und sie war hier.
Das Leben konnte weitergehen.
Mit einem Mal hatte die dunkle Öde sich in eine strahlende, von der Sonne beschienene Weite verwandelt.
SIEBEN
Der Stacheldraht wich einer Mauer. Bauarbeiter mauerten unter Aufsicht von Grenzsoldaten Hohlblocksteine auf, die uns Stück um Stück die Aussicht auf den Berliner Westen nahmen. Drüben standen Filmleute und jede Menge Neugierige dicht bei der Grenze. Wir Ostler hingegen wurden zurückgetrieben, wenn wir den Absperrungen zu nahe kamen. Hüben wie drüben hielten die Leute Ferngläser vor die Augen, wie um ein paar letzte Blicke auf den Teil Berlins zu erhaschen, der bis vor Kurzem noch problemlos zu erreichen gewesen war.
Im Westen waren große Plakate aufgestellt worden, auf denen unser System angeprangert wurde. Die DDR hielt mit flotter Musik und marxistischen Parolen dagegen. Es dauerte nicht lange, und auf der Westseite tauchten Wagen mit Lautsprechern auf dem Dach auf.
Mir platzte fast der Kopf.
Ich wandte mich ab und beschloss, nicht weiter an der Grenze herumzulungern, sondern mir zu überlegen, wie mein Leben nun weitergehen sollte.
Dass ich nicht mehr bei Reitmann & Sohn würde arbeiten können, stand fest. Aber Heike konnte ich weiterhin sehen. Jeden Abend erwartete ich sie am Grenzübergang. Im Grunde war es nicht anders als vorher, nur dass sie nun in den Osten kam statt ich in den Westen. Kino und schick essen gehen war nicht mehr drin, aber immerhin waren wir zusammen. Oft saßen wir den ganzen Abend in einer düsteren Kneipe, schmusten und redeten. Wenn der Wirt zumachte, musste Heike zurück in den Westen. Aber ich wusste, dass sie tags darauf wiederkommen würde.
Jeden Morgen zog ich guten Muts in meinem Anzug los – meinem einzigen wohlgemerkt, aber aus einem Geschäft am Ku’damm – und stellte mich bei Baufirmen vor. Ich wurde von schnippischen Sekretärinnen empfangen und wartete geduldig auf unbequemen Stühlen, bis man mich zu jemandem vorließ, der über Einstellungen zu entscheiden hatte. Manchmal musste ich einen langen Fragebogen ausfüllen, was ich gehorsam und gewissenhaft tat. Dann verschwand die Sekretärin mit dem Papier und tauchte nach wenigen Minuten wieder auf, um mir mitzuteilen, derzeit bräuchten sie niemanden. Oder meine Erfahrung würde ihren Anforderungen nicht genügen.
Ich bin gelernter Maurer! Mit sechs Jahren Berufserfahrung! Damit genüge ich jeder Anforderung!, hätte ich am liebsten gerufen, aber stattdessen bedankte ich mich artig für die Mühe und ging wieder.
Es dauerte eine ganze Weile, bis ich begriff, warum keiner mich haben wollte.
Weil ich Grenzgänger gewesen war.
Daraufhin ließ ich meinen West-Anzug im Schrank und stellte mich in abgetragener Hose und Strickjacke bei weiteren Betrieben vor. Ohne Erfolg. Ich trug »keine Berufserfahrung« in die Formulare ein oder verschwieg meine Tätigkeit für Reitmann & Sohn, wenn ich zu einem Gespräch vorgelassen wurde. Trotzdem kein Erfolg.
»Warum sind Sie gerade jetzt auf Stellensuche, Herr Niemöller?«, wurde ich des Öfteren gefragt.
Weil die Grenze dicht ist …
Keine Grenzgänger.
Ich biss die Zähne zusammen, versuchte es weiter, wurde immer wieder abgelehnt.
Aber abends war Heike da. Ihre Zärtlichkeiten lenkten mich einerseits von der Frustration ab und machten mir andererseits Mut. Irgendwann würde es schon mit einer Stelle klappen. Dann bekäme ich eine Wohnung zugewiesen, und Heike könnte zu mir in den Osten ziehen.
ACHT
Mit zwei schweren Einkaufstaschen bepackt, stieg ich sechs Stockwerke hinauf und war ziemlich außer Atem, als ich endlich vor der Wohnung stand. Auch heute war die Tür nicht verschlossen.
Ich war, wie so oft, in der Stadt unterwegs gewesen, um Arbeit zu suchen. Und plötzlich fiel mir ein, dass die alte Schulze vor Kurzem erwähnt hatte, Doktor Baumann und seine Frau seien sang- und klanglos verschwunden, hätten sich noch vor der Grenzschließung in den Westen abgesetzt. Sie wissen doch, Frau Niemöller, die Baumanns vom Thälmannplatz. Mutter hatte nur mit den Schultern gezuckt – wir kannten diese Baumanns überhaupt nicht.
Auf dem Klingelschild stand noch der Name. Und die Wohnungstür war unverschlossen.
Es war gewesen, als würde ich in ein fremdes Leben eindringen. Die Luft war abgestanden und stickig. Auf dem Küchentisch lag geöffnete Post neben einem schrumpeligen Apfel, und im Eisschrank stand sauer gewordene Milch. Im Schlafzimmer sah ich auf einem der Nachttische ein aufgeschlagenes Buch, mit dem Text nach unten. Und der Kleiderschrank war voll, ebenso der Wäschepuff – ganz so, als hätten sie überhaupt nichts mitgenommen. Kein Wunder, denn wer mit Koffern über die Grenze wollte, wurde wegen »ungesetzlichen Verlassens der DDR« festgenommen.
Erst hatte ich befürchtet, jeden Moment ertappt zu werden. Dann aber war mir eine Idee gekommen: Wenn ich schon keine Chance auf eine eigene Wohnung hatte, konnte ich mir doch nehmen, was andere nicht mehr brauchten.
Ich stellte die Taschen auf den Küchentisch. Wie lange würde es wohl dauern, bis an offizieller Stelle bekannt wurde, dass die Baumanns fort waren? Laut Frau Schulze waren sie vor ungefähr zehn Tagen gegangen. Falls sie sich Urlaub genommen hatten, konnte es noch ein Weilchen dauern, bis jemand von der Stasi hier auftauchte. Die Stromrechnung hatten sie anscheinend im Voraus bezahlt, denn das Licht ging noch, und auch das Wasser war nicht abgestellt.
Ich war in vier verschiedenen Läden gewesen, bis ich alle Zutaten beisammenhatte. Zwei Stunden und vierzig Minuten hatte ich mit Schlangestehen verbracht und danach die Taschen zu Fuß hierhergeschleppt, weil die Straßenbahn nicht fuhr.
Ich packte meine Einkäufe auf den Tisch und stellte im Kopf eine Liste dessen zusammen, was noch zu erledigen war, bevor Heike kam. Es sollte ein unvergesslicher Abend werden …
Ich ging genau nach dem Rezept meiner Mutter vor, das ich heimlich aus ihrem Kochbuch abgeschrieben hatte, und kaum eine Stunde später zog ein verlockender Duft durch die Wohnung. Ich deckte den Tisch, stellte im Wohnzimmer und im Schlafzimmer Kerzen auf und faltete Servietten zu Fächern. Um halb sechs war ich mit den Vorbereitungen fertig.
Ich ging die Treppe hinab und wartete vor dem Haus auf Heike. Um Punkt sechs bog sie um die Ecke.
»Augen zu!«, sagte ich, als wir im sechsten Stock standen. Dann führte ich sie in die Wohnung. Zündete die Kerzen auf dem Esstisch an und sagte, jetzt könne sie die Augen wieder aufmachen.
»Julian!« Überrascht schlug sie die Hand vor den Mund. »Ist das schön! Und wie gut das Essen riecht!« Sie fiel mir um den Hals und küsste mich.
»Bitte Platz zu nehmen«, sagte ich vornehm und rückte ihr den Stuhl zurecht. Dann ging ich in die Küche, drehte die Platte unter dem Kochtopf auf, trug eine Flasche Rotwein ins Wohnzimmer und schenkte uns ein.
»Wie bist du an …?«
»Die Leute, die hier gewohnt haben, sind abgehauen.« Ich hob mein Glas, um ihr zuzuprosten. »Auf uns. Und auf unsere neue Bleibe.«
Heike kicherte, als wir miteinander anstießen.
Der Schmortopf schmeckte fast genauso wie bei meiner Mutter. Heike lobte meine Kochkunst, was mich stolz machte, und plauderte dann über dies und das. Paula habe schon wieder einen neuen Freund, sagte sie, einen amerikanischen Reporter diesmal. Sie erzählte auch von Walter und dass sie im Chitchat jetzt eine neue Sängerin hätten, weil die vorige anscheinend aus Ostberlin gewesen war.
Sie redete von Menschen und Dingen, die bis vor Kurzem zu meinem Leben gehört hatten – jetzt aber nicht mehr.
Heike merkte, dass ich auf meinen Teller starrte, und sagte leise meinen Namen.
Ich blickte auf und bemühte mich um ein Lächeln.
»Ist er nett, Paulas Amerikaner?«
»Julian, du fehlst uns. Ohne dich macht es keinen rechten Spaß mehr.«
Ich biss mir auf die Lippe und rührte mit dem Löffel im Teller herum.
Heike legte ihre Hand auf meine und schaute mir in die Augen.
»Ich fühle mich so leer …« Meine Stimme klang heiser.
»Das wird schon wieder. Bestimmt hast du bald eine neue Stelle. Die Grenze ist doch auch deshalb dicht gemacht worden, weil ihr Arbeitskräftemangel habt.«
Ich schnaubte. »Den Arbeitskräftemangel wollen sie aber nicht mit Grenzgängern beheben.«
»Es klappt bestimmt bald«, sagte sie mit so viel Überzeugungskraft, dass ich gar nicht anders konnte, als ihr zu glauben. »Dann wirst du neue Kollegen haben und neue Freunde finden.«
Ich nickte. Sie hatte ja recht.
Heike stand auf, stellte sich hinter mich und legte die Arme um meinen Hals. »Und ich besuche dich weiterhin.«
Ich wandte den Kopf und küsste sie.
»Garantiert hat keiner der neuen Kollegen eine Bekannte mit einer Cousine, die so lieb und nett ist wie du.«
Sie lächelte geschmeichelt und erwiderte den Kuss.
Wir ließen den Abwasch einfach stehen. Und ich verschwendete keinen Gedanken mehr an die Baumanns oder die Stasi, als wir eng umschlungen ins Schlafzimmer stolperten. Nur noch Heike war in meinen Gedanken. Ihre warme, weiche Haut. Ihre aufregenden Formen: Brüste, Bauch, Po. Federleicht glitten meine Finger über ihren Körper.
Sie kicherte und schubste mich aufs Bett.
Die Abendsonne ließ Heikes Haut bronzefarben schimmern. Durch das offene Fenster strich Wind herein, und ich zog die Decke über uns. Weder von der Straße noch aus den Nachbarwohnungen waren Geräusche zu hören. So könnte ich ewig liegen bleiben, dachte ich, während die Sonne hinter den Häusern gegenüber versank und die Schatten im Raum sich vertieften.
Auch als es ganz dunkel war, lagen wir noch im Bett. Ich befand mich irgendwo zwischen Wachen und Schlafen, wollte aber auf keinen Fall richtig schlafen, um jede Sekunde unseres Beisammenseins auszukosten.
»So müsste es für immer sein.« Ich knipste die Nachttischlampe an.
Heike lächelte, sagte aber nichts.
»Ich meine das ernst. Zieh hierher. Dann können wir für immer zusammen sein.« Die gleiche Bitte hatte sie vor nicht allzu langer Zeit an mich gerichtet.
»Julian …« Ein Seufzer.
»Es wäre wunderbar«, fuhr ich rasch fort. »Wir hätten unsere eigene Bleibe.«
»Aber wir können doch nicht illegal hier wohnen.«
»Nur für kurze Zeit, bis wir eine Wohnung zugewiesen bekommen.«
»Julian …« Sie richtete sich ein wenig auf. »Ich hab drüben meine Arbeit. Paula. Meinen Freundeskreis. Das kann ich doch nicht alles aufgeben …«
Sie schwieg abrupt.
Hatte mich einer gefragt, ob ich – umgekehrt – alles aufgeben wollte?
»Ich kann dich jederzeit besuchen. So wie jetzt.«
»Das reicht mir nicht. Ich will immer mit dir zusammen sein.«
»Demnächst hast du wieder Arbeit, dann bist du den Tag über beschäftigt. Und abends bin ich da.«
»Ich will dich aber nicht nur abends. Ich will dich die ganze Nacht.«
Sie legte den Kopf an meine Schulter und schwieg.
Ich hätte das nicht sagen sollen. Mir war, als würde eine große Uhr überlaut ticken. Um mir klarzumachen, wie kurz bemessen unsere Zeit war. Bald musste Heike wieder über die Grenze. Es war ein wenig wie im Märchen von Aschenputtel: Jedes Mal Schlag Mitternacht war der Zauber gebrochen.
Um halb zwölf suchte sie ihre Kleider zusammen. Auch ich zog mich an, schloss das Fenster und stellte das Geschirr in die Spüle. Leise gingen wir die Treppe hinunter.
»Ich komme morgen wieder her. Versprochen.« Heike gab mir einen letzten Kuss.
»Denkst du noch mal drüber nach?«
»Ich mag dich sehr, Julian«, umging sie die Antwort.
Ich sah ihr nach, bis sie um die Straßenecke bog, und machte mich dann auf den Nachhauseweg.
Am nächsten Tag kam Heike nicht. Weder um sechs Uhr noch um sieben.
Den ganzen Abend wartete ich in der fremden Wohnung auf sie. Und grübelte. Hatte ich sie mit meinem Anliegen überrumpelt? Oder war ihr womöglich etwas zugestoßen?
Ich ging so schnell im Wohnzimmer auf und ab wie die Gedanken durch meinen Kopf rasten. Mehrmals stieg ich die Treppe hinab, hielt vor der Haustür Ausschau, ging sogar bis zur Straßenecke. Schließlich legte ich mich hin. Das Bettzeug roch noch nach ihr. Dennoch schnürte die Angst mir fast die Luft ab. Ich wollte Heike um keinen Preis verlieren.
Es wurde Mitternacht, ohne dass sie auftauchte. Todmüde schleppte ich mich nach Hause.
Als ich sie am nächsten Morgen von einer Zelle aus anrufen wollte, fiel mir ein, dass die Telefonverbindungen mit dem Westen gekappt worden waren.
Und kurz darauf hörte ich, was passiert war: Die Grenze war endgültig dicht. Nach beiden Seiten hin. Auch die Westberliner durften jetzt nicht mehr herüber.
NEUN
Berlin wurde von einer Hitzewelle heimgesucht. An den folgenden Tagen war es bis zu dreißig Grad warm. Das öffentliche Leben stagnierte. Die Leute stellten abends Stühle auf den Bürgersteig und blieben bis spät in die Nacht dort sitzen, in der vergeblichen Hoffnung, dass es abkühlte. Alte Frauen fächelten sich mit gefaltetem Zeitungspapier Luft zu, Kinder sprangen in Unterwäsche auf der Straße herum und spielten mit wassergefüllten Luftballons. Die Eisverkäufer machten schon am Vormittag das Geschäft ihres Lebens. Im Volkspark Friedrichshain war kaum mehr ein Quadratmeter Rasen frei. Die Hitze drang in die Mauern und weichte den Asphalt auf.
Ich dachte an die Grenzsoldaten, die in ihren Uniformen ausharren mussten, auch wenn ihnen der Schweiß unterm Helm hervorlief. Aber Pflicht war nun einmal Pflicht.
Ich selbst blieb zu Hause. Kam so gut wie nicht mehr aus meinem Zimmer. Die Sonne, die Fröhlichkeit und das Lärmen der Kinder waren mir zuwider. Die meiste Zeit lag ich auf dem Bett. Zu meiner Mutter hatte ich gesagt, ich fühlte mich nicht wohl. Die Luft in meinem Zimmer war schwer und stickig, aber ich konnte mich nicht aufraffen, das Fenster zu öffnen. Hatte vielmehr den Vorhang zugezogen, um mich ganz gegen die Außenwelt abzuschotten.
Ich hatte genug. Genug von der Stadt, in der ich wohnte. Genug von dem Land, in dem ich lebte. Genug von dem System, das mein Leben diktierte. Mich darüber aufzuregen, fand ich aber nicht die Kraft. Ich lag einfach nur da und suhlte mich in meinem Leid. Ließ sämtliche Erinnerungen an Heike Revue passieren, wieder und wieder, auch wenn es mir dadurch nur noch schlechter ging und das Gefühl der Leere sich ins Unermessliche steigerte.
Nur zum Essen stand ich auf. Zu trinken brachte Mutter mir ans Bett. Sie verlor kein Wort über meinen desolaten Zustand, obwohl sie den Grund dafür kannte. Durch die dünnen Wände hörte ich Vater herumschimpfen. Ich sei ein Drückeberger und solle zusehen, dass ich endlich wieder Arbeit fände. Aber Mutter sorgte dafür, dass er mich in Ruhe ließ, und sie erzählte ihm auch nichts von meinem Kummer.
Als es endlich etwas kühler wurde, fühlte ich mich wieder lebendiger, und Wut stieg in mir auf. Ich würde mich nicht unterkriegen lassen. Ich würde um Heike und um unser Glück kämpfen! Mit diesem festen Vorsatz verließ ich mein Zimmer.
ZEHN
Zwei Stufen auf einmal nehmend, hastete ich die Treppe hinauf. Ich hatte mich nicht angekündigt und hoffte darum, Rolf wäre zu Hause. Er teilte eine Neubauwohnung mit zwei Freunden, Alexander und Volker. Sie war nicht groß, hatte aber eine eigene Toilette und Zentralheizung. Ich besuchte meinen Bruder oft. Immer wenn ich es zu Hause nicht mehr aushielt, weil Vater schlechte Laune hatte oder Franziska mir auf die Nerven ging, suchte ich bei ihm »Asyl«.
Ich klopfte. Es dauerte ein wenig, dann hörte ich Schritte, und die Tür ging auf.
Rolf stand vor mir, in Unterhose, Hemd und Socken.
»Komm rein.«
Ich folgte ihm in sein Zimmer.
Rolf fragte nie nach dem Grund meines Kommens. War ich aufgebracht, dann ließ er mich schimpfen und wettern, wollte ich hingegen nichts sagen, schwieg auch er.
Er setzte sich an den kleinen Tisch am Fenster, und ich nahm, wie üblich, auf seinem Bett Platz.
Rolf griff nach der Hose, die auf dem Tisch lag, und machte sich daran, einen Knopf anzunähen.
»Ich will von hier fort«, fiel ich mit der Tür ins Haus.
Mit der Nadel zwischen den Lippen sah er mich an. »Warum das? Du bist doch gerade erst gekommen«, nuschelte er.
»Mit ›hier‹ meine ich Ostberlin. Ich will in den Westen.«
Der Gedanke war mir schon an dem Tag gekommen, als sie mit dem Mauerbau anfingen. Erst hatte er nur im Hinterkopf herumgespukt, aber seit Heike nicht mehr über die Grenze durfte, beschäftigte er mich fortwährend.
Langsam hob Rolf die Hand, nahm die Nadel aus dem Mund und legte sie ebenso langsam auf den Tisch.
»In den Westen willst du? Und das fällt dir erst jetzt ein, nachdem sie die Grenze zugemacht haben und keiner mehr rüberkann? Warum nicht vor dem 13. August, als du noch die Hälfte deiner Zeit in Westberlin verbracht hast?«
Ich ignorierte den sarkastischen Tonfall.
»Dieses Land erstickt mich.«
Er legte die Hose wieder weg und sah mich eine Weile schweigend an.
»Ich will bei Heike sein. Und ich will frei sein.« Schon im nächsten Moment kamen mir meine Worte banal vor. Wie sollte ich Rolf deutlich machen, was für eine Leere in meinem Innern herrschte?
»Alles, was mir wichtig ist, ist drüben«, ergänzte ich. »Meine Freundin, meine Kollegen, meine Arbeit …«
»Aber hier hast du deine Familie.«
Ich seufzte. »Ich weiß …« Als hätte ich mir das nicht überlegt. Jeder Entschluss für etwas ist auch ein Entschluss gegen etwas.
Rolf zündete sich eine Zigarette an und lehnte sich zurück.
»Du weißt aber schon, wie gefährlich das ist, oder? Letzte Woche ist ein Mann erschossen worden, der durch den Teltowkanal schwimmen wollte. Erschossen, Julian! Die Grenzer haben ihn vom Ufer aus einfach abgeknallt.«
Natürlich hatte ich von dem Vorfall gehört. Auf einem Flugblatt hatte gestanden: »Ein Handlanger der kalten Krieger konnte seinen Auftrag nicht zu Ende führen. Eine Laus am Körper unseres Arbeiter- und Bauernstaates wurde zerdrückt, bevor sie beißen konnte.«
»Ich bin hier unglücklich.« Ich zog die Beine hoch, zupfte an meinen Schnürsenkeln herum und fragte mich, warum ich damit überhaupt zu Rolf gegangen war. Hatte ich insgeheim auf seine Unterstützung gehofft? Was für eine Idee, wo ich doch gerade gesagt hatte, ich wollte weg – weg von der Familie, weg von ihm! Oder hatte ich etwa gehofft, er würde mir mein Vorhaben ausreden? Unsicher geworden, legte ich den Kopf auf die Knie und schloss für einen Moment die Augen.
»Und wie willst du das machen?«
Ich blinzelte überrascht.
»Ich hab mir gedacht, dass es Stellen geben muss, die ihnen entgangen sind. In nur drei Wochen kann man doch nicht ein ganzes Land lückenlos abriegeln. Und so eine Stelle muss ich finden.«
Rolf sagte nichts dazu, aber ich wusste, dass er das Gleiche dachte wie ich. Die Grenze war mit einer Mauer aus Betonblöcken und Stacheldraht gesichert und wurde von Soldaten bewacht. An der Spree und den anderen Wasserwegen patrouillierten Scharfschützen. Die Zugänge der U-Bahn-Stationen waren abgeriegelt und wurden ebenfalls bewacht.
Rolf zog an seiner Zigarette, inhalierte tief und blies den Rauch aus.
»Bist du ganz sicher, dass du das willst?«, fragte er.
»Ja.« Jetzt war ich mir meiner Sache wieder vollkommen sicher. Ich hatte mir das Ganze schon x-mal durch den Kopf gehen lassen. Und ich war hier, weil ich einen Entschluss gefasst hatte und ihn meinem Bruder mitteilen wollte.
»Ich liebe Heike wirklich, Rolf.« Meine Stimme klang heiser. »Ohne sie ist alles sinnlos. Und überleg doch mal, wie wir hier leben! Nichts als Vorschriften und Verbote! Bis hierher und nicht weiter … im wahrsten Sinn des Worts! Ich will frei sein und selber über mein Leben bestimmen.«
Rolf nahm wieder einen Zug.
»Hast du schon mit Mutter darüber gesprochen?«
»Nein. Die Eltern dürfen nichts erfahren, sonst macht man sie später mitverantwortlich.«
Die Wohnungstür ging, und im Flur waren Schritte zu hören.
»Honey, we’re hoo-ome!«, rief Rolfs Mitbewohner Alex, und Sekunden später steckte er den Kopf herein. »Hast du schon gegessen? Wir haben Hähnchen und Bier geholt. Ach, da ist ja Julian. Bleibst du zum Essen?«
»Nein danke.« Ich stand auf. Jetzt konnten wir ohnehin nicht mehr ungestört reden.
»Hast du morgen Zeit?«, fragte Rolf.
Ich verzog das Gesicht. »Ich hab immer Zeit. Mich will ja keiner einstellen.«
»Gut, komm am Abend her, dann reden wir weiter.« Er stand ebenfalls auf und klopfte mir auf die Schulter.
»Danke. Ich … äh …«
Rolf fasste mich am Arm und zog mich zur Tür. »Bis morgen.«
Draußen auf der Straße holte ich tief Luft. Ich würde es tun. Auf jeden Fall! Wie zur Bekräftigung klatschte ich mit der flachen Hand gegen die Tür. Dann nahm ich mein Rad, das an der Hauswand lehnte, schwang das Bein über die Stange und sauste davon.