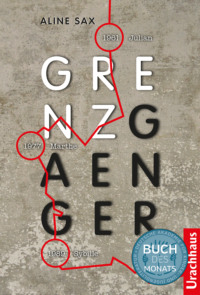Kitabı oku: «Grenzgänger», sayfa 4
ELF
Beim Abendessen plagten mich Schuldgefühle. Ich saß neben Vater und gegenüber Mutter. Franziska war bei einer Freundin. Im Radio liefen die Nachrichten, aber ich bekam kaum etwas davon mit. Ich konnte einzig und allein an mein Vorhaben denken und welchen Einfluss es auf das Leben meiner Eltern haben würde. Und dass sie von alldem nichts ahnten …
Mutter schöpfte schweigend die Suppe aus. Als sie merkte, dass ich ihr zusah, lächelte sie mich an. Mein Herz krampfte sich zusammen.
Vater hatte sein gesundes Ohr dem Radio zugewandt und begann mechanisch zu löffeln. Dass er schlürfte, schien er gar nicht zu merken. Wahrscheinlich würde es auch ihm leidtun, wenn ich fort war, auch wenn er sich nichts würde anmerken lassen. Er würde etwas Unverständliches brummen und das Radio anschalten, um die Stille zu durchbrechen. Das Radio war seine Zuflucht in allen Lebenslagen.
Schon öfter hatte ich mich gefragt, wie er früher gewesen war, vor dem Krieg, als er Mutter kennenlernte. Der Krieg hatte ihn verändert, keine Frage. Auch an meiner Mutter waren diese Jahre nicht spurlos vorbeigegangen. Sie hatte mit drei kleinen Kindern allein dagestanden, zum Kriegsende hin in einer schwer umkämpften Stadt. Ich wusste noch, dass sie große Angst vor den Russen gehabt hatte, nicht aber, wie sie damit fertiggeworden war. Seltsam, dass man die eigenen Eltern immer nur in ihrer Elternrolle wahrnimmt und nicht ahnt, wie sie als Mann und Frau, als Freund und Freundin, als Bruder oder Schwester sind oder waren.
Auch Mutter hatte zu essen begonnen.
Sie würde mir am meisten fehlen …
Trotzdem fühlte es sich richtig an. Ich wollte mein Leben nicht in einer Stadt verbringen, in der bewaffnete Soldaten bestimmten, wo ich zu gehen und zu stehen hatte, wo eine Grenze aus Steinen und Stacheldraht mich von Heike trennte. Ich musste und wollte fort, und ich würde es schaffen.
Ein Klopfen an der Wohnungstür.
Ich ging öffnen.
»N’Abend, Julian.« Frau Schulze drängte sich an mir vorbei und steuerte auf unser Wohnzimmer zu.
»Ach, ihr seid gerade beim Essen«, sagte sie.
Was sonst – um sechs Uhr abends?
»Ich störe hoffentlich nicht?« Sie saß bereits, noch ehe Mutter den Mund aufmachen konnte. »Haben Sie schon gehört, dass die Baums, also Heinz Baum und seine Frau, ihr Auto bekommen haben? Dabei standen sie erst drei Jahre auf der Warteliste. Da fragt man sich doch, wo die sich lieb Kind gemacht haben. Denn so, wie ihr Sohn sich benimmt … eine Schande ist das … gegen alle sozialistischen …«
Weil ich ihr Geschwätz nicht mehr hören mochte, schaltete ich auf Durchzug. Ich sah nur noch die Mundbewegungen, ließ ihre Worte nicht in mein Gehirn dringen. Das mit ganz anderen Dingen beschäftigt war. Die Schulze würde ich jedenfalls nicht mehr lange zu ertragen brauchen. Schon öfter hatte ich überlegt, ob sie uns wohl im Auftrag der Partei indoktrinierte. Was mich nicht wundern würde. Die alte Schulze als Instrument der Partei … bei diesem Gedanken musste ich grinsen. Vielleicht war sie gar kein Mensch aus Fleisch und Blut, sondern ein Roboter, der eingespeicherte Propagandatexte abspulte.
Niemand achtete auf mich, als ich aufstand, meine Jacke anzog und die Wohnung verließ.
»Willst du immer noch in den Westen?«, fragte Rolf, als wir in seinem Zimmer saßen.
»Ja, ich hab mir das gut überlegt.«
Er blickte von der Zigarette auf, die er gerade drehte, und musterte mich eingehend.
Wahrscheinlich würde er gleich sagen, dass ich dann meine Familie nicht mehr sehen könnte und Mutter furchtbar wehtun würde.
Aber er schwieg.
»Ich finde schon eine Möglichkeit. Irgendwo muss eine Schwachstelle sein, und die muss ich finden, ehe sie selber darauf aufmerksam werden. Also habe ich nicht viel Zeit. Je länger ich warte …«
»Ich gehe mit.«
Entgeistert starrte ich ihn an.
»Ich gehe mit«, wiederholte Rolf mit fester Stimme.
»Aber du … hast doch gesagt … Mutter …«
»Mutter wird’s überleben. Um dich mache ich mir mehr Sorgen als um sie. Das Ganze ist kein Ausflug, Julian, sondern brandgefährlich. Zu zweit haben wir bessere Chancen.«
»Aber du hast doch dein Leben hier.«
»Ich lass dich auf keinen Fall allein gehen.« Rolf lehnte sich zurück. »Seit gestern Abend habe ich nachgedacht. Über das, was du gesagt hast, von wegen selber über sein Leben bestimmen. Ich will mit – wir machen das zu zweit.« Er leckte das Papierchen an, drückte es fest und legte die Zigarette auf den Tisch.
Ich konnte kaum glauben, was er gesagt hatte. War ich doch nur hergekommen, um mich noch einmal zu versichern, dass mein Entschluss stand, und um vielleicht ein paar Tipps von ihm zu bekommen. Aber nun wollte er mit!
Mir fehlten die Worte. Einfach nur danke sagen, schien mir zu banal, zumal er bereit war, sein Leben für mich zu riskieren.
»Außerdem würde ich gern mal Paris sehen.« Rolf zündete die Zigarette an, nahm einen Zug und blies den Rauch zur Decke. »Und das Nordlicht. Und das Mittelmeer.«
Ich lächelte. All das würde möglich sein …
»Die Frauen in Italien, von denen heißt es doch, dass sie besonders heißblütig sind. Davon möchte ich mich gern überzeugen.« Rolf grinste. »Und dann erzähl ich dir davon, denn das mit Heike …« Er wiegte scheinbar nachsichtig den Kopf.
ZWÖLF
Ich würde sie finden, die Schwachstelle, die sie übersehen hatten. Immer wieder ging ich an der Grenze entlang, schätzte den Abstand zwischen den Bewachern, versuchte herauszufinden, ob sie nach einem bestimmten Muster patrouillierten, merkte mir, wo Hunde eingesetzt wurden und wo noch Bauarbeiter beschäftigt waren.
Fast täglich berichtete das Westradio von Fluchtversuchen. In der DDR wurde darüber geschwiegen. Nur wenn es Zeugen gegeben hatte, stand in der Zeitung eine Kurzmeldung, von wegen, dass wieder ein Spion versucht habe, sich in den kapitalistischen Westen abzusetzen. Die meisten Fluchtversuche, so schien es mir, waren nicht gut geplant, sondern Verzweiflungstaten. Die Leute versuchten, über die Mauer zu klettern oder durch den Kanal zu schwimmen, und gingen damit ein hohes Risiko ein. Ich würde es anders machen, würde einen ausgeklügelten Plan entwerfen, der gute Chancen auf Erfolg hatte.
An vielen Stellen war die Mauer inzwischen mannshoch und versperrte den Blick in den Westen. Drüben hatte man hier und da Holzplattformen gebaut, auf denen Leute standen, die riefen und winkten. Oder einfach nur herüberschauten. Ich ignorierte sie, weil sie mich nervös machten. Die Grenzwächter hingegen behielten sie mit Ferngläsern im Auge und warfen, wenn sie provoziert wurden, mit Steinen. Als ich auf einem der Podeste Männer mit Filmkameras erspähte, brachte ich mich rasch außer Sichtweite.
Ein Stück weiter war die Mauer niedriger; dort konnten Ost und West einander noch in die Augen schauen. Ich sah ein Brautpaar auf der Westseite, weinend und mit ausgestreckten Armen. Und hier, auf unserer Seite, ein Grüppchen in Festtagskleidung. Der Grenzer schaute sich verstohlen um und dann demonstrativ weg. Sofort gingen die Ostler bis zur Mauer und fassten darüber hinweg die Hände der Jungverheirateten. Eine Hand mit einem Ring wurde in die Höhe gehalten. Ich sah, wie es im Gesicht des Grenzers zuckte. Offenbar war ihm klar geworden, was diese Mauer anrichtete. Nach ein paar Minuten jedoch wurde er unruhig und forderte die ostdeutsche Familie mit barschen Worten auf zurückzutreten.
In der Bernauer Straße, so hatte ich gehört, verlief die Grenze unmittelbar an den Häusern entlang. Die Häuser selbst gehörten zum Osten, der Bürgersteig davor aber zum Westen. Ich folgte der Ruppiner Straße bis zur Kreuzung mit der Bernauer Straße und sah eine schulterhohe Absperrung. In einiger Entfernung von den Grenzwächtern blieb ich stehen, den Blick auf das vierstöckige Eckhaus gerichtet. Im Erdgeschoss befand sich eine Eisenwarenhandlung, deren Zugang auf der Westseite lag. Der Laden war leer geräumt. Mir fiel ein Kellerschacht auf. Ein Kellerschacht im Osten … und ein Zugang im Westen …
Mir kam eine Idee, nebulös noch, aber ehe sie Form annehmen konnte, fuhren zwei Lastwagen vor, einer mit Soldaten, der andere leer, und hielten vor dem Haus, das ich im Visier hatte. Die Soldaten sprangen herab und liefen in das Gebäude. Ich trat ein paar Schritte zurück und sah, dass drüben im Westen etliche Schaulustige stehen geblieben waren.
Bald kamen die Soldaten wieder aus dem Haus. Sie schleppten Möbel, die sie auf die Lastwagen luden. Ihnen folgten die Bewohner, viele mit Koffern. Sie wurden aufgefordert, die Wagen zu besteigen.
»Hier ist es gefährlich, aber wir bringen Sie in Sicherheit, Sie brauchen keine Angst zu haben«, sagte einer der Männer zu einer alten Frau. Sie schien seine Worte gar nicht wahrzunehmen, blieb mitten auf der Straße stehen und starrte wie abwesend das Haus an.
Zu gefährlich, dachte ich, zu gefährlich für unseren Staat. Zu gefährlich, weil diese Leute versuchen könnten zu fliehen. Ich biss mir auf die Lippe.
Hinter der alten Frau waren noch mehr Personen aus dem Haus gekommen, alle mit bedrückten Gesichtern. Es fiel ihnen sichtlich schwer, ihr Zuhause zu verlassen. Ein kleines Mädchen auf dem Arm seiner Mutter kreischte in den höchsten Tönen: »Felix! Felix!« Und es streckte die Ärmchen in Richtung Haustür.
Die Mutter versuchte, das Kind zu beschwichtigen. »Felix wird bald bei uns sein, Liebes. Ganz bestimmt.«
Aber die Kleine war untröstlich.
»Wir kommen jeden Tag her und schauen nach, ob er da ist«, versprach die Mutter. Dann half ein Soldat ihr auf den Lastwagen.
Mit einem Mal entstand jenseits der Mauer Unruhe. Die Leute, die sich dort eingefunden hatten, blickten alle in die Höhe.
Ich ebenso. Und auch die Grenzwächter.
An einem Fenster im dritten Stock bewegte sich etwas. Ich konnte aber nicht genau sehen, was dort passierte. Ein Grenzer machte den Soldaten ein Zeichen. Daraufhin stürmten zwei von ihnen ins Haus. Von Westen her aufgeregte Rufe. Ein Feuerwehrauto fuhr drüben vor. Was war da los? War Feuer ausgebrochen? Ich sah weder Flammen noch Rauch, und es lag auch kein Brandgeruch in der Luft. Weil die Grenzwächter weiterhin nach oben starrten, wagte ich mich etwas näher heran und bemerkte, dass die Feuerwehrleute ein Sprungtuch ausbreiteten. Als ich den Blick wieder hob, sah ich sie: eine alte Frau, die im dritten Stock auf den Fenstersims geklettert war. Zu springen traute sie sich aber nicht, obwohl die Zuschauer sie anfeuerten. Sie blickte in die Tiefe und dann über die Schulter in ihre Wohnung. Hinter ihr erschien ein Arm in Uniform, der die Frau packte. Die Soldaten versuchten anscheinend, sie vom Fenster wegzuziehen. Die alte Frau setzte sich zur Wehr, verlor das Gleichgewicht und fiel. Fiel neben das Sprungtuch.
Ich hatte den Aufprall nicht gesehen, wohl aber gehört.
Oben steckte ein Soldat den Kopf aus dem Fenster, zog ihn aber gleich wieder zurück.
Die Grenzwächter gestikulierten aufgeregt zu den Lastwagen hin, die sogleich losfuhren, damit die Nachbarn der alten Frau nichts mehr von dem Drama mitbekamen.
Dann bemerkte einer von ihnen mich und gab mir mit einer Gebärde zu verstehen, ich solle machen, dass ich fortkomme. Wie betäubt drehte ich mich um und ging davon.
Tags darauf ging ich wieder zu dem Haus, um mir noch einmal zu vergegenwärtigen, was da geschehen war. Und dass ich einen Plan brauchte, einen wasserfesten Plan. Auf keinen Fall durfte Verzweiflung meine Triebfeder sein.
Schon von Weitem sah ich die Bauarbeiter. Sie trugen Steine und Zement ins Haus, um die nach Westen gerichteten Fenster zuzumauern. Der Kellerschacht war bereits verschlossen. Und damit war die Fluchtmöglichkeit, die ich ins Auge gefasst hatte, dahin.
DREIZEHN
Ich drehte mein Glas in den Händen und bedauerte, dass ich kein Buch mitgenommen hatte. Es würde noch über eine Viertelstunde dauern, bis Rolf kam, und ich fühlte mich höchst unwohl, weil ich glaubte, Verdacht zu erregen, indem ich allein hier herumsaß. Im Grunde blödsinnig. Denn schließlich war es normal, dass jemand in einer Kneipe saß und auf eine Verabredung wartete. Auf Freunde, auf die Liebste, auf wen auch immer … Dass ich auf meinen Bruder wartete, um unsere Republikflucht zu besprechen, wie es im Stasi-Jargon hieß, konnte keiner ahnen. Dennoch machte ich mir Sorgen. Auch in der Planungsphase auffliegen konnte Zuchthaus bedeuten, zumindest aber den Verlust sämtlicher Zukunftsperspektiven.
Ich schluckte. Wenn ich jetzt schon nervös war, was sollte dann, um Himmels willen, werden, wenn …
Ich nahm einen großen Schluck Bier und versuchte, an etwas anderes zu denken.
Mein Blick glitt über die Fensterscheiben, auf die der Regen feine, schräge Striche zeichnete. Und dann zu den Tischen, die alle besetzt waren. Zur Straßenseite hin saßen zumeist Pärchen, weiter hinten größere Gruppen an langen Tischen zwischen hölzernen Trennwänden. Ich hatte mir einen Platz etwas abseits ausgesucht, damit niemand unser Gespräch mithören konnte.
Die Bedienung eilte geschäftig hin und her, ohne auf mich zu achten. An der Theke linkerhand warteten etliche Leute darauf, dass ein Tisch frei wurde, und ich hoffte, keiner würde auf die Idee kommen zu fragen, ob er sich bei mir dazusetzen könne.
Mein Blick blieb an einer jungen Frau hängen, die an der Theke saß. Sie wandte mir den Rücken zu und wirkte irgendwie isoliert, schien in ihr Glas zu starren. Ihre langen blonden Locken erinnerten mich an Heike.
Ob Heike wohl ahnte, dass ich mich nicht mit der Situation abfinden würde? Dass ich plante, in den Westen zu kommen? Würde sie auf mich warten? Was, wenn sie davon ausging, wir wären auf immer getrennt, und die Hoffnung aufgegeben hatte, mich je wiederzusehen? Dieser Gedanke schnürte mir die Kehle zu.
Wieder nahm ich einen großen Schluck, aber der Kloß im Hals ließ sich nicht wegspülen. Wir mussten uns beeilen, Rolf und ich. Gestern hatte er gesagt, er wüsste vielleicht eine Möglichkeit. Hoffentlich etwas, das sich schnell umsetzen ließ. Es war jetzt schon einen Monat her, dass mit dem Mauerbau begonnen wurde. Jeder weitere Tag, den wir warteten, verringerte unsere Chancen.
Die Türglocke schlug an. Unwillkürlich schaute ich hin und sah Wolfgang Wichser. Was, verdammt noch mal, hatte der hier zu suchen?
Er klopfte erst seine nasse Uniform ab, dann sah er sich um. Ich duckte mich und versuchte gleichzeitig, ihn im Auge zu behalten. Er fuhr sich durch die Haare, knöpfte dann die Jacke auf und kam mit großen Schritten in meine Richtung.
Auch das noch!
Wenn ich jetzt aufstand und auf die Toilette ging, würde er garantiert aufmerksam, darum machte ich mich so klein wie nur möglich. Und stellte fest, dass er gar nicht auf mich zusteuerte, sondern sich neben das Mädchen mit den blonden Locken an die Theke setzte und ein Getränk bestellte.
Ich kam mir so blöd vor, dass ich mich selbst hätte ohrfeigen können.
Nun, da er mir den Rücken zukehrte, richtete ich mich wieder auf.
Er hatte inzwischen ein Bier vor sich stehen und sagte etwas zu dem Mädchen. Als sie ihm das Gesicht zuwandte, erhaschte ich einen Blick darauf. Sie war schön, wenn auch nicht so schön wie Heike. Wie sie wohl aussehen mochte, wenn sie lachte? Jetzt aber wirkte sie müde und erschöpft, hatte dunkle Schatten unter den Augen, und die Mundwinkel waren herabgezogen.
Wolfgang redete weiter auf sie ein. Sie bemühte sich um Freundlichkeit, aber ihr Blick verriet, dass sie lieber ihre Ruhe haben wollte. Was Wolfgang komplett ignorierte. Er bestellte ein Getränk für sie, obwohl sie abwinkte. Und erzählte ihr dann offenbar Witze, denn er lachte selbst in einem fort. Das Mädchen drehte sich wieder zur Theke hin – ein Wink mit dem Zaunpfahl, den Wolfgang aber nicht verstand. Er zündete sich eine Zigarette an und hielt ihr seine Packung hin. Sie lehnte ab und sagte etwas, das Wolfgang amüsierte, denn er lachte lauthals. Und legte die Hand auf ihren Unterarm. Sie zuckte zusammen, schüttelte ihn aber nicht ab. War sie zu höflich, um ihn abzuweisen? Oder traute sie sich seiner Uniform wegen nicht?
Sie tat mir leid, und ehe ich mich’s versah, war ich aufgestanden und zu den beiden hingegangen.
»N’Abend«, sagte ich betont locker zu dem Mädchen. »Tut mir leid, dass ich zu spät dran bin.«
Sie warf mir einen verwunderten Blick zu, erwiderte aber nichts. Ich betrachtete Wolfgangs Hand auf ihrem Arm. »Sag mal, was fällt dir eigentlich ein? Pfoten weg!«
Reflexartig zog er die Hand fort, dann erst schien er zu merken, wer ihm gegenüberstand.
»Sieh an, unser Grenzgänger! Oder sollte ich besser sagen: Ex-Grenzgänger?«
»Da drüben ist was frei«, sagte ich zu der Blonden und machte eine Kopfbewegung zu dem Tisch hin, von dem ich eben aufgestanden war.
»Warum bist du nicht drüben bei deiner Westhure?«, fragte Wolfgang anzüglich. »Ach so, das geht ja nicht mehr. Jetzt musst du dich mit Ost-Frauen begnügen.« Er grinste hämisch.
Ich biss die Zähne zusammen. Ihm eine reinzuhauen, hilft nichts, sagte ich mir.
Das Mädchen war vom Barhocker gerutscht und machte Anstalten, mit mir zum Tisch zu gehen, doch Wolfgang stand auf und vertrat ihr den Weg.
»Willst du dich wirklich mit so einem Profiteur abgeben?«, fragte er herausfordernd.
»Halt’s Maul, Wolfgang Wichser!« Es war mir herausgerutscht, ehe ich mich’s versah. Ich hielt die Luft an und machte mich auf einen Fausthieb gefasst, doch Wolfgang war anscheinend zu perplex, weil ich es gewagt hatte, den alten Spottnamen zu gebrauchen.
Ich nutzte die Gelegenheit, fasste das Mädchen bei der Hand und zog sie mit zu meinem Tisch.
Dort setzten wir uns einander gegenüber.
Wolfgang sandte uns noch einen drohenden Blick, drehte sich dann aber um und bestellte ein neues Bier.
»Danke«, sagte das Mädchen leise, den Blick auf die Tischplatte gerichtet.
»Keine Ursache. Ich hab ja gesehen, dass du nichts mit dem Kerl zu tun haben wolltest.«
»Du kennst ihn?«
»Ja. Ein Klassenkamerad von früher. Unangenehmer Bursche.« Sie lächelte.
»Das hab ich gemerkt.«
»Große Klappe, nichts dahinter.«
»Bist du …« Sie sah mich an. »Bist du wirklich Grenzgänger?« Es klang nicht abfällig, sondern neugierig.
»Ich war es. Bis sie die Grenze zugemacht haben. Seitdem bin ich arbeitslos. Hier im Osten will mich keiner haben.« Ich nahm einen Schluck von meinem inzwischen lauwarmen Bier. »Soll ich dir was zu trinken bestellen?«
Sie nickte, und ich winkte der Bedienung.
»Kennst du viele Leute im Westen?«, fragte sie.
»Meine ehemaligen Kollegen. Ein paar Freunde. Und meine Freundin wohnt auch drüben.« Der Gedanke an Heike ließ mich aufseufzen. »Aber jetzt habe ich keinen Kontakt mehr.«
»Auch nicht zu deiner Freundin?«
Ich schüttelte den Kopf. Und merkte nicht einmal, dass die Bedienung an unserem Tisch vorbeiging, ohne uns zu beachten.
»Mein Freund ist auch im Westen«, sagte sie nach ein paar Sekunden.
So leise, dass ich mir nicht sicher war, ob ich richtig gehört hatte. Aber als ich sie anschaute, sah ich Tränen in ihren Augen. Mir war auch zum Heulen zumute, aber was würde es nützen, wenn wir zu zweit flennten?
»Seit Kurzem erst«, fügte sie – noch leiser – hinzu.
»Wie? Seit Kurzem erst?« Ich beugte mich über den Tisch.
Sie wischte sich die Augen und warf einen schnellen Seitenblick zur Theke, wo Wolfgang uns nach wie vor den Rücken zukehrte. »Er ist geflohen.«
»Wann?«
»Am Freitag.«
Ich starrte sie an. Ihr Freund war geflohen? Vorgestern erst … Wie hatte er das gemacht? Am liebsten hätte ich ihr hundert Fragen auf einmal gestellt, aber ich schwieg, weil ich das Gefühl hatte, es wäre besser, sie reden zu lassen – falls sie wollte.
Und dann fing sie auch schon an. »Eigentlich sollte ich nicht mir dir darüber sprechen, wo ich dich doch überhaupt nicht kenne. Vielleicht arbeitest du für die Stasi. Aber so siehst du nicht aus.« Ein flüchtiges Lächeln. »Und Stasi-Leute sind ja wohl keine Grenzgänger, oder? Außerdem muss ich einfach mit jemandem darüber reden. Es macht mich völlig fertig, dass mein Freund fort ist. Und dass ich es keinem sagen darf … niemand darf wissen, dass ich …«
Ich griff nach ihrer Hand. Weil sie mir leidtat, vor allem aber, weil ich begierig darauf war, mehr zu erfahren.
»Wie ist er geflohen?«, fragte ich.
»Durch die Kanalisation.«
Dass wir daran nicht gedacht hatten! In der Kanalisation gab es jede Menge Ost-West-Verbindungen.
»Er hatte Kontakt mit Studenten im Westen. Die haben die Flucht organisiert. ›Unternehmen Reisebüro‹ nennen sie sich. Sechs Leute können jeweils rüber. Und dann haben sie noch einen Helfer, der den Gullydeckel wieder zumacht, wenn die anderen drunten sind. Es läuft nämlich so, dass man in der Nacht nicht weit von der Grenze in die Kanalisation einsteigt. Im Westen wartet dann einer, der einen aus dem Labyrinth rausführt.«
Das klang ebenso einfach wie einleuchtend.
»Und warum bist du nicht mitgegangen?«, konnte ich mich nicht enthalten zu fragen.
Wieder kamen ihr die Tränen.
»Wir beide sind als Letzte zu der Gruppe gestoßen, und da waren sie schon zu fünft: vier Frauen und ein Mann. Also konnte nur einer von uns mit, und sie haben sich für meinen Freund entschieden.«
Ich war unschlüssig. Sollte ich ihr verraten, dass auch mein Bruder und ich fliehen wollten? Vielleicht könnten wir sie ja mitnehmen? Andererseits kannte ich sie nicht … Dass sie sich mir, einem völlig Fremden, anvertraute, war mehr als unvorsichtig. Oder aber es verhielt sich so, dass sie für die Stasi arbeitete und mich aushorchen wollte.
»Ich stehe jetzt auf der Warteliste«, fuhr sie fort.
»Es sind also noch weitere Fluchten durch die Kanalisation geplant?«
Sie nickte.
Ich konnte es kaum fassen – das war ja gerade, als bekäme man die ideale Lösung auf dem Tablett serviert.
»Wann die nächste Gruppe geht, weiß ich aber nicht.«
»Störe ich?«
Ich fuhr zusammen und sah dann zu meiner Erleichterung, dass Rolf neben unserem Tisch stand. Erst jetzt wurde mir klar, dass das Mädchen und ich die ganze Zeit die Köpfe zusammengesteckt hatten.
Sie starrte Rolf an und schlug die Hand vor den Mund.
»Keine Sorge, das ist mein Bruder«, sagte ich.
»Tut mir leid, dass ich verspätet bin.« Rolf wollte sich neben mich setzen.
»Warte, wir gehen besser woandershin.« Ich stand auf.
Hier unsere Flucht besprechen, mit Wolfgang Wichser in ein paar Metern Abstand, war undenkbar.
»Ich geh dann mal.« Auch das Mädchen erhob sich.
»Komm doch mit.«
Sie schüttelte den Kopf.
»Ich muss nach Hause, wirklich. Es ist schon spät, und ich muss morgen früh raus, arbeiten.« Sie nahm ihre Tasche. »Danke fürs Zuhören.«
Sie lächelte mich an, schien einen Moment zu überlegen, ob sie mir die Hand geben sollte, ließ es aber und ging zur Tür.
»Warte!« Ich rannte ihr nach.
Draußen packte ich sie am Arm. Als sie mich erschrocken ansah, ließ ich sie los.
»Wir wollen auch fliehen!«, stieß ich hervor. »Geh jetzt nicht weg, bitte!«
Mit großen Augen sah sie mich an, den Blick voller Zweifel.
»Vielleicht können wir einander ja helfen. Ich heiße Julian. Julian Niemöller.« Dass es riskant war, nach dieser Eröffnung meinen Namen zu nennen, war mir klar. Falls sie für die Stasi arbeitete, würde ich in Teufels Küche kommen. Aber falls nicht, sah sie darin vielleicht einen Vertrauensbeweis.
»Ich muss nach Hause.«
»Dann lass uns ein andermal weiterreden, ja?« Fast schon flehentlich sah ich sie an.
Sie überlegte einen Augenblick.
»Kennst du den Friedhof an der Boxhagener Straße?«, fragte sie.
Ich nickte. Wo die Boxhagener Straße war, wusste ich. Und den Friedhof würde ich schon finden.
»Kommenden Sonntag um sieben abends.«
»Gut, mein Bruder und ich werden da sein.«
»Aber jetzt … muss ich wirklich …«
»Ich sage keinem ein Wort, du kannst dich auf mich verlassen.« Sie lächelte mir flüchtig zu, dann ging sie davon.
»Was war das denn?« Rolf stand hinter mir.
Breit grinsend drehte ich mich um. »Wir haben eine Verabredung«, sagte ich. »Nächsten Sonntag um sieben auf dem Friedhof an der Boxhagener Straße. Dort erfahren wir mehr über den genialsten Fluchtplan aller Zeiten.«
Rolf machte eine skeptische Miene.
»Komm, wir gehen zu dir«, sagte ich. »Dann erzähle ich dir von dem Mädchen, das Heike ähnlich sieht, aber nicht Heike ist.«