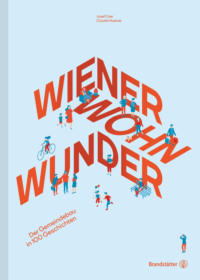Kitabı oku: «Wiener Wohnwunder», sayfa 4
JUSTGASSE
Nie lockerlassen

In der Justgasse in Floridsdorf wird begeistert gebastelt, die beteiligten Damen führen dabei auch ordentlich Schmäh, wie es sich gehört, und wirken überhaupt ziemlich unerschütterlich. Und während man gemeinschaftlich einer handwerklichen Tätigkeit nachgeht, lassen sich natürlich auch gut Geschichten erzählen. Über das Thema Tod im Gemeindebau wird sonst nicht so viel gesprochen, aber natürlich kommt es regelmäßig vor, dass alte, alleinstehende Menschen in ihren Wohnungen versterben. Wie rasch das entdeckt wird, hängt auch von der Qualität der Hausgemeinschaft und der Achtsamkeit anderer Mieterinnen und Mieter ab.
Das erhellt die folgende Geschichte einer Dame, die nicht lockerließ, bevor nicht in der Wohnung ihrer Nachbarin Nachschau gehalten wurde:
„Uns is wichtig, dass wir voneinander wissen, wie’s uns geht. Das hab ich von meiner Mutter gelernt, die bei uns im Haus auf die ganzen alten Leut aufgepasst hat. Ich weiß ja nicht, ob ich das erzählt hab, aber: Die bei uns da auf der Stiege gestorben ist, da ham’s mi ja scho hoibert zum Psychiater führn woin, wie i gsogt hob: ‚I sich die Frau ned, I sich die Frau ned, da is wos passiert.‘ Olle ham gsogt, in bin spinnert, owa Tatsache is, dass die Frau wirklich tot in der Wohnung glegn is. Es hot niemanden interessiert, ned amoi die Polizei. Wei wie i dort angruafn hob, hot mir der Polizist gsogt: ‚Wann wir die Tür aufmochen und es is nix, dann miassn Sie des Schloss zoin.‘ Und i hob gsogt: ‚Kommt ma billiger ois Schloftabletten.‘ Wie i hob ned schlofen kennan wegen der Gschicht. Dann ham’s einebohrt, die Tür is aufgangen, is aber ned aufgsprungen, wei’s von innen zuagsperrt wor. Und wie i des gsehn hob, hab i mi umdraht und hob mi recht freindlich von dene verobschiedet. Und der Polizist hat gsagt: ‚Sie miassn do bleiben und die Frau identifizieren.‘ Hob i gsogt: ‚Gor nix muass i. I hob eich aufmerksam gmocht, i bin ned verwandt mit ihr, i bin ka Amtsperson, meins is gmacht, i geh.‘ Da war die Polizei sehr böse auf mich. Aber i hab die Nachbarin vier Wochen davor das letzte Moi no gsehn, da hat’s Geburtstag ghobt und a Piccolo-Flascherl Sekt getrunken. Do hob i owa scho zwa Wochen danoch an Mann mit ana Leiter organisiert, dass der durchs Fenster eineschaut – nur hot’s der ned gseng, weiß hinterm Bett glegn is. Aber i hab nicht schlafen können, weil i gewusst hab, do stimmt wos ned. Und des Komische is: Do wor a Hund in der Wohnung: Der hat nicht gebellt …“
BOSSIGASSE
In der Mitte der Gemeinschaft
Es gibt in Wien viele engagierte Mietervertreterinnen und Mietervertreter – und dann gibt es Frau Lenikus und Herrn Zaufal.
In ihrem Wohnhaus in der Bossigasse 18–22 in Hietzing heben sie Engagement auf ein neues Level, indem sie nicht nur das von wohnpartner ins Leben gerufene Programm „Willkommen Nachbar“ fleißig umsetzen, bei dem Neuzugänge im Haus begrüßt werden. Nein, die beiden Mietervertreter haben darüber hinaus ihr eigenes, noch einen Schritt weiter gehendes Konzept kreiert: „Wir haben das ‚Hallo Du‘ getauft, und der Sinn davon ist, dass sich zumindest die Leute auf der Stiege kennenlernen, wo der Neuzugang einzieht“, erklärt Mieterbeirat Hans Zaufal. Seine Stellvertreterin Regina Lenikus ergänzt: „Wir versuchen dann zu einem Austausch bei Kaffee und Kuchen einzuladen und so eine Gelegenheit für ein gegenseitiges Kennenlernen zu schaffen.“
Als Herr Zaufal erzählt, wie er 1976 in die Bossigasse kam, verspricht er sich gleich einmal in, wenn man so möchte, Freud’scher Manier: „Ich selber hab den Gemeindebau geheiratet – nein, meine Frau hab ich geheiratet im Jahr 1976 – und bin in die Wohnung meiner Frau hierhergezogen.“ Regina Lenikus wiederum lebt zwar schon seit ihrer Kindheit im Gemeindebau, zog aber erst im Jahr 2002 in der Bossigasse ein. Beide vereint, dass das Gemeinschaftsgefühl im Gemeindebau für sie an erster Stelle steht: „Ich bin im 8. Bezirk aufgewachsen, da gab’s nur vier Stiegen mit je sechs Stockwerken, alle kannten sich, man war überall zu Hause. Wir versuchen auch hier mit den Mietern viel zu machen, aber es sind doch 190 Wohneinheiten, da ist es nicht so leicht. Wir haben hier aber viele Grünanlagen und viele Neuzugänge mit Kindern, was das Ganze verjüngt“, erzählt Frau Lenikus. Herr Zaufal ergänzt, dass es mit den alteingesessenen Mieterinnen und Mietern gerade in puncto Gemeinschaft manchmal nicht so einfach sei: „Manche sehen das dann fast schon als ihr Eigentum, weil sie schon so lang da wohnen, und wollen, dass alles passiert, was sie sagen. Das kann dann natürlich zu Konflikten führen.“
Um solche rechtzeitig zu erkennen und einer Lösung zuführen zu können, haben Zaufal und Lenikus eine weitere Gemeinschaft stiftende Initiative, nämlich ein regelmäßiges Kaffeekränzchen, ins Leben gerufen: „Die Kaffeekränzchen machen wir im Winter ein Mal monatlich, im Sommer alle 14 Tage. Natürlich kämpfen wir beim Gemeinschaftsgefühl mit den Windmühlen, meistens kommen dieselben Leute. Aber wir bemühen uns, die Neuzugänge zu motivieren, und das funktioniert eigentlich sehr gut“, erzählt Herr Zaufal. In der ungezwungenen Atmosphäre des gemeinsamen Kaffeetrinkens kommen die Themen oft leichter auf den Tisch als bei einer formellen Sprechstunde, das haben die beiden in ihrer ehrenamtlichen Funktion als Mieterbeiräte inzwischen schon oft erfahren. „Wenn’s Probleme gibt, dann kommen die Leute auch auf der Straße auf mich zu oder rufen mich einfach an“, berichtet Regina Lenikus.
Die beiden sind offensichtlich Mieterbeiräte zum Anfassen – was nicht heißt, dass sie nicht auch die segensreiche Wirkung neuer Technologien für ihre Arbeit nutzen würden: „Wir haben auch eine Whatsapp-Gruppe für die Mieter eingerichtet, wo man sich an uns wenden kann“, sagt Herr Zaufal stolz. „Da kann ich auch denjenigen Neumietern, die noch nicht so gut Deutsch können, eine Nachricht auf Deutsch schicken und darunter gleich die Übersetzung vom Whatsapp-Translator in ihrer Muttersprache, das klappt sehr gut.“
Wobei es nicht Frau Lenikus und Herr Zaufal wären, wenn sie nicht auch zur Verbesserung der Sprachkenntnisse von Neumietern bereits eine Initiative gestartet hätten: „Wir wollen jetzt etwas in der Art des Kaffeekränzchens schaffen, wo Leute zum Deutschlernen zusammenkommen können“, erzählt Herr Zaufal.
Kurz nachdenken muss der Mietervertreter aus Leidenschaft nur, als er zum Abschluss nach seinem Lieblingsplatz gefragt wird, während seine Kollegin auf dieselbe Frage gleich – wie könnte es anders sein – den Hof während eines Kaffeekränzchens genannt hat.
„Mein Lieblingsplatz ist in der Mitte einer Gemeinschaft“, sagt Herr Zaufal dann.
Es ist ein Satz, der das Gespräch und die Arbeit der Mietervertretung in der Bossigasse wohl perfekt zusammenfasst.

Hans Zaufal und Regina Lenikus sind Mietervertreter aus Leidenschaft


„Ich selber hab den Gemeindebau geheiratet …“
HANSSON-SIEDLUNG
Der Segen der Kinder
„Samma froh, dass ma die Ausländer do ham, sonst hätt ma ja kane Kinder do. Hätt ma nix z’tuan, den gonzen Tog. So vü Kaffee kemma gor net trinken.“
Das sagt der einzige Mann in der Runde der Lernbegleiter in der „Bassena Am Schöpfwerk“, aber die anwesenden Damen, die sich auf gleiche Weise wie er engagieren, stimmen ihm zu. Acht bis zehn Lernbegleiter sind hier in der Bassena regelmäßig aktiv, so viel wie nirgendwo sonst in ähnlichen Programmen in Wien. Alle arbeiten ehrenamtlich, in Eins-zu-Eins-Betreuung wird mit den Schülerinnen und Schülern Hausübung gemacht, geübt und Nachhilfe gegeben.
„Man freut sich, wenn das Kind vorankommt und versteht. In einer Stunde kann man gar nicht so viel unterbringen, auch nicht so viel Privates, weil die so viel Hausübung haben“, erzählt eine Dame. „Ich habe auch 34 Lesekinder, gehe jeden Mittwoch in die Schule. Manche holen fantastisch auf, die kann man richtig motivieren. Die haben so eine Freud, wenn’s ma erklären können: ‚Ich hab gestern die ganze Zeit gelesen‘, nur damit ich zufrieden bin“, lacht sie.
Früher sei die Altersstruktur der Hansson-Siedlung ganz anders gewesen, hauptsächlich junge Familien seien damals, vor Jahrzehnten, hier eingezogen.
Wie war damals das Leben in der Siedlung?
„Mühsam“, sagt eine ältere Dame, und sagt es doch so, dass es fröhlich klingt, „es gab noch keine Straßenbahn und keine Geschäfte und nix. Mit den Kindern sind wir durch Eis und Schnee zum 67er marschiert. Es hat sich trotzdem gut angefühlt, einfach weil die Wohnung da war. Die Kinder ham ein eigenes Zimmer bekommen. Das ist schon schön. Zwei Meter Schnee sind gelegen, als wir eingezogen sind. Es war so kalt, dass ich gleich eine Mittelohrentzündung bekommen hab. Mein Sohn war damals ein Jahr alt. Wir haben angefragt, ob wir ein Zimmer mehr haben könnten, weil wir ein zweites Kind wollten. Das war aber nicht möglich, das schon im Vorhinein zu bekommen. 1966 war das. Es war schön und ist noch immer schön. Wir haben’s ja so herrlich grün da herunten.“
Als Nächstes entspinnt sich unter den Lernbegleiterinnen und Lernbegleitern eine interessante Diskussion über Äpfel, Kirschen und die Segnungen der Moderne in der Hansson-Siedlung:
„Der Ententeich, die Schrebergärten. Da haben wir Äpfel und Kirschen gekauft, das gibt’s heute ja gar nicht mehr.“
„Äpfel und Kirschen gibt’s immer noch.“
„Aber sie werden in den Schrebergärten nicht mehr verkauft, oder?“
„Das ist was anderes. Aber geben tut es sie immer noch.“
„Wir haben ja alles, Fernwärme, alles. Jetzt kommt dann noch die Fernkühle“, meint eine der Anwesenden schließlich und löst mit dieser Idee allgemeine Heiterkeit aus.
Aber noch einmal zurück zur Lernbegleitung: Wer die Erinnerungen der sich hier ehrenamtlich engagierenden Mieterinnen und Mieter an ihre Anfangszeit in der Siedlung hört, der versteht, warum ihnen die Arbeit mit den Jugendlichen heute ein Anliegen ist:
„Früher gab es mehr Nähe zueinander. Man hat mehr geklopft und gefragt: ‚Geht’s gut?‘ Da ist viel verloren gegangen.“
„Jetzt wird das eine Pensionistensiedlung, jetzt gibt’s nur noch alte Leute.“
„Is es eh schon.“
„Und die türkischstämmigen Familien sind zwar ganz fantastische Nachbarn, aber sie wollen einfach nicht so viel Kontakt haben.“
„Man grüßt sich, und das ist es.“
„Trotzdem is es fantastisch, wenn die Jungen wiederkommen.“


Verbesserungsvorschläge für das Programm gibt es nur wenige, denn: „Die Leitung und das Team hier sind so großartig. Die sind also auch mitschuld daran, dass es hier so toll läuft.“
„Ich find es absolut fantastisch, dass es das überhaupt gibt.“
Nur eine Anregung bezüglich des Geschlechterverhältnisses gibt es dann doch noch, und sie ist wichtig:
„Man müsste mehr Männer in das Programm einbauen, weil die Buben brauchen auch Bezugspersonen, um sie da herbringen zu können.“
Die Gruppe der Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter wird jedenfalls mit voller Motivation weitermachen. Sie leistet damit einen wesentlichen Beitrag dafür, dass der soziale Zusammenhalt in der Hansson-Siedlung eben nicht verloren geht.

DONAUSTADT
Kontaktbesuchsdienst Donaustadt
Der Kontaktbesuchsdienst der Stadt Wien ist ein in Österreich einzigartiges Modell, bei dem wienweit rund hundert Freiwillige Seniorinnen und Senioren über 75 Jahren kontaktieren, um mit den älteren Menschen Gespräche zu führen und sie bei Bedarf über das Leistungsangebot der Stadt Wien zu informieren.
Die besondere Serviceleistung besteht schon seit 1977 und wird von den Wiener Sozialdiensten in Kooperation mit dem Fonds Soziales Wien, dem Büro der SeniorInnenbeauftragten sowie den 23 Bezirksvorstehungen umgesetzt.
2.400 Donaustädter über 75 erhalten jährlich ein Schreiben von der Bezirksvorstehung, in dem ein kostenloser Hausbesuch angeboten wird, immerhin rund ein Drittel nimmt das Angebot im Schnitt in Anspruch. Das Projekt ist nicht auf Gemeindebauten beschränkt, sondern steht allen Menschen über 75 Jahre, die im Bezirk wohnen, offen. Dennoch können die Donaustädter Kontaktbesucherinnen und Kontaktbesucher aufgrund ihrer ehrenamtlichen Arbeit natürlich einiges über die Lebenssituation älterer Menschen in den Donaustädter Gemeindebauten erzählen.
Was sind die Themen, die bei den Besuchen am häufigsten zur Sprache gebracht werden?
„Es wird immer wieder bedauert, dass es keine Hausbesorger gibt, und danach verlangt, dass es wieder welche geben soll.“
„Die Leute haben die größte Angst davor, wer einziehen wird, wenn eine Wohnung frei wird, weil jemand verstirbt oder auszieht.“
„Das Gemeinschaftsgefühl hat sich durch die neuen Mieter schon sehr verändert. Sie sind zwar oft nett, aber sie haben Eigenheiten, die die Alteingesessenen stören, wie dass sie die Schuhe vor der Tür stehen lassen oder dass sie den Mistsack bis zum Lift am Boden schleifen. Zum Glück gibt’s da wohnpartner, um solche Konfliktfälle dann auch zu schlichten.“
„Es ist von Stiege zu Stiege aber sehr unterschiedlich, wie’s mit der Sauberkeit und auch mit der Stimmung in den Bauten ist.“


Der Treffpunkt für den Kontaktbesuchsdienst: das Amtshaus Donaustadt
Die von den Kontaktbesucherinnen und Kontaktbesuchern aufgenommenen Informationen werden in einem Formular erfasst und an wohnpartner oder Wiener Wohnen weitergeleitet, erzählt die engagierte Gruppe von Ehrenamtlichen. Manche von ihnen stellen fest, dass sich aus ihrer Sicht in der jüngeren Generation viel geändert hat und das in Gesprächen auch immer wieder thematisiert wird:
„Die Erziehung war ja früher ganz anders, weil die Mutter meistens zu Hause war. Heute müssen alle arbeiten, damit sich’s finanziell irgendwie ausgeht.“
„Wenn die Frau aber nur halbtags arbeiten geht, wie meine Frau, dann kriegt sie später nur die halbe Pension, und das ist dann oft weniger als die Mindestsicherung.“
Eine empfundene Entfremdung zwischen den Generationen scheint beim Gespräch immer wieder durch, und so taucht auch irgendwann die Frage auf, was sich tun ließe, um die Leute wieder näher zusammenrücken zu lassen, ältere mit neuen Mieterinnen und Mietern in Kontakt zu bringen?
„Grätzlfeste könnten eine Möglichkeit sein, die Neumieter mit den Alteingesessenen zu verbinden. Gemeinsam kochen ist auch etwas, was immer gut funktioniert.“
Auf die Frage, was sie zu ihrem ehrenamtlichen Engagement bewogen und darin bestärkt hat, werden das Interesse an den Menschen sowie die zumeist positiven gesammelten Erfahrungen genannt:
„Ich find’s interessant, so viele verschiedene Menschen und Wohnungen kennenzulernen.“
„Die meisten sind ja auch nett, es kommt ganz selten vor, dass jemand unfreundlich ist.“
Wobei die Bezeichnung Kontaktbesuch mitunter Anlass für Missverständnisse biete, erzählt eine Kontaktbesucherin von einem skurrilen Vorfall, den sie einmal erlebt hat:
„Ich hatte persönlich das Erlebnis, dass mir ein über 80-Jähriger komplett nackt aufgemacht und gesagt hat, ich soll nur hereinkommen und er geht schnell ins Bad. Ich hab mir gedacht, der zieht sich an, er kam aber auch wieder nackt aus dem Bad heraus. Dann hat er gesagt: ‚Ich hab schon auf Sie gewartet und hab extra beim Magistrat angerufen, dass Sie auch ja kommen, weil ich brauch was von Ihnen – ich brauch eine Frau, Höchstalter 50.‘ Da konnte ich mich entspannt hinsetzen, weil die 50 hab ich schon hinter mir, also hab ich gesagt: ‚Entschuldigen Sie, für das bin ich nicht zuständig und dazu bin ich nicht ausgebildet.‘“
Haben die anwesenden Männer auch schon einmal ein solches Erlebnis gehabt?
„Ich hab nur Angebote zum Schachspielen bekommen – aber auch die musste ich ablehnen“, meint ein Herr und sorgt damit für allgemeine Heiterkeit.
REUMANNHOF
Margareten ohne Partnergewalt
Im Reumannhof in Margareten ist eine Gruppe engagierter Frauen zusammengekommen, um von ihrer Arbeit für die Initiative „StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt“ zu erzählen. Eine von ihnen ist Maria Rösslhumer, die Vorsitzende des „Vereins der Autonomen Österreichischen Frauenhäuser“, der das Projekt koordiniert.
Aber worum geht es bei der Initiative StoP eigentlich genau?
„Unsere Themen sind Gewalt in der Familie, Gewalt an Frauen und Kindern, das beschäftigt uns täglich“, erklärt Rösslhumer. „Ich bin froh, dass wir Frauen und Kindern helfen können, wir unterhalten auch eine Frauenhelpline, wo wir Frauen täglich unterstützen.“
2002 hatte sie das erste Mal vom StoP-Projekt gehört und war sofort begeistert: „Ich wollte es, wenn ich einmal mehr Zeit habe, unbedingt auch in Wien umsetzen.“
2013 bot sich ihr dann endlich die Möglichkeit, Genaueres aus erster Hand zu erfahren: Die Initiatorinnen und Initiatoren des Projekts in Hamburg veranstalteten in Wien ein Symposion, auf dem sie über ihre Arbeit und die gesammelten Erfahrungen berichteten.
2017/18 machte Rösslhumer schließlich die erforderliche Ausbildung in Hamburg, die es ihr ermöglichte, das Projekt im 5. Bezirk auf die Beine zu stellen.
„Das Ziel des Projekts ist gewaltfreie Beziehung“, erläutert Rösslhumer den Kern ihrer Arbeit. „Auch wenn das ein hoher Berg ist, den wir da erklimmen müssen.“
Dem Projekt StoP liegt die Überzeugung zugrunde, dass das soziale Umfeld entscheidend dafür ist, ob Gewalt in Beziehungen aufgedeckt und damit veränderbar wird. Mittels sogenannter Frauentische bietet der Verein nun seit 2019 in Gemeindebauten in ganz Margareten ein niederschwelliges Angebot, bei dem die Mitarbeiterinnen sich bemühen, mit Bewohnerinnen und Bewohnern ins Gespräch zu kommen, Vertrauen aufzubauen, aufzuklären und so die Grundlage dafür zu schaffen, dass über Gewalterfahrungen in Beziehung und Familie gesprochen werden kann.
Über direkten persönlichen Kontakt hat Rösslhumer auch viele ihrer Mitstreiterinnen für das Projekt gewonnen. Eine von ihnen erzählt die Geschichte ihrer Rekrutierung: „Es hat an der Tür geläutet und es standen zwei Damen vor der Tür und haben mir vom StoP-Projekt erzählt. Das Projekt ist meiner ganzen Lebenseinstellung sehr entgegengekommen. Ich hab einen starken Gerechtigkeitssinn und bin damit auch oft genug auf die Nase gefallen.“
Eine typische Geschichte für den Beginn des Engagements bei StoP – ein Projekt, das ganz aktiv die Idee eines Schneeballeffekts verfolgt, der immer mehr Aufmerksamkeit für das Thema schafft und auf diese Weise betroffene Frauen aus der Isolation holt: „Das Thema sollte selbstverständlich sein. Die Betroffenen sollten sich trauen zu reden, Vertrauenspersonen in der Nachbarschaft finden und sich Hilfe holen können“, so Rösslhumer.
Der Gemeindebau eigne sich allein schon durch seine offene Bauweise sehr gut für das Projekt, weil man über den Hof viel aus den Nachbarwohnungen mitbekomme. Dadurch werde auch Gewalt mehr wahrgenommen und es gebe bessere Chancen auf Hilfe. „In einem Villenviertel würde da lange Zeit niemand was bemerken. Man hat als Betroffene also im Gemeindebau, wenn die Nachbarschaft funktioniert, eine bessere Chance, aus einer Gewaltbeziehung herauszukommen.“
Rösslhumers Wünsche für die Zukunft? „Dass wir Anstoßgeber für eine Veränderung sind, auch nach Ablauf des offiziellen Projektzeitraums.“ Damit Margareten als Bezirk ohne Partnergewalt ein Vorbild für ganz Wien wird.