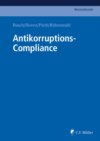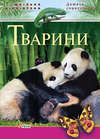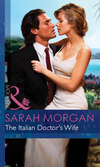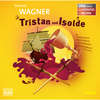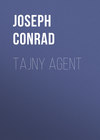Kitabı oku: «Kapitalmarkt Compliance», sayfa 54
2. Bezugsrechtsausschluss und Ausschluss des Andienungsrechts
91
Ein Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ist möglich, wenn eine sachliche Rechtfertigung für den Ausschluss gegeben ist.[178] Aufgrund der Verweisung in § 71 Abs. 1 Nr. 8 S. 5 AktG auf § 186 Abs. 3, 4 AktG ist ein Bezugsrechtsausschluss u.a. gerechtfertigt, wenn sich der Ausgabebetrag am Börsenkurs orientiert und nur im Umfang von 10 % des Grundkapitals erfolgt.[179]
92
Die h.M. spricht den Aktionären im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien durch die Gesellschaft ein Andienungsrecht (als umgekehrtes Bezugsrecht) zu. Die Aktionäre können die Abnahme so vieler Aktien im Verhältnis zur nachgefragten Gesamtmenge verlangen, wie es dem Anteil ihrer Aktien im Verhältnis zum Grundkapital der Gesellschaft entspricht.[180] Dieses Andienungsrecht kann wie das Bezugsrecht durch Beschluss der Hauptversammlung ausgeschlossen werden, wenn dies sachlich gerechtfertigt ist.[181]
93
Die Beschlussfassung über den Ausschluss von Andienungs- und Bezugsrechten der Aktionäre erfordert gem. § 186 Abs. 3 S. 2 AktG eine qualifizierte Mehrheit, d.h. eine Mehrheit von mindestens drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals.[182] Zudem muss der Vorstand der Hauptversammlung gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 S. 5 i.V.m. § 186 Abs. 4 S. 2 AktG schriftlich über die Gründe für den teilweise vollständigen Ausschluss des Bezugs- bzw. Andienungsrechts berichten.
3. Erwerbs- und Veräußerungswege
94
Das Gesetz schreibt nicht vor, wie der Erwerb eigener Aktien auf Basis eines Hauptversammlungsbeschlusses durchzuführen ist. Klarstellend hebt § 71 Abs. 1 Nr. 8 S. 3 AktG lediglich hervor, dass bei Erwerb und Veräußerung der Gleichbehandlungsgrundsatz des § 53a AktG strikt zu beachten ist.
95
Gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 S. 4 AktG genügen der Erwerb und die Veräußerung über die Börse dem Gleichbehandlungsgrundsatz des § 53a AktG. Weitere Möglichkeiten des Erwerbs sind der Erwerb über ein öffentliches Rückkaufangebot[183] oder die Begebung von Verkaufsrechten.[184] Maßgeblich ist in jedem Fall, ob im Rahmen des gewählten Erwerbsweges das Gleichbehandlungsgebot gewahrt wird.[185] Zur Erfüllung dieser Anforderung muss ein öffentliches Rückkaufangebot den Aktionären gegenüber durch Publizierung in den Gesellschaftsblättern transparent gemacht werden.[186] Die Aktionäre sind über Angebotsfrist, Erwerbspreis oder Preisspanne und Ausgestaltung des Zuteilungsverfahrens umfassend zu informieren.[187] Bei der Begebung von Verkaufsrechten sind diese entsprechend der jeweiligen Beteiligungsquote allen Aktionären anzubieten, um dem Gleichbehandlungsgebot gerecht zu werden.[188]
96
Ein bloßes Platzgeschäft oder ein Paketerwerb ist demgegenüber nicht zulässig,[189] weil diese aufgrund eines individuellen Aushandelns des Erwerbsgeschäfts gegen das Gleichbehandlungsgebot verstoßen. Umstritten ist, inwieweit eine individuelle Rückkaufvereinbarung mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz zu vereinbaren ist.[190] Teilweise werden solche Rückkaufvereinbarungen generell als unzulässig erachtet, da eine Gleichbehandlung nicht zu realisieren sei.[191] Zum Teil wird eine individuelle Rückkaufvereinbarung bei kleinen, nicht börsennotierten Gesellschaften als zulässig erachtet, da bei diesen eine formelle Ungleichbehandlung aus sachlichen Gründen gerechtfertigt sei.[192] Ausgehend von der wohl h.M. und damit von dem Bestehen eines Andienungsrechts der Aktionäre würde das Gleichbehandlungsgebot auch bei einem individuellen Rückkauf gewahrt, indem entweder allen Aktionären die Abnahme der Aktien anzubieten oder das Andienungsrecht auszuschließen ist.[193] Da das Gesetz ohne Nennung bestimmter Erwerbswege als Erfordernis für den Erwerb lediglich die Gleichbehandlung anordnet, muss auch ein individueller Rückkauf möglich sein, soweit eine Ungleichbehandlung der Aktionäre ausgeschlossen ist.[194] Eine individuelle Rückkaufvereinbarung kann daher mit Beteiligung der Hauptversammlung dem Gleichbehandlungsgrundsatz genügen und als möglicher Weg zum Erwerb eigener Aktien dienen.[195]
97
Aus § 71 Abs. 1 Nr. 8 S. 5 AktG ergibt sich schließlich, dass die Hauptversammlung eine andere Veräußerung als über die Börse zu beschließen hat. Im Gesetzeswortlaut ist nicht festgelegt, dass es einer gesonderten Beschlussfassung bedarf. In der Praxis üblich und empfehlenswert ist, den Beschluss über den Erwerb und die Veräußerung der eigenen Aktien in einem Hauptversammlungsbeschluss zusammenzufassen, wenn die Veräußerung der eigenen Aktien in anderer Weise als über die Börse geplant ist. Die Hauptversammlung kann somit beschließen, eigene Aktien auch außerhalb der Börse und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu veräußern.
IX. Zuständigkeit für die Durchführung des Erwerbs
98
Der Erwerb eigener Aktien ist eine Maßnahme der Geschäftsführung,[196] so dass in den Fällen der § 71 Abs. 1 Nr. 1–5 AktG der Vorstand gem. §§ 76, 77 AktG zuständig ist. Der Erwerb gem. § 71 Abs. 1 Nr. 6–8 AktG fällt zunächst in die Zuständigkeit der Hauptversammlung, die grundsätzlich mit einfacher Mehrheit einen Ermächtigungsbeschluss fasst. Mit Ausnahme des Beschlusses zur Einziehung § 71 Abs. 1 Nr. 6 AktG verbleibt die Entscheidung, ob von der Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, beim Vorstand.[197]
99
Zudem besteht nach § 119 Abs. 2 AktG die Möglichkeit, dass der Vorstand eine Entscheidung zum Erwerb eigener Aktien durch die Hauptversammlung verlangt. Hierüber entscheidet der Vorstand nach eigenem Ermessen durch einstimmigen Vorstandsbeschluss, soweit Satzung oder Geschäftsordnung nichts anderes vorsehen.[198]
100
Gegebenenfalls ist der Vorstand an die Zustimmung des Aufsichtsrats gebunden. Dies ist der Fall, wenn eine entsprechende Satzungsbestimmung oder Regelung in der Geschäftsordnung für den Vorstand oder eine Bestimmung durch den Aufsichtsrat nach § 111 Abs. 4 S. 2 AktG vorliegt. Ferner kann die Hauptversammlung im Ermächtigungsbeschluss die Zustimmung des Aufsichtsrats anordnen.[199]
3. Teil Transaktionsbezogene Compliance › 10. Kapitel Erwerb eigener Aktien › D. Schranken zulässigen Erwerbs, § 71 Abs. 2 AktG
D. Schranken zulässigen Erwerbs, § 71 Abs. 2 AktG
101
Soweit ein Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 AktG zulässig ist, stellt § 71 Abs. 2 AktG differenziert nach Erwerbsanlass bestimmte Schranken für den Erwerb auf. Der Vorstand muss sicherstellen, dass diese aktienrechtlichen Vorgaben beachtet werden. Soweit erforderlich, muss der Vorstand für die Prüfung, ob die Vorgaben erfüllt werden können, fachlichen Rat einholen. Die aktienrechtlichen Vorgaben sind in nachfolgender Tabelle zusammengefasst.
102
| 10 % Grenze | Kapitalgrenze | Volleinzahlung | |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 Schadensabwehr | X | X | X |
| Nr. 2 Belegschaftsaktien | X | X | X |
| Nr. 3 Abfindung | X | X | |
| Nr. 4 unentgeltlicher Erwerb | X | ||
| Nr. 5 Gesamtrechtsnachfolge | |||
| Nr. 6 Einziehung | |||
| Nr. 7 Handelsbestand | X | X | X |
| Nr. 8 Ermächtigung | X | X | X |
I. 10 %-Grenze
103
In Umsetzung von Art. 19 Abs. 1 lit. c der Kapitalrichtlinie[200] ist ein Erwerb eigener Aktien gem. § 71 Abs. 2 S. 1 AktG nur bis zu einer Höhe von 10 % des Grundkapitals gestattet. Diese Erwerbsgrenze gilt für den Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 1–3, 7 und 8 AktG, d.h. die Grenze ist nicht bei einem unentgeltlichen Erwerb, der Gesamtrechtsnachfolge und dem Erwerb zur Einziehung zu beachten. Sobald die 10 %-Grenze erreicht ist, ist ein Erwerb eigener Aktien nur noch nach § 71 Abs. 1 Nr. 4–6 AktG möglich, da die Grenze für diese Erwerbsfälle nicht anwendbar ist.
104
Die Beschränkung bezieht sich auf den Besitz eigener Aktien.[201] Abzustellen ist auf die Grundkapitalziffer gem. § 266 Abs. 3 A I HGB, wobei bedingtes oder genehmigtes Kapital nicht zu berücksichtigen ist.[202] Bei der Berechnung sind früher erworbene Aktien zu berücksichtigen, wenn die Gesellschaft noch Inhaberin der Mitgliedschaft, also im Besitz der Aktien ist.[203] Sämtliche eigenen Aktien, die die AG erwirbt oder bereits erworben hat, sowie in Pfand genommene Aktien der AG nach § 71e Abs. 1 S. 1 AktG sind daher in die Berechnung einzubeziehen.[204] Gleiches gilt gem. § 71d S. 3 AktG für Aktien, die der AG nach § 71d S. 1 und 2 AktG zugerechnet werden.
II. Kapitalgrenze
105
Nach § 71 Abs. 2 S. 2 AktG ist der Erwerb eigener Aktien nur aus dem ausschüttungsfähigen Vermögen zu realisieren. Die Gesellschaft darf eigene Aktien nur mit Mitteln erwerben, die sie auch als Dividende an ihre Aktionäre ausschütten könnte.[205] Der Erwerb eigener Aktien darf daher nur erfolgen, wenn die Gesellschaft im Zeitpunkt des Erwerbs in Höhe der Aufwendungen für den Erwerb (hypothetisch) eine Rücklage bilden könnte, ohne dadurch das Grundkapital oder eine nach Gesetz oder Satzung zu bildende Rücklage, die nicht zur Zahlung an Aktionäre verwandt werden darf, zu vermindern. In die Betrachtung sind auch Vorerwerbe nach § 71 Abs. 1 Nr. 1–3 sowie 7 und 8 AktG einzubeziehen, sofern die AG die hieraus resultierenden eigenen Aktien noch besitzt.[206] Die (hypothetische) Rücklagenbildung bezieht sich entsprechend § 272 Abs. 1a HGB allein auf den Unterschiedsbetrag zwischen dem Nennbetrag oder dem rechnerischen Wert der Aktie und den Anschaffungskosten der eigenen Aktien. Dieser Differenzbetrag ist mit den frei verfügbaren Rücklagen fiktiv zu verrechnen. Der Nennbetrag selbst ist gem. § 272 Abs. 1a HGB in der Bilanz offen von der Position „Gezeichnetes Kapital“ abzusetzen. Aufwendungen, die Anschaffungsnebenkosten sind, sind als Aufwand des Geschäftsjahres in der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen und daher nicht mit frei verfügbaren Rücklagen zu verrechnen.[207]
106
In der praktischen Umsetzung muss der Vorstand im Erwerbszeitpunkt fiktiv einen Zwischenabschluss erstellen,[208] um zu beurteilen, ob er aus frei verfügbaren Mitteln eine Rücklage in Höhe des Unterschiedsbetrags bilden könnte.[209] Tatsächlich wird die Rücklagenbildung erst im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses vorgenommen.[210] Für die Einhaltung der Kapitalgrenze gem. § 71 Abs. 2 S. 2 AktG kommt es jedoch allein auf den Zeitpunkt des Erwerbs eigener Aktien an.[211] Das bedeutet, dass der Vorstand zu diesem Zeitpunkt beurteilen muss, ob die Gesellschaft in der Lage wäre, eine Rücklage aus freien Mitteln zu bilden.[212] Für die Begründung dieser Prognose ist entscheidend, dass sie auf Tatsachen gestützt und kaufmännisch vertretbar ist. Abzustellen ist auf die Grundsätze und Regeln für die Erstellung eines Jahresabschlusses.[213] Wenn dem Vorstand eine eigene Sachkunde zur Beurteilung fehlt, muss er sich den Rat eines unabhängigen, fachlich qualifizierten Berufsträgers einholen[214] und sich bei der erforderlichen Auswahlentscheidung selbst hinsichtlich der spezifischen Sachkunde des Berufsträgers vergewissern.[215]
107
Entsprechend dem Stichtagsprinzip kommt es nicht darauf an, ob die Rücklage später im Jahresabschluss tatsächlich gebildet werden kann oder nicht.[216] Soweit am Jahresende eine Rücklage entsprechend § 71 Abs. 2 S. 2 AktG nicht (mehr) gebildet werden könnte, obwohl zum Stichtag des Erwerbs eine Rücklagenbildung nach Einschätzung des Vorstands möglich gewesen wäre, hat dieser Umstand keinen Einfluss auf die Wirksamkeit und die Zulässigkeit des Erwerbs der eigenen Aktien.[217]
1. Verrechnungsfähige Rücklagen
108
Eine fiktive Verrechnung kann aus dem Jahresüberschuss, vermehrt um einen Gewinnvortrag und vermindert um einen Verlustvortrag erfolgen.[218] Alternativ ist die Entnahme aus freien Rücklagen möglich.[219] Zu den frei verfügbaren Rücklagen, mit denen verrechnet werden darf, gehören Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 HGB) sowie frei verfügbare Kapitalrücklagen.[220] Als freiwillige Kapitalrücklagen gelten sonstige Zuzahlungen der Gesellschafter in das Eigenkapital gem. § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB, die ohne Gegenleistung erbracht werden.[221] Soweit Verlustvorträge bestehen, die nicht durch einen Jahresüberschuss gedeckt sind, scheiden eine fiktive Rücklagenbildung und damit der Erwerb eigener Aktien aus. Die Erzeugung einer Unterbilanz durch Aktienrückgabe ist gem. Art. 19 Abs. 1 lit. b) der Kapitalrichtlinie[222] verboten.[223]
2. Gesperrte Rücklagen
109
Die wichtigste gesperrte Rücklage ist die gesetzliche Rücklage nach § 150 AktG und die in § 150 Abs. 3, 4 erwähnte Kapitalrücklage.[224] Das Grundkapital und die nach Gesetz oder Satzung zu bildenden Rücklagen dürfen nicht angetastet werden. Dies gilt auch, soweit die gesetzlich vorgeschriebene Rücklagenhöhe in Höhe von 10 % des Grundkapitals bereits überschritten ist. Gem. § 150 Abs. 4 AktG bleibt der die 10 % Grenze überschreitende Betrag in der Rücklage gebunden und darf nur für die in § 150 Abs. 4 AktG aufgeführten Zwecke verwendet werden. Diese sind lediglich der Ausgleich eines Jahresfehlbetrages oder eines Verlustvortrages sowie die Verwendung für eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Die Nutzung zur Bildung der fiktiven Rücklage beim Erwerb eigener Aktien ist ausweislich des Gesetzes nicht gestattet.
110
Auch die in § 272 Abs. 2 Nr. 1–3 HGB ausgewiesenen Kapitalrücklagen, nämlich:
| – | das Aufgeld bei der Ausgabe von Anteilen sowie von Bezugsanteilen, |
| – | der bei der Ausgabe von Wandlungs- und Optionsrechten zum Erwerb von Aktien erzielte Betrag und |
| – | Zuzahlungen von Gesellschaftern gegen Gewährung eines Vorzugs für ihre Anteile, |
sind gebundene Rücklagen und stehen daher weder für die fiktive noch für die am Jahresende tatsächliche Rücklagenbildung zum Erwerb eigener Aktien zur Verfügung.[225]
111
Der Rückgriff auf einen im Zuge der Begebung einer Wandel- oder Optionsanleihe in die Kapitalrücklage eingestellten Betrag ist damit nicht möglich, da diese Rücklage gem. § 272 Abs. 2 Nr. 2 HGB gebunden ist und auch nach Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrechts gebunden bleibt.[226] Die Wandlung als solche führt nicht zu einer Umqualifizierung der Rücklage. Ferner bleibt das Aufgeld auch bei Nichtausübung der Option in der Kapitalrücklage.[227] Mögliche Überlegungen des Vorstands, die gebundene Kapitalrücklage eines Aufgelds im Rahmen der Begebung von Wandel- oder Optionsanleihen für die fiktive Rücklagenbildung nutzbar zu machen, sind daher unzulässig.
112
Auch Rücklagen aus der Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Güter des Anlagevermögens, latenter Steuern oder aus der Bewertung von Planvermögen im Sinne des § 246 Abs. 2 S. 2 HGB zum Zeitwert sind gem. § 268 Abs. 8 HGB ausschüttungsgesperrt. Diese ausschüttungsgesperrten Rücklagen dürfen nicht zur fiktiven Rücklagenbildung im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien verwendet werden.[228]
3. Bildung verrechnungsfähiger Rücklagen
113
Soweit der Gesellschaft im Zeitpunkt der Entscheidung über den Erwerb eigener Aktien keine freien Rücklagen zur Verfügung stehen, stellt sich die Frage, wie solche Rücklagen (fiktiv) geschaffen werden können. Soweit Verlustvorträge bestehen, kann zunächst keine Rücklage gebildet werden. Denkbar ist jedoch, Verlustvorträge zunächst fiktiv mit erwarteten Gewinnen zu verrechnen und in entsprechender Höhe fiktiv aufzulösen. Infolgedessen könnte ein darüber hinaus bestehender erwarteter Gewinn fiktiv in eine Rücklage eingestellt werden, um dadurch die Erwerbskosten bilanziell zu neutralisieren.
114
Bestehen neben Verlustvorträgen eine gesetzliche und/oder eine Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 1–3 HGB, die zusammen 10 % (oder einen in der Satzung festgelegten höheren Teil des Grundkapitals) übersteigen, so können diese in Höhe des übersteigenden Betrages aufgelöst und gem. § 150 Abs. 4 AktG mit den Verlustvorträgen verrechnet werden. Ein danach erwarteter, etwa verbleibende Verlustvorträge überschießender Gewinn steht ebenfalls zur fiktiven Rücklagenverrechnung oder -bildung zur Verfügung. Um die Wirksamkeit des Erwerbs eigener Aktien herbeizuführen und die fiktive Rücklagenbildung zu untermauern, muss der Verlustvortrag in solchen Fällen am Ende des Jahres tatsächlich aufgelöst werden. Zwar muss im Gegensatz zur früheren Rechtslage die Rücklage nur zum Erwerbszeitpunkt fiktiv gebildet werden können und der Einfachheit halber nicht mehr mittels einer Zwischenbilanz tatsächlich geschaffen werden. Vor diesem Hintergrund und mit dem durch Bildung der Rücklage verfolgten Kapitalschutz ist es jedoch nicht vereinbar, zum Zeitpunkt des Erwerbs fiktiv die Möglichkeit der Rücklagenbildung durch Verrechnung von Verlustvorträgen mit Beträgen aus der nur zu diesem Zweck „aufgelösten“ gesetzlichen oder Kapitalrücklage anzunehmen, durch nachfolgendes Unterlassen der Auflösung und Verrechnung aber die Möglichkeit der Rücklagenbildung tatsächlich zu vereiteln.
III. Volleinzahlung
115
Ein Erwerb eigener Aktien ist in den Fällen des § 71 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4, 7 und 8 AktG außerdem nur zulässig, soweit die zu erwerbenden Aktien bereits voll eingezahlt sind. Hintergrund ist, dass im Falle nicht voll eingezahlter Aktien aus dem Rückerwerb eigener Aktien eine Personenidentität zwischen Gläubiger (AG) und Schuldner (Inhaber der Aktie) der Einlagenforderung resultiert.[229] Infolgedessen geht die Einlagenforderung aufgrund Konfusion unter.[230] Diese Gefährdung der Kapitalaufbringung wird durch das Erfordernis der Volleinzahlung vermieden.
3. Teil Transaktionsbezogene Compliance › 10. Kapitel Erwerb eigener Aktien › E. Kapitalmarktrechtliche Zulässigkeit von Aktienrückkaufprogrammen
E. Kapitalmarktrechtliche Zulässigkeit von Aktienrückkaufprogrammen
116
Bei dem Erwerb und der Veräußerung eigener Aktien durch eine börsennotierte AG muss der Vorstand neben den aktienrechtlichen Anforderungen auch kapitalmarktrechtliche Publizitätspflichten beachten, d.h. insbesondere die Pflichten zur Ad-hoc-Mitteilung sowie das Verbot der Marktmanipulation.