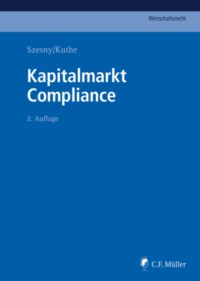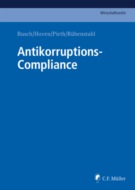Kitabı oku: «Kapitalmarkt Compliance», sayfa 53
III. Abfindung von Aktionären
63
Gem. § 71 Abs. 1 Nr. 3 AktG ist ein Erwerb eigener Aktien weiter zulässig, um Aktionäre nach §§ 305 Abs. 2, 320b AktG (konzernrechtliche Abfindung) oder nach §§ 29 Abs. 1, 125 S. 1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1, 207 Abs. 1 S. 1 UmwG (Erfüllung von Erwerbspflichten nach Umwandlung) abzufinden.
1. Gesetzliche Abfindungssachverhalte
64
Die konzernrechtliche Abfindung greift im Fall eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen zwei AGen und der Eingliederung ein. Der Unternehmensvertrag muss ein Abfindungsangebot beinhalten und den entsprechenden Abfindungsanspruch außenstehender Aktionäre begründen, und zwar – je nach Fallgestaltung – in Form des Angebots von Aktien an der herrschenden Gesellschaft und/oder als Barabfindung. Zur Erfüllung der Pflicht eines Abfindungsangebots in Aktien der herrschenden bzw. Haupt-Gesellschaft ist gem. § 71 Abs. 1 Nr. 3 AktG ein Rückerwerb eigener Aktien zulässig. Diese Regelung erlaubt der herrschenden bzw. Haupt-Gesellschaft, sich die für die Abfindung erforderliche Anzahl eigener Aktien zu beschaffen.
65
Im Fall der Verschmelzung von Gesellschaften unterschiedlicher Rechtsformen oder einer börsennotierten auf eine nicht-börsennotierte AG ist der übernehmende Rechtsträger verpflichtet, den widersprechenden Gesellschaftern des übernehmenden Rechtsträgers den Erwerb ihrer Anteile gegen angemessene Barabfindung anzubieten (§ 29 Abs. 1 S. 1 UmwG). Gleiches gilt bei der Verschmelzung von Rechtsträgern der gleichen Rechtsform, wenn die Anteile des übernehmenden Rechtsträgers Verfügungsbeschränkungen unterliegen (§ 29 Abs. 1 S. 2 UmwG). Eine ebensolche Barabfindungspflicht obliegt nach § 207 UmwG der formwechselnden Gesellschaft. Der Abfindungsanspruch entsteht nach dem Gesetz erst mit Eintragung im Handelsregister, zu einem Zeitpunkt also, zu dem der Betroffene bereits kraft Gesetzes Aktionär des aufnehmenden Rechtsträgers ist. Damit ist die übernehmende oder formgewechselte AG gezwungen, eigene Aktien zum Zwecke der Abfindung zu erwerben. Zur Erfüllung dieser Abfindungspflicht ist der Erwerb eigener Aktien gem. § 71 Abs. 1 Nr. 3 AktG gestattet.
66
Voraussetzung des zulässigen Erwerbs ist in beiden Fällen die Verwendungsabsicht des Vorstands zum Zwecke der Abfindung bzw. zur Erfüllung der Erwerbspflichten.[129] Diese Absicht des Vorstands sollte vorsorglich im Rahmen einer Notiz, eines Vermerks oder Beschlusses dokumentiert werden. Eine gewisse Ernsthaftigkeit des Vorhabens ist jedenfalls zu bejahen, wenn die Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Hauptversammlungen auf beiden Vertragsseiten gefasst sind.[130] Wenn aufgrund der Mehrheitsverhältnisse das Beschlussergebnis bereits feststeht (und dies hinlänglich dokumentiert ist), ist diese Tatsache ausreichend für die Begründung der erforderlichen Ernsthaftigkeit im Sinne des § 71 Abs. 1 Nr. 3 AktG.
2. Analoge Anwendungsfälle
67
Auch zur Vorbereitung einer Verschmelzung nach § 62 UmwG ist ein Erwerb eigener Aktien in entsprechender Anwendung des § 71 Abs. 1 Nr. 3 AktG nach überwiegender Ansicht gestattet.[131] Bei der Konzernverschmelzung ohne Hauptversammlungsbeschluss darf die übernehmende Muttergesellschaft den Minderheitsgesellschaftern der übertragenden Tochtergesellschaft anstelle der Aktien aus einer Kapitalerhöhung eigene Aktien ausgeben, die die Gesellschaft zuvor zu diesem Zweck erworben hat.[132] Alternativ kann die Gesellschaft auch auf Basis einer Ermächtigung der Hauptversammlung nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG vorgehen.[133]
68
Nach Aufgabe der Macroton-Entscheidung[134] durch den BGH[135] ist § 71 Abs. 1 Nr. 3 AktG nicht mehr analog im Falle des Delisting gegenüber widersprechenden Aktionären anwendbar.[136] Grundsätzlich wird ein Abfindungsanspruch der Aktionäre beim Delisting nunmehr verneint.[137] Nur soweit aus verwaltungsrechtlicher Perspektive ohne Abfindung eine übermäßige Beeinträchtigung der Anlegerinteressen im Sinne des § 39 Abs. 2 BörsG vorliegt, soll in solchen Fällen ein Rückerwerb noch geboten sein. In diesen Fällen kann der Vorstand von den abgebenden Aktionären eigene Aktien auf Basis des § 71 Abs. 1 Nr. 3 AktG erwerben, weil durch ein Abfindungsangebot die Beeinträchtigung beseitigt werden könne.[138]
69
Ferner kommt ein Erwerb eigener Aktien in entsprechender Anwendung des § 71 Abs. 1 Nr. 3 AktG zur Erfüllung von Schadensersatzansprüchen geschädigter Anleger in Betracht.[139] Wenn Anleger auf dem Sekundärmarkt aufgrund von durch den Vorstand begangenen vorsätzlichen Täuschungshandlungen Aktien erwerben, können sie im Wege der Naturalrestitution Erstattung des Kaufpreises gegen Übertragung der Aktien an die Gesellschaft verlangen.[140]
IV. Unentgeltlicher Erwerb
70
Der Erwerb eigener Aktien ist des Weiteren zulässig, wenn er unentgeltlich oder durch ein Kreditinstitut im Sinne des §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 KWG in Ausführung einer Einkaufskommission erfolgt.
71
Unentgeltlichkeit ist im Sinne des § 516 BGB zu verstehen, d.h. die Gesellschaft darf nicht zu einer Gegenleistung verpflichtet sein.[141] Die Variante erfasst insbesondere Schenkungen oder Vermächtnisse. Sie findet jedoch keine Anwendung auf eine gemischte Schenkung oder ein Vermächtnis unter Auflagen.[142] Eine Verpflichtung, Schenkung- oder Erbschaftsteuer zahlen zu müssen, stellt keine Gegenleistung dar und schließt die Unentgeltlichkeit im Sinne des § 71 Abs. 1 Nr. 4 AktG nicht aus.[143]
72
Als Hauptfall wird die Schenkung zwecks Sanierung der AG angesehen, für die auch § 71 Abs. 1 Nr. 6 AktG eingreift.[144] In der Praxis ist der unentgeltliche Erwerb nahezu bedeutungslos.[145]
73
Die zweite Variante des § 71 Abs. 1 Nr. 4 AktG betrifft die Ausführung einer Einkaufskommission im Sinne des § 383 Abs. 1 Alt. 1 HGB durch ein Kreditinstitut, d.h. den gewerbsmäßigen Kauf von Waren oder Wertpapieren für Rechnung eines anderen. In diesem Fall erwirbt die AG die eigenen Aktien, um diese zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus der Einkaufskommission einzusetzen. Wenn das Geschäft scheitert, weil zum Beispiel der Kommittent nicht abnimmt, wird der Erwerb dadurch nicht nachträglich unzulässig.[146]
74
Die Ausnahmeregelung findet keine Anwendung auf eine Verkaufskommission im Sinne des § 383 Abs. 1 Alt. 2 HGB. In einem solchen Fall erlangt die Bank nur die Verfügungsbefugnis über die Aktien, so dass kein Erwerb eigener Aktien vorliegt.[147]
V. Gesamtrechtsnachfolge
75
Der Erwerb eigener Aktien ist außerdem nach § 71 Abs. 1 Nr. 5 AktG im Wege der Gesamtrechtsnachfolge zulässig. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass die Gesamtrechtsnachfolge nicht am Erwerb eigener Aktien scheitert.[148] Die Ausnahmeregelung erfasst den Erwerb von Aktien durch gesetzliche Erbschaft (§ 1922 BGB), durch Rechtsnachfolge bei Verschmelzung (§§ 20 Abs. 1 Nr. 1, 73 UmwG) und durch Vermögensübergang auf den letzten verbleibenden Gesellschafter in einer Personengesellschaft (§ 738 Abs. 1 S. 1 BGB i.V.m. § 105 Abs. 3 HGB).[149]
VI. Einziehung
76
Weiter gestattet § 71 Abs. 1 Nr. 6 AktG den Erwerb eigener Aktien, um diese auf Basis eines vorausgehenden Einziehungsbeschlusses der Hauptversammlung einzuziehen. Da die Einziehung bei der AG stets mit einer Kapitalherabsetzung einhergeht, ist immer ein vorheriger Kapitalherabsetzungs- und Einziehungsbeschluss der Hauptversammlung erforderlich.[150] Erfasst sind beide Arten der Kapitalherabsetzung: die ordentliche gem. § 237 Abs. 2 AktG und die vereinfachte gem. § 237 Abs. 3–5 AktG. Nur in dem von der Hauptversammlung beschlossenen Umfang dürfen eigene Aktien erworben werden.[151]
77
Der Vorstand muss daher den folgenden Verfahrensablauf beachten, um zulässigerweise eigene Aktien zum Zwecke der Einziehung zu erwerben:
| 1. | Hauptversammlungsbeschluss über die Einziehung nach den Vorschriften über die Kapitalherabsetzung; |
| 2. | Aktienrückerwerb gem. § 71 Abs. 1 Nr. 6 AktG; |
| 3. | Durchführung der Kapitalherabsetzung durch die Verwaltung. |
78
Im Falle des Aktienerwerbs zur Einziehung unterliegt die AG weder dem Volleinzahlungsgebot noch den Erwerbsschranken des § 71 Abs. 2 AktG. Die Kapitalerhaltungs- und Gläubigerschutzregelungen treten insofern hinter die Einziehungsregelungen zurück.[152]
79
Im Falle der ordentlichen Einziehung darf die Gesellschaft gem. § 237 Abs. 2 S. 3 i.V.m. § 225 Abs. 2 AktG Zahlungen an die Aktionäre frühestens sechs Monate nach Bekanntmachung der Eintragung über die Kapitalherabsetzung leisten. Hierzu gehört auch die Zahlung des Erwerbspreises für die einzuziehenden Aktien.[153] Die sofortige Auszahlung des Erwerbspreises an die Aktionäre ist nur im Rahmen der vereinfachten Einziehung möglich, wenn die einzuziehenden Aktien voll eingezahlt sind und
| – | die Aktien der Gesellschaft unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurden (§ 237 Abs. 3 Nr. 1 AktG) oder |
| – | die Einziehung zu Lasten eines Bilanzgewinns oder von ausschüttungsfähigen Gewinnrücklagen erfolgt (§ 237 Abs. 3 Nr. 2 AktG) oder |
| – | die Aktien Stückaktien sind und der Hauptversammlungsbeschluss bestimmt, dass sich der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital durch die Einziehung nach § 8 Abs. 3 AktG erhöht (§ 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG).[154] |
80
Die Einziehungsmöglichkeit über § 71 Abs. 1 Nr. 6 AktG wird in der Praxis überwiegend zum Ausgleich von Verlusten sowie zu Sanierungszwecken eingesetzt.[155] Hintergrund ist, dass die Einziehung durch Kapitalherabsetzung von der Praxis als schwerfällig und unflexibel empfunden wird, da der Vorstand die eigenen Aktien in dem beschlossenen Umfang umgehend erwerben muss.[156] Dem Vorstand steht kein Ermessenspielraum in zeitlicher Hinsicht zu.[157] Er hat auch keine Dispositionsbefugnis über die Verwendung der erworbenen Aktien, da die Hauptversammlung die Entscheidung zur Einziehung verbindlich festgelegt hat.[158] Wenn eine AG eine flexible Handhabung der Einziehung von Aktien beabsichtigt, muss sie auf eine Ermächtigung nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG (siehe Rn. 84 ff.) zurückgreifen.[159]
VII. Handelsbestand
81
Als weitere Ausnahme von dem grundsätzlichen Erwerbsverbot sieht § 71 Abs. 1 Nr. 7 AktG den Wertpapierhandel, also den Eigenhandel von Aktien durch Banken vor. Die Norm richtet sich an Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute im Sinne des §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 und §§ 1 Abs. 1a, 2 Abs. 6 KWG sowie Finanzunternehmen im Sinne des § 1 Abs. 3 KWG.
82
Der Begriff des Wertpapierhandels ist weit zu verstehen, so dass sämtliche Erscheinungsformen des Eigenhandels erfasst sind,[160] wie z.B.
| – | Herstellung ausreichender Liquidität für den außerbörslichen Handel, |
| – | Erwerb zur Erfüllung von Kauf- und Darlehensverträgen (sog. Wertpapierleihe), |
| – | Optionsgeschäfte über die Deutsche Terminbörse, soweit ein Erwerb im Sinne des § 71 AktG vorliegt, und |
| – | Gegengeschäfte zur Abstimmung von Risiken, die mit einem Optionshandel einhergehen (sog. Hedging). |
83
Der Erwerb ist nur auf Basis eines Hauptversammlungsbeschlusses zulässig, der mit einfacher Stimmmehrheit zu fassen ist und eindeutig zum Handel in eigenen Aktien ermächtigt.[161] Der Beschluss muss nach der gesetzlichen Bestimmung folgende Bestimmungen treffen:[162]
| (i) | die erworbenen Aktien sind dem Handelsbestand zuzuführen (genauere Fassung als „zum Zwecke des Wertpapierhandels“ ist nicht erforderlich[163]); |
| (ii) | der Handelsbestand am Ende eines jeden Kalendertags, 24.00 Uhr, darf 5 % des Grundkapitals nicht übersteigen; |
| (iii) | welchen höchsten und welchen niedrigsten Gegenwert (Kaufpreis) der Vorstand für den Rückerwerb aufwenden darf (üblicherweise in Form der Angabe eines Prozentsatzes vom jeweiligen Börsenkurs bei Ausnutzung der Ermächtigung[164]); |
| (iv) | genaue Festlegung der Ermächtigungsdauer von maximal fünf Jahren; |
| (v) | Angabe des Erwerbsvolumens von bis zu maximal 10 % des Grundkapitals. |
VIII. Ermächtigungsbeschluss
84
Schließlich ist ein Erwerb eigener Aktien zulässig, wenn der Erwerb auf einem Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG beruht. Der nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zulässige Erwerb eigener Aktien bedarf also eines vorhergehenden Hauptversammlungsbeschlusses. Mit diesem Beschluss ermächtigt die Hauptversammlung den Vorstand, eigene Aktien nach Maßgabe des Hauptversammlungsbeschlusses zu erwerben. Der Beschluss ist grundsätzlich mit der einfachen Stimmenmehrheit des § 133 Abs. 1 AktG zu fassen.
85
Schon bei der Vorbereitung des Hauptversammlungsbeschlusses muss der Vorstand die rechtlichen Grenzen einer Ermächtigung nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG beachten. Neben den allgemeinen Vorgaben für die Einberufung von Hauptversammlungen ist der vorgeschlagene Ermächtigungsbeschluss im Wortlaut mit der Einladung zu veröffentlichen. Der Vorstand muss dabei zum Einen die Ziele berücksichtigen, die er mit dem potentiellen Erwerb eigener Aktien verfolgen will, zum Anderen aber auch die rechtlichen Grenzen beachten. Größere Flexibilität der Ermächtigung bedingt gleichzeitig die Notwendigkeit einer noch gründlicheren Prüfung im Rahmen der Ausnutzung.
86
Im Wesentlichen hat der Hauptversammlungsbeschluss folgende Punkte inhaltlich festzulegen, wobei (lediglich) die ersten drei Punkte zwingend sind:[165]
| (i) | genaue Bestimmung der maximal fünfjährigen Ermächtigungsfrist, |
| (ii) | Festlegung des höchsten und niedrigsten Rückkaufpreises (üblicherweise durch relative Anbindung an den Börsenkurs), |
| (iii) | Angabe des Erwerbsvolumens von bis zu maximal 10 % des Grundkapitals, |
| (iv) | Zweck des Rückkaufs, |
| (v) | Erwerbs- und Veräußerungsarten, |
| (vi) | Angaben zum Bezugsrechtsausschluss, |
| (vii) | Angaben des § 193 Abs. 2 Nr. 4 AktG (bei Bedienung eines Aktienoptionsprogramms) und |
| (viii) | Möglichkeit der Einziehung der Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss. |
1. Erwerbszwecke
87
Der Erwerb eigener Aktien darf auf Basis eines Hauptversammlungsbeschlusses grundsätzlich zu jedem Zweck erfolgen, der nicht gegen sonstige zwingende gesetzliche Bestimmungen verstößt.[166] Ausweislich des Gesetzeswortlauts ist allein der Handel in eigene Aktien auf Basis eines Ermächtigungsbeschlusses verboten. Der Gesetzgeber wollte den fortwährenden Kauf und Verkauf eigener Aktien und den Versuch, Trading-Gewinne zu generieren, als Erwerbszweck verbieten.[167] Ferner wollte der Gesetzgeber die kontinuierliche Kurspflege durch Erwerb eigener Aktien nicht legalisieren.[168] Der Erwerb zum Zwecke der kontinuierlichen Kurspflege ist daher ebenfalls verboten.[169]
88
Abgesehen von diesen Ausnahmen ist ein Aktienrückerwerb zu den in § 71 Abs. 1 Nr. 1–7 AktG sowie insbesondere für folgende, nicht abschließende Zwecke interessant:[170]
| – | Ausgabe der eigenen Aktien an Dritte, z.B. institutionelle Investoren, |
| – | Einsatz der eigenen Aktien als Akquisitionswährung oder Gegenleistung im Rahmen eines Unternehmenserwerbs oder einer Verschmelzung, |
| – | Bedienung von Aktienoptionsprogrammen, |
| – | Erfüllung von Rechten aus Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, |
| – | Vorbereitung der Einziehung von Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss, |
| – | Abschaffung oder Rückführung speziell einer Aktiengattung, |
| – | Ermöglichung einer Einzelrechtsnachfolge, |
| – | Abwehr feindlicher Übernahmeversuche. |
89
Die Festlegung bestimmter Erwerbszwecke ist grundsätzlich möglich, jedoch nach dem Gesetz nicht zwingend.[171] Die Hauptversammlung kann jedoch die Ermächtigung an bestimmte Erwerbszwecke binden.[172] Eine Missachtung der von der Hauptversammlung vorgegebenen Zwecke durch den Vorstand führt zur Unwirksamkeit des Erwerbs eigener Aktien.[173]
90
Besonderheiten ergeben sich für den Hauptversammlungsbeschluss, wenn der Rückerwerb zur Bedienung eines Aktienoptionsprogramms erfolgt. Nach der gesetzlichen Verweisung gilt in diesem Fall § 193 Abs. 2 Nr. 4 AktG entsprechend. Das bedeutet, dass die gesetzlichen Anforderungen an die Auflage eines Aktienoptionsprogramms auch im Rahmen der Ermächtigung zum Rückerwerb eigener Aktien zu beachten sind.[174] Der Aktienoptionsplan muss nicht zeitgleich mit der Ermächtigung des Vorstands zum Rückerwerb eigener Aktien beschlossen werden.[175] Allerdings müssen die Eckdaten eines Aktienoptionsplans in den Ermächtigungsbeschluss aufgenommen werden oder auf ein bereits bestehendes Aktienoptionsprogramm verwiesen werden.[176] Dadurch wird sichergestellt, dass die Bedienung von Aktienoptionen aus eigenen Aktien nicht zu einer Umgehung der strengen Anforderungen bei Schaffung eines bedingten Kapitals zum gleichen Zweck führt.[177] Soweit eine Verweisung auf ein bestehendes Aktienoptionsprogramm nicht möglich ist, muss der Vorstand sicherstellen, dass folgende Angaben gem. § 193 Abs. 2 Nr. 4 AktG in den Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung aufgenommen werden:
| (i) | die Aufteilung der Bezugsrechte auf Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer, |
| (ii) | die Erfolgsziele, |
| (iii) | die Erwerbs- und Ausübungszeiträume sowie |
| (iv) | die Wartezeit für die erstmalige Ausübung von mindestens vier Jahren. |