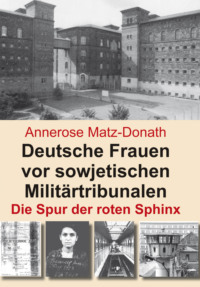Kitabı oku: «Deutsche Frauen vor sowjetischen Militärtribunalen», sayfa 7
Mein Mann war noch nicht aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Das Leben war schwierig. Die zwei kleinen Kinder – ich wußte kaum, wie ich sie satt kriegen sollte. Die Lebensmittelkarte für Hausfrauen? Ach, was es auf diese Karte gab, war zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig! Und arbeiten gehen konnte ich ja nicht – wer hätte denn auf die Kinder aufpassen sollen? Alle meine Verwandten waren ja jetzt, obwohl sie eigentlich gar nicht weit weg wohnten, ‚drüben’, im Westen. Um mir die Kinder zu hüten, waren sie jedenfalls unerreichbar, seit die Grenze mitten zwischen uns durchging.
Kurz und gut, ich fühlte mich ziemlich allein. Dann zog auch noch die russische Kommandantur in mein Haus. Das gab den letzten Anstoß dazu, dass ich die Kinder nahm und über die Grenze zu meinen Verwandten in den Westen ging. Über die ‚grüne‘ Grenze natürlich – anders ging es ja nicht. Es gab ja keinen regulären Reiseverkehr.
Eines Tages kommt dort, wo ich jetzt wohnte, der Walkenrieder Polizist in unser Haus. Walkenried war jetzt, wie gesagt, der westliche Grenzort. Ich kannte den Mann schon lange. Er erzählt mir etwas von einer Zeugenaussage, zu der ich unbedingt gebraucht würde. Es war alles ein bißchen unklar, ja. Aber er drängte und drohte, wenn ich nicht mitkäme, würde er mich von der westdeutschen Polizei zwangsweise hinbringen lassen. Denn Zeugenaussagen seien Pflicht. Und so setzte ich mich schließlich doch in sein Auto und fuhr mit. In Walkenried angekommen, ging es plötzlich direkt an die Grenze. Und ehe ich mich versah, hatten sie mich hinüber geschoben, und Russen nahmen mich in Empfang. Für Wodka hatte er mich an sie regelrecht verkauft.
Das war 1947. Und 1954 bin ich erst wieder aus der Gefangenschaft zurückgekommen. Sie hatten mir Spionage angehängt. Für was? Wohl, weil ich nach dem Westen gegangen war aus einem Haus – aus meinem Haus! –,in das die russische Kommandatura eingezogen war. Jedenfalls – ich war die einzige in meinem ‚Spionage-Fall’, den es doch gar nicht gab. Fünfzehn Jahre habe ich dafür bekommen.
Ach ja, und ‚Antisowjetische Propaganda’ war ja auch noch dabei. Sie hatten wohl in meiner Wohnung den Text gefunden, der damals überall umging: ‚Deutschland, Deutschland ohne alles, ohne Wurst und ohne Speck. Und das bißchen Marmelade frißt uns noch der Iwan weg…’. Wie es weiterging, weiß ich nicht mehr. War ja aber auch wahr. Die Leute haben gehungert, dass die Schwarte krachte. Dass meine Kinder hungerten und ich mir keinen anderen Rat mehr wußte, war ja auch der Grund, dass ich zu den Verwandten in den Westen gegangen bin.“
Ein altbeliebter Trick, um Menschen zu fangen, sind gefälschte Telegramme. Auch Lina Keßler, Krankenschwester in München, wurde so in die SBZ, wo ihr Elternhaus stand, zurückgelockt: Ihre Mutter liege im Sterben! Sie kam ohne Überlegen. Wer keine geheimen Dinge tut und nichts zu verbergen hat, hegt ja nicht leicht den Verdacht, dass ihm eine Falle gestellt werden könnte. Doch damals, jedenfalls in der östlichen Hälfte Deutschlands, konnte solch freundliches Menschenvertrauen leicht lebensgefährlich werden.
Auch der jungen Berlinerin Hatti Küster wurde Vertrauensseligkeit zum Verhängnis. Vor Ausbruch des Krieges hatte sie noch ihre kaufmännische Ausbildung abschließen können. Aber der Krieg ließ ihr dann keine berufliche Chance, wie den meisten jungen Leuten des Jahrganges 1922. Jetzt, Ende 1946, begannen die Lebensverhältnisse sich langsam wieder zu normalisieren. Nun konnte sie endlich versuchen, sich eine wirtschaftliche Existenz zu schaffen. Da kam ihr ein Angebot aus Sachsen gerade recht. Ein kosmetischpharmazeutischer Betrieb in Pirna suchte eine Einkäuferin in Berlin. Auch ein Vertriebsnetz sollte aufgebaut werden.
Der sächsische Unternehmer, der Frau Küster engagierte, war in der Nazizeit selber im KZ gewesen. Als Abteilungsleiter in einem großen Betrieb hatte er dienstverpflichtete französische Arbeiter ‚zu gut behandelt’. Eigentlich hätte die erlittene Verfolgung durch die Nazis ihn auch in der Besatzungszone der Sowjets vor neuen Repressalien schützen sollen. Aber die Kommunisten verziehen ihm nicht, dass er zwei Männer in seiner Firma beschäftigt hielt, die als ‚Nazis’ auf ihrer Liste standen. Würde er die nicht ‚feuern’, werde ihm der Betrieb geschlossen, drohten ihm die Behörden. Hatti Küster vermutete damals:
„Die beiden waren offenbar enge Freunde von ihm und sicherlich keine Nazis, wie die Kommunisten behaupteten. Jedenfalls hat er zu mir gesagt, wahrscheinlich wird es so kritisch werden, dass ich meine Firma in Pirna aufgeben muß.
Seine Frau war Französin. Deshalb bekam ihr Kind Pakete vom Französischen Roten Kreuz. Eines habe ich am Kurfürstendamm, wo die Stelle war, mal abgeholt für den Kleinen. Ja, und jetzt habe ich nun auch rumgeforscht, wie ich dem Manne sonst noch behilflich sein könnte, wenn es mit der Firmenaufgabe ernst werden sollte.
Ich besuchte damals noch eine Dolmetscherschule für Englisch in der Reinecke-Straße. Ein gewisser Dr. Paul, der da auch Englischunterricht nahm, arbeitete als deutscher Zivilangestellter im Hauptquartier der Franzosen in Berlin, dem sogenannten Quartier Napoléon. Diesem Mann habe ich mal erzählt, was mein Chef für Probleme hat. Da sagte er, ‚Na, da könnte ich helfen. Da muß ich mal mit meinem Chef sprechen. Wenn der in Pirna also in Not gerät …’
Es verging wieder eine Zeit. Dann habe ich nach Pirna geschrieben, also, es wird eine Möglichkeit geben. Ich habe jemanden, der wird uns helfen. Und dieses Gespräch, dieser Kontakt war der Anlaß für meine Verhaftung.“
Ein Umzug von Ost nach West, vor allem nach Westberlin, wäre damals nicht ohne weiteres möglich gewesen. Es bedurfte in jedem Fall einer Zuzugsgenehmigung, und die war nicht leicht zu erlangen. Denn Berlin war weithin zerstört. Um einen ganzen Betrieb zu verlagern, waren noch manch anderen Hürden zu überwinden. Ohne die Zustimmung der Besatzungsmacht, die jeweils in ihrem Sektor zuständig war, wäre gar nichts gelaufen. So erwies es sich als Chance, dass Dr. Pauls Kontakte zu Westberliner Besatzungsämtern einige Türen öffnen konnten. Alles in allem ging es um eine offene, harmlos-zivile Angelegenheit, wie sie auch heute nichts Ungewöhliches wäre – mit dem Unterschied allerdings, dass heute keine Erlaubnis irgend einer Besatzungsmacht mehr eingeholt werden muß.
So also war die Lage damals. Eines Tages dann plötzlich Hatti Küsters Verhaftung:
„Die haben mich förmlich weggelockt – am Kurfürstendamm, wo ich wohnte – richtig weggefangen. Es war so: Eines schönen Tages kam ich gerade von einem geschäftlichen Gang nach Hause. In Reinickendorf hatte ich eine Firma besucht. Meine Mutter empfing mich :’Du, da war ein junger Mann hier, der wollte dich sprechen. Er kommt nachher nochmal, hat er gesagt.’ Dann kam er tatsächlich. Später habe ich herausgefunden, es war schon einer vom NKWD. Aber er war in Zivil.
Ja, sagte dieser junge Mann, also der Dr. Paul wolle mich mal sprechen. Aber er sei sehr in Eile gewesen und deshalb nicht dazu gekommen, mir Bescheid zu sagen. Jetzt säße er da und da in einem Lokal – das ich kannte – und warte dort auf mich. Er sei gebeten worden, mich da hinzubringen.
Ja – ich bin wirklich mitgefahren. Warum sollte ich auch nicht? Der Mann wollte mich ja zum Treffen mit jemandem fahren, eben dem Dr. Paul, den ich inzwischen wirklich gut kannte. Wahnsinn, dass ich freiwillig ins Auto eines mir fremden angeblichen Boten einstieg, denke ich heute. Freiwillig!“
Man schrieb 1947, die Grenzen zwischen allen Sektoren Berlins waren offen. Jeder konnte ungehindert aus den westlichen in den östlichen, den sowjetisch besetzten Teil Berlins gelangen und umgekehrt. Welchen Nutzen die Sowjets aus dieser Regelung zogen, welche Gefahr für die Bewohner der westlichen Teile der Stadt darin lag, das drang erst sehr langsam und viel zu spät ins Bewußtsein der westlichen Öffentlichkeit. Und so nahm das Unheil seinen Verlauf:
„Im Auto warteten ein paar Männer, zwei vorne, einer hinten. Kaum dass ich drin saß, fuhren sie los. Ich dachte mir noch immer nichts Böses. Wie hätte ich auch? Es gab doch in meinem Leben nichts, was mir jetzt hätte Angst machen können! Wir haben uns noch über Gott und die Welt unterhalten dahinten im Auto. Ich achtete gar nicht darauf, wohin es ging.
Plötzlich hielt der Wagen, ein Russe stand da: Sektorengrenze, Paßkontrolle. Alle gaben ihm ihren Ausweis hin und ich auch, aber meinen behielt er. ‚Da stimmt was nicht’, sagte er. Und ich mußte rein zur Kommandantur. Da saß ich dann allein im Zimmer. Nach vielleicht einer halben Stunde kam endlich einer. ‚Mein Gott, was ist denn los?’, habe ich ihn gefragt. ‚Ich muß wieder weiter’. Und da antwortet der ganz kühl: ‚Nix weiter. Du bleibst jetzt hier!’ Dr. Paul sitzt unten, hat er gesagt, und ‚Nix mit nach Hause!’“
Sieben Jahre sollte es dauern, bis für Hatti Küster der Weg nach Hause wieder frei war – sieben Jahre von zwanzig für „Spionage für die Amerikaner“, zu der ein Militärgericht sie verurteilt hatte. Tatsächlich wurde sie nur dafür bestraft, dass sie geholfen hatte, im Zuge der geplanten Umsiedlung eines Unternehmens Verbindungen zu einer zuständigen Behörde herzustellen. Um es auf die knappste Formel zu bringen: Frau Küster wurde ein Opfer des sowjetischen Zorns, dass Moskau im Westen Deutschlands und Berlins nicht mehr mitzureden hatte und die Menschen, wo irgend es ging, aus seinem Herrschaftsbereich zu entkommen suchten.
Die Geschichten, die erfunden wurden, um jemandes in Westberlin habhaft zu werden, machten nicht immer Sinn. Doch immer erfüllten sie ihren Zweck. So auch im Fall der Eva Reuter, einer gerade dreißigjährigen jungen Ehefrau aus dem amerikanischen Sektor von Berlin. Es war im Oktober 1945. Noch heute, obwohl inzwischen die Berliner Mauer gefallen ist, spricht Frau Reuter nicht ganz ohne Angst von der Vergangenheit. Ihren wirklichen Namen und genaue Bezeichnungen ihrer verschiedenen Arbeitsstellen will sie ausdrücklich nicht veröffentlicht sehen:
„Eigentlich war ich Sekretärin, früher – vor dem Krieg – auf einem ausländischen Generalkonsulat in Berlin, und dann, als die diplomatischen Beziehungen zu diesem Land abgebrochen worden sind, habe ich auf der Schweizer Gesandtschaft gearbeitet. Zuletzt – nach der Kapitulation – ging ich zu einer amerikanischen Zeitung, als Dolmetscherin.“
Später, zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung, war sie bei der englischen Militärregierung als Übersetzerin und im Publikumsverkehr tätig. Dorthin kamen auch Polen – polnische Offiziere, die nach England gehen wollten. Frau Reuter maß dem damals keine Bedeutung bei. Es war der Alltag des Büros, und Spektakuläres trug sich dort nicht zu. Weiter erinnert sie sich:
„Ein einziges Mal kam auch ein Russe hin. Daran kann ich mich noch genau erinnern – auch, weil der so was Komisches gesagt hat. Er hat gerufen: ‚Auf Wiedersehen Rußland, guten Tag England!’ – Ich weiß nicht, ob der meinetwegen da war, um mich zu sehen oder was. Darüber habe ich mir aber erst hinterher Gedanken gemacht, als ich verhaftet worden war.
Eines Tages jedenfalls – also, ich war nicht da, es muß wohl abends gewesen sein – kamen zwei zu mir nach Hause, zwei Zivilisten, und haben nach mir gefragt. Weil nur mein Mann da war, haben sie gesagt, sie kämen später noch einmal wieder.
Am selben Abend erschienen sie zwar nicht noch einmal, aber am nächsten Morgen. Es klingelte sehr früh – mag sieben Uhr gewesen sein oder so. Vorgestellt haben sie sich nicht. Sie fielen gleich mit der Tür ins Haus: Bei einem Polen hätten sie Schmuck gefunden. Und – ja, der Mann hätte den Schmuck gestohlen und meine Adresse dabei gehabt.
Ich denke, wie kommt ein Pole zu meiner Adresse? In meiner Dienststelle war meine Privatadresse überhaupt nicht bekannt. Ich möchte bis heute wissen, woher die Russen sie hatten! Also, sie hätten meine Adresse bei dem Polen gefunden. Und dann plötzlich die Wendung: ‚Aber entschuldigen Sie, das sind Sie nicht. Der Mann hat Sie ganz anders beschrieben!’ Und weg waren sie.
Ja. Da hatten sie mich also gesehen, nicht? Etwas später wollte ich zum Dienst gehen. Ich dachte immer noch über die Sache nach. Alles kam mir so komisch vor! Mir fehlte überhaupt kein Schmuck. Und wie soll einer, der etwas gestohlen hat, hab ich mich geärgert, zu meiner Adresse kommen?
Wie ich aus dem Haus komme, da stehen die beiden noch unten, an ihrem Auto. Und wie ich noch so gucke und nicht weiß, soll ich mich wundern oder nicht, da kriegen sie mich zu packen, stoßen sie mich in den Wagen rein – und weg.
Es war eine fürchterliche Fahrt. Sie rasten, als ob der Teufel hinter ihnen her wäre. Mich hielten sie so fest zwischen sich geklemmt, dass ich kein Glied rühren konnte und kaum noch Luft bekam. Dann sind sie nach Seehof – ja, Seehof hieß das, wo sie mich zuerst hingebracht haben. Dort wollten sie uns nicht reinlassen. Es war ein Schlagbaum da und ein Posten. Die mich abgeholt hatten, haben ihre Ausweise gezeigt, und es ging hin und her. Einer von ihnen war übrigens unterwegs wieder ausgestiegen – wahrscheinlich, um den Nächsten zu holen.
Ja, so haben sie mich mit einem Zivilauto 1945 aus dem amerikanischen Sektor Berlins geholt, um mich wegen Spionage einzusperren.“
Das „Seehof“, von dem Frau Reuter spricht, liegt in Teltow bei Berlin. Inzwischen hat sie sich einmal die Villa angeschaut, in deren Waschküche sie zu Anfang mit zwei gefangenen Russinnen zusammen eingesperrt war. Ihr erster Vernehmer, ein sehr brutaler Typ, bestand darauf, sie sei eine Engländerin. Auch ihr deutscher Ausweis machte ihn darin nicht irre. So ging das hin und her:
„Immer, wenn er mich anschrie, ich sei aber doch eine Engländerin und ich zurückschrie ‚Nein!’, kriegte ich einen Tritt ans Schienbein. Ich habe heute noch die Narben davon. Das war alles wund und entzündet. Er haute auf den Tisch – und ich bei meiner Antwort auch. Und immer wieder Tritte gegen das Schienbein. Ich bin dabei oft ohnmächtig geworden.
Einmal, als ich wieder aus einer Ohnmacht aufgewacht bin, bin ich weggelaufen – einfach durch die Tür – an den dösenden Posten, die an der Haustür lehnten, vorbei und die Straße entlang. Ein Posten gleich hinter mir her. Der konnte schneller laufen als ich. Und so haben sie mich natürlich gleich wieder eingefangen.“
Für den Fluchtversuch mußte sie bitter büßen:
„Danach wurde ich in ein dunkles, schmutziges Verließ gesperrt – im Keller, in den kalten und feuchten Winkel unter der Treppe. Da blieb ich dann, bis man mich nach Hohenschönhausen transportierte.“
Noch immer glaubte Frau Reuter – wie viele andere Gefangene jener Jahre anfangs auch –,ihre Verhaftung könne doch nur auf einem Irrtum beruhen:
„Ich glaubte fest, ich käme wieder raus, wenn alles aufgeklärt sei! Denn man dachte und reagierte am Anfang ja noch so wie draußen, wie ein freier Mensch. Solchen Irrsinn, wie man ihn dann tatsächlich erlebte, hielt man damals ja noch gar nicht für überhaupt möglich!“
Weder in der Nazizeit noch unter der Besatzung hatte Frau Reuter sich an irgend einer Unternehmung beteiligt, die ihre beschriebenen beruflichen Tätigkeiten überschritten hätte. Was ihr nun zustieß, machte sie fassungslos – so tief fassungslos, dass es sogar die Erinnerung an das Urteil löschte, obwohl es ein Todesurteil gewesen war, das erst nach qualvollen Monaten durch „Begnadigung“ außer Kraft kam. Erst die Dokumente, die sie mit ihrer Rehabilitierung erhielt, hoben die Blockade auf. Doch aus dem Fegefeuer, das sie damals durchlitt, lodert noch heute die Angst, die sie wünschen läßt, anonym zu bleiben.
Grenzerfahrungen
Mangelndes Unrechtsbewußtsein – auch einer anderen Westberlinerin, der Studentin Barbara Passaro, wurde es zur Falle. Eine sogenannte gute Bekannte hat diese 1947 zuschnappen lassen. Das klappte um so leichter, als Barbara Passaro oft ihre Eltern in Potsdam besuchte. Die Stadt gehörte zur Sowjetischen Besatzungszone, während Barbara in Westberlin lebte. Doch sie studierte an der Humboldt-Universität, die wiederum in Ostberlin lag, im sowjetischen Sektor der Stadt. Eine verzwickte Sache. Aber so war das damals, kurz nach dem Krieg. Mit Freunden zusammen gehörte Frau Passaro einer nicht-sozialistischen Studentengruppe an. Sie erzählt:
„Ja, und ich bin also wieder in Potsdam bei meinen Eltern zu Besuch, übers Wochenende. Montag früh wollte ich wieder nach Berlin zurück. Und dann kam dieses Mädchen – den Namen habe ich längst vergessen, die verkehrte bei uns und besuchte mich, wenn ich in Potsdam war. Ja, die kam mich also abholen. Von Beruf war sie Goldschmiedin und arbeitete jetzt nur für Russen. Sie wußte von unserer Gruppe. Wir waren – ich will nicht sagen, parteipolitisch, aber interessenpolitisch verbunden. Ich sage also, ich will mit der Straßenbahn fahren. Ach, sagt sie, wir laufen ein Stück, und geht den Weg voran. Ich werde das nie vergessen. Damals existierte ja noch der Kanal in Potsdam, der heute zugeschüttet ist. An der Französischen Straße kommt ein Privatauto an, ein russisches, stoppt uns, einer steigt aus und sagt, wir möchten die Ausweise zeigen. Ich hatte einen für Potsdam gültigen, weil ich ja meine Eltern dort hatte. Trotzdem hieß es, wir sollten mal beide mitkommen, da wäre irgend etwas zu klären. Ich sage, nee, ich sehe nicht ein, warum ich mitkommen soll. Na ja, das würde ganz schnell gehen und es wäre bloß eine Papierangelegenheit. Das Mädchen an meiner Seite sagte noch, nun mach doch kein Theater, steig ein.
Die wurde am Abend entlassen, und ich blieb neun Jahre – von fünfundzwanzig, zu denen ich wegen ‚Kultur-Spionage‘ verurteilt worden bin.“
Um was es sich dabei handelte? Wie an allen Universitäten im besetzten Deutschland gab es auch an der Humboldt-Universität in Berlin sogenannte Kultur-Offiziere. Auf dezente Weise überwachten diese meist sehr gebildeten Besatzungsvertreter den offiziellen Lehrbetrieb. Sie nahmen aber auch Einfluß auf die studentischen Hochschulgruppen. An den Universitäten in den vier Besatzungszonen gab es dabei keine Probleme. Doch Berlin war damals noch eine offene Viermächtestadt. Deshalb waren alle vier Alliierten an der Humboldt-Universität mit eigenen Kultur-Offizieren präsent. Wie die Hochschulgruppe der SED sich an die Sowjets hielt, so gingen die Engländer, die Franzosen und Amerikaner bei den freiheitlich und liberal orientierten Studenten-Clubs ein und aus. Um Kontakte solcher Art, völlig offen und zwischen den Besatzungsmächten abgesprochen, ging es in der Sache Passaro und Kommilitonen. Der Fall – zusammen mit verschiedenen Vorkommnissen ähnlicher Art – führte bald nach den Verhaftungen zur Gründung der Freien Universität im Westteil Berlins.
„Ja, ich habe die Russen eben unterschätzt. Ich habe sie wohl auch für irgend eine Art Demokraten gehalten, damals jedenfalls noch“, seufzt Barbara Passsaro in resignierendem Rückblick. An ihren Abschied von der Mutter an jenem verhängnisvollen Montagmorgen im Jahr 1947 denkt die Germanistin nur mit stillem Schaudern zurück:
„Ich hatte mich mit meiner Mutter an diesem Morgen so ein bißchen rumgekabbelt – es gibt ja immer mal Differenzen zwischen Mutter und Tochter – und dabei sagte ich noch: ‚Jetzt gehe ich, und nimmer komm ich wieder!’ Das werde ich nie vergessen. Ich meinte natürlich – ich habe einfach aus Schillers ‚Johanna von Orleans’ zitiert!“
In diesem Drama hat das Zitat keine tiefere Bedeutung. Man benutzt es eigentlich nur in scherzhafter Weise ob seines Wohlklangs. Doch nun verkehrten die Worte sich in die tragische Ironie einer ungewollten Prophezeiung. Als habe sich damals plötzlich ein Zipfel der Decke lüften wollen, die die Zukunft vor den Augen der Menschen verbirgt. Doch das ist nur in der Rückschau zu erkennen. Oder handelt es sich nur um puren Aberglauben, der Zufällen zu viel Bedeutung beimißt? Auch Betty Prüfer erinnert sich:
„Bernard Koenen, Abgeordneter der SED im Provinzial-Landtag in Halle und einer der bedeutenden alten deutschen Kommunisten, war mir gut bekannt. Bei wie vielen Diskussionen hatte ich ihm nicht schon gegenüber gesessen! Wenn ich ihn auch aus politischen Gründen nicht schätzte – an seiner Gesichtsverletzung hatte ich mich bis dahin niemals gestört. Man hörte, SA-Leute hätten ihm 1933 ein Auge ausgeschlagen.
Eines Tages begann es. Es war wie eine Besessenheit: Wenn ich Koenen nur sah, packte mich ein Gefühl der Bedrohung – als schaue aus seinem leblosen gläsernen Auge ein böses Schicksal, mein eigenes Schicksal, mich drohend an. Bis heute, über den Abgrund von fünf Jahrzehnten, starrt dieses harte Auge noch immer zu mir herüber!
Es war nicht das einzige, das mich immer wieder zu quälen begonnen hatte. Kam ich an Kellerfenstern vorbei, dachte es in mir ‚GPU-Keller’, ohne dass ich mich dagegen hätte wehren können. Schließlich, eines Sonntagabends, als ich Einlaß in mein Großelternhaus begehrte, wurde mir nicht geöffnet. Die Haustürglocke hatte plötzlich und ohne Grund versagt, wie sich später erwies. Das einzige Hotel in der kleinen Stadt, in das ich mich für die Nacht nun zurückziehen mußte, war offenbar von Besatzungssoldaten geplündert worden. Jetzt jedenfalls standen nur halb verrostete eiserne Bettgestelle mit schütteren Strohsäcken ohne Bettwäsche in den Zimmern. Ich hatte so elende Räume bis dahin noch niemals gesehen – genau wie im ROTEN OCHSEN, dem Zuchthaus in Halle. Zwei Tage später bezog ich dort und für Jahre ein ähnliches Domizil.
Zufall? Vorspuk? Schließlich ein Letztes: Wenige Tage vor der Verhaftung war mir grundlos ein Ring zerbrochen, ein Hochzeitsgeschenk des Mannes, der mich bald verlassen sollte.“
Auch durch die Erinnerung einer anderen SMTerin geistert ein zerbrochener Ring. Tessa Schober fiel er ohne erkennbaren Anlaß von der Hand. Sie erschrak aufs Tiefste. Denn der Schmuck war die Gabe der guten Fee ihrer Kindheit gewesen, das Geschenk einer sehr geliebten Tante. Es war am Abend vor ihrer Verhaftung, als ihr der Reif zersprang – dem letzten Abend für viele Jahre, den sie als freier Mensch erlebte.
Ob sich auch Gela Hemmann noch manchmal der eisigen Hand erinnert, die ihr in der Nacht vor ihrer Verhaftung über die Stirne strich und sie weckte? Ein Luftzug? Doch Fenster und Tür waren dicht und fest geschlossen.
Noch sehr viel tiefer ins Unbegreifliche aber ragt eine Geschichte, die zwei Schwestern in Halle kurz vor ihrer Verhaftung erlebten. Eine Warnung des Schicksals? Vergebens. Zwar hätten beide sich durch eine Flucht noch retten können. Aber warum? Denn Heide und Aline Goll waren sich nicht der geringsten Schuld bewußt!
Nach einer leidvollen Odyssee aus dem Sudetenland, die die Familie trennte, hatten die beiden Mädchen ihre sehr alten Eltern in Halle wiedergefunden. Schon 1946 faßten sie dort wieder festen Fuß in ihrem alten Beruf. Denn Sekretärinnen brauchten auch die neuen Verwaltungsorgane, die jetzt aufgebaut wurden. Eines Tages das geheimnisvolle Ereignis:
„Unsere Mutter mußte ins Krankenhaus. Sie hat ja auch nichts zu essen gehabt. Ich habe noch Mehl organisiert, dass man ihr dort wenigstens ein Mehlsüppchen machen konnte. Es stand schlimm, ganz schlimm um sie. Dann sind wir benachrichtigt worden, dass wir kommen sollten. Es ginge zu Ende mit ihr.
Als wir kamen, lag sie schon in Agonie. Und sagt uns dann plötzlich – also, sie hat die Augen geschlossen gehabt, macht sie dann plötzlich auf, schaut mich ganz groß an und sagt: ‚Was, ihr kommt? Ich denke, ihr seid verhaftet!’
Wir waren wie aus allen Wolken. Ja, warum und weshalb und … ? Sie hat dann ein bißchen wirr schon gesprochen, gesagt, es ist ein Telegramm gekommen, da stand drinnen, dass wir verhaftet sind. Russen hätten uns verhaftet. ‚Und wenn du den Schrank zur Seite schiebst’ – ein leerer Spind stand in dem Zimmer – ‚wenn du den Schrank zur Seite rückst, da ist ein Fenster, da schauen dauernd Russen rein!’ Ich habe den Schrank zur Seite gerückt, es war nichts da. Es war so ein Wehrmachtsspind. Es war natürlich auch kein Fenster da, kein gar nichts, also. Ja, und dann kam auch bald die Schwester, wir sollen unsere Mutter nicht ansprechen und nicht mehr mit ihr reden. Wir machten es ihr sonst nur noch schwerer, das Sterben.
Es war sonderbar, sonderbar! Nein, ich lasse mir das nicht nehmen: Es gibt etwas zwischen Himmel und Erde, das ein lebender Mensch nicht erfassen kann. Dass einer, der schon am Sterben ist, Dinge sieht oder erfährt – oder wie, ich weiß nicht – und sie dann eben noch ausdrücken kann, wenn er angesprochen wird.“
Gibt es also doch ein Schicksal, das vorbestimmt ist?
Kurz darauf jedenfalls, man schreibt den August 1948, wird erst Heide geholt. Nur zu einem kurzen Gespräch, wie man ihr sagt. Dann, Tage später, ist auch Aline dran. Diesmal ein anderer Vorwand: die Schwester wolle sie sprechen und bäte um einen Mantel. Und so macht sich Aline mit einem Mantel auf den Weg.
Warum beide verhaftet wurden? Eine wie die andere versichert bis heute glaubhaft:
„Mir ist das schleierhaft. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß es bis heute nicht.“
Aus den Vernehmungen konnten sie seinerzeit nichts erkennen, was ihre Lage hätte erklären können. Nur so viel reimte sich Heide zusammen:
„Ich nehme an, dass sie einen Menschen, ob Mann oder Frau, als Grenzgänger geschnappt haben, der meine Adresse hatte. Wie ich nämlich von der GPU kam und in den ROTEN OCHSEN, also aus dem Keller in der Luisenstraße in das Zuchthaus von Halle – wie ich da also einpassiere, muß ich vorne, an der Pforte, warten. Das hat vielleicht ein paar Minuten gedauert. Und da brachten sie einen jungen Mann, der hielt mit beiden Händen seine Hose. Die Schuhe – damit ist er auch so geschlurft, weil keine Schnürsenkel drinnen waren. Den also haben sie an mir vorbei patroullieren lassen – sozusagen. Und dann wieder zurück. Ich habe den nur angeschaut und mir im Stillen gedacht, ach, du Armer, hast du dasselbe Schicksal wie ich?
Ich habe den nicht gekannt. Aber ich nehme an, dass das wie quasi eine Gegenüberstellung war. Denn sonst waren die Russen doch so sehr darauf bedacht, dass kein Gefangener einen anderen sah! Es ist kein Wort gefallen, gar nichts. Es standen natürlich Russen dabei, die haben uns gemustert. Anscheinend wollten sie feststellen, ob man einen Blick wechselt, dass man sich erkennt oder irgendwie so etwas. Aber wie die sonst alle Gefangenen streng auseinander hielten – Zufall kann das kaum gewesen sein. Irgendwas haben die sicher damit bezweckt. Aber ich habe den bloß eben angeguckt. Und weiter war nichts. Und dann haben sie mich natürlich in die Zelle reingesperrt.“
Das Urteil lautete für beide Schwestern auf fünfundzwanzig Jahre Zwangsarbeit. Wegen „Verdachts auf Spionage“, und sie wüßten heute noch gerne, wofür. Denn es war zwar nichts Ungewöhnliches, dass Menschen verhaftet und verurteilt wurden, weil – zum Beispiel – ihr Name im Adressbuch eines Dritten gestanden hatte – einer Person, die den Sowjets vielleicht verdächtig geworden war oder den sie einfach so an der grünen Grenze aufgegriffen hatten. Doch in solchen Fällen klärten sich die Zusammenhänge spätestens vor dem Tribunal, wenn alle Opfer einer Kettenverhaftung als Mitglieder einer angeblichen Spionagegruppe oder Untergrundorganisation dort zusammentrafen. Die beiden Schwestern aber standen für angebliche Spionagetaten – nein, für Spionageverdacht – ganz allein vor dem Tisch des sowjetischen Militärgerichts.
Der kleine Grenzverkehr über die grüne Grenze war übrigens damals eine durchaus normale Sache. Das war aus der Not geboren. Wer Onkel und Tante in Hamburg oder München wiedersehen wollte, wer nach Angehörigen suchte, die auf der Flucht verloren gegangen waren, wer die eigenen knappen Lebensmittelrationen ein bißchen durch Westware aufbessern wollte, dem blieb kein anderer Weg. Denn die Demarkationslinie zwischen der östlichen und den westlichen Besatzungszonen, die spätere „Interzonengrenze“, hatte alle regulären Verkehrsverbindungen radikal zerschnitten. In den seltensten Fällen gab es politische Motive für diesen kleinen Grenzverkehr.
Wie hätte ein Grenzgänger, wie ein auf andere Weise den Sowjets verdächtig Gewordener aber an die Adresse der sehr zurückhaltenden Goll-Mädchen kommen können? Bis heute haben Aline und Heide darauf keine Antwort gefunden. Um so weniger, als niemand anderes aus ihrem Lebenskreis verhaftet worden war. Und als sie nach ihrer Heimkehr ihre wenigen Bekannten in Westdeutschland fragten, konnte keiner sich erinnern, jemals jemandem einen Auftrag an ihre Anschrift gegeben zu haben. Bestand vielleicht ein Zusammenhang mit der Dienstverpflichtung der Älteren während des Krieges als Schreibkraft auf einem Wehrbezirks-Kommando? Aber warum wurde dann zuerst die Jüngere verhaftet, wenn der Name der Älteren etwa in einem Soldaten-Notizbuch gefunden worden sein sollte? Eine geheimnisvolle Nachricht, die seinerzeit allerdings erst wenige Tage nach den Verhaftungen bei dem alten Vater eintraf, macht die Sache nicht klarer: Auf einer Postkarte riet eine fremde Frau den Mädchen, sofort zu verschwinden.
Offene Fragen. Viele offene Fragen nicht nur in diesem Fall. Mysteriös blieb für ihre Familie draußen zum Beispiel auch das Verschwinden der jungen Journalistin Jutta Kubowski aus Westberlin im Oktober 1949. Durch die Meldung eines Volkspolizisten bestätigte sich zwar schnell der Verdacht, dass sie in den Osten entführt worden sei. Doch warum? Die knapp über Zwanzigjährige verdiente sich als Reporterin ihre ersten journalistischen Sporen. Gelegentlich schrieb sie dabei zwar Kritisches über Ostberlin und die DDR. Doch dass sie dabei nie ein Blatt vor den Mund nahm, reicht nicht zur Erklärung aus. Kämpften doch täglich ganz andere journalistische Schwergewichte mit ihrer Feder an der gleichen Front. Und keinem von ihnen war bis dahin etwas geschehen.