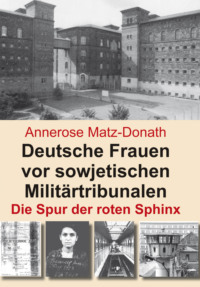Kitabı oku: «Deutsche Frauen vor sowjetischen Militärtribunalen», sayfa 6
Das traf mich besonders. War das der Grund meiner Existenz? Und war ich überhaupt nur darum als Person so verkehrt, weil ich eine so verkehrte Mutter hatte? Ich haßte sie dafür, dass sie so schlecht war und mich so allein gelassen hatte – und habe doch zugleich nach ihr und ihrer Liebe geweint. Ja, ich habe es schließlich geglaubt, das mit meiner Geburt. Als meine Mutter zurückkam, habe ich es ihr vorgeworfen. Es hat lange gedauert, bis sie mich überzeugte, dass es Lüge war.“
Als Studentin im Kriegseinsatz hatte Monikas Mutter sogar eine interessante Arbeit bekommen. Sie war als Prüfingenieurin angelernt worden und arbeitete in der Firma Telefunken in Erfurt im Endprüffeld der Rundfunkfabrikation.
„Natürlich, mein Vater sei nun gerettet, meinte Tante Pia. Denn in ihr habe er eine wirklich gute Frau gefunden. Doch zwei Probleme blieben: Was würde geschehen, wenn diese schlechte Person etwa zurückkommen sollte – trotz der fünfundzwanzig Jahre Strafe? Und: Wie sollte man die Entwicklung des Abkömmlings dieser schlechten Person zum Guten lenken? Denn für Tante Pia gab es keine Zweifel: Aus einer schlechten Wurzel kommt nur ein schlechtes Reis!
Heute weiß ich: In der streng katholischen Sicht der Pia hingen zwei große Flüche über dem Leben unserer kleinen Familie. Es war ihr eigener moralischer Zwiespalt, in ständigem Ehebruch zu leben – dazu noch mit einem evangelischen Mann! Und es war die Existenz einer minderwertigen Tochter von einer minderwertigen, ehr- und pflichtvergessenen Frau.“
Auch die Mutter, Betty Prüfer, erinnert sich – an die Briefe, die sie von ihrem Kind in die Zuchthauszelle hinein erhielt. Einer hat sich besonders tief in ihr Gedächtnis eingegraben. Eines Tages öffnete eine der besonders kalten und harten Wachtmeisterinnen ihre Zellentür, einen Brief in der Hand. Und ehe sie den herausgab, sagte sie, Mitleid in Stimme und Blick: „Sie wissen, ich bin Ihnen ja nicht eben freund. Doch sie tun mir leid! Ich bin ja selber Mutter.“ Und dann mußte die Gefangene lesen, was ihre kleine Tochter ihr zu sagen hatte:
„Schreibe mir doch nicht immer, du hast mich lieb! Wenn du mich wirklich lieb hättest, dann würdest du dich gut führen. Und dann hätten sie dich längst entlassen…“
Ob ein Kind von elf Jahren wohl selber solche Gedanken und solche Worte findet? Dass sie solchen Brief schrieb, daran erinnert sich Monika heute nicht mehr. Doch sie hat nicht vergessen, welche Fragen sie damals bewegten:
„Meine Mutter – wer war meine Mutter überhaupt? Alle Bilder, alle alten Briefe von ihr hatte mein Vater verbrannt. Ich konnte mir nicht einmal vorstellen, wie sie wohl aussah. Als sie mich in die Klinik geben mußte, war ich ja gerade zwei!
Niemand sagte mir jemals, dass sie in rechtswidriger Weise bei Ausübung ihres Berufes eingesperrt worden war. Keiner sagte mir, dass sie mutig für demokratische Prinzipien eingetreten war. Im Gegenteil, mit der Verhaftung war doch einer so bösen Person, die ‚Spionage getrieben‘ und ihre Familie vernachlässigt hatte, ganz recht geschehen, meinte ja meine Erzieherin Tante Pia. Dass sogar Spionage gegen die Sowjetunion – falls wirklich begangen! – eine Tat zum Schutze der Freiheit des Westens gewesen sein könnte – auch der Freiheit von Tante Pia! –,das kam keinem in den Sinn.
Mag sein, Tante Pia hat meinen Vater wirklich geliebt. Das zu beweisen bekam sie in späteren Jahren ausreichend Gelegenheit, als sie ihn vor seinem Tode lange pflegen mußte. Was sie tat, den ihr ins Nest gelegten Kukkuck zu einem ordentlichen Menschen zu erziehen, das tat sie jedenfalls aus Pflicht, wie sie sie verstand. Das sehe ich heute.“
„Tante Pia“ hat noch das Ende der Sowjetunion und den Zusammenbruch der DDR erlebt. Sie hätte erfahren können, dass die Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation in Moskau inzwischen das Urteil gegen die ehemalige Frau Kerner, heute Prüfer, aufhob und die von ihr so übel verleumdete Frau als „ohne Schuld und Grund verhaftet“ rehabilitierte. Doch keiner hat es ihr gesagt. Es hätte ihr wohl auch nichts bedeutet. Was sie einem ihr anvertrauten Kinde angetan hatte, ist ihr wohl ebenfalls niemals klar geworden.
2 Unabhängig vom Datum der Verhaftung durften die SMTer im Sommer 1949 zum ersten Mal das erste Lebenszeichen geben – ohne Absenderadresse. Erst ein Jahr später, im Sommer 1950, wurden ihnen bei strengster Zensur monatlich fünfzehn Zeilen nachhause und eine ebenso kurze Antwort von dort erlaubt. Zensiert wurde radikal und zwar mit der Schere. So glichen die Briefe der Eltern, Kinder und Ehegatten häufig fragilen Scherenschnitten. Manchmal kamen sogar nur unzusammenhängende Textfragmente bei den Gefangenen an.
3 476 von 1.314 gefundenen SMTerinnen-Karteikarten wiesen die Frauen als Mütter von zumeist mehreren Kindern aus
2. Die Hölle hat viele Tore
Alle Wege führen nach Rom, sagt ein altes Sprichwort. Dieses Bild von einem einzigen Mittelpunkt der Welt, zu dem alle Wege führen, hat seinen Ursprung in der Antike. Ursprünglich bezog es sich auf Athen als Zentrum von Wissenschaft und Kultur. Dass Rom im Gedächtnis der Völker bald an die Stelle der griechischen Metropole trat, dankt es seinen Cäsaren. Deren imperiale Politik schmückte die Hauptstadt nicht nur mit allem materiellen Reichtum der alten Welt. Roma aeterna – das ewige Rom – wurde auch zum geistigen Erben Athens.
Um ein Reich zu regieren, das alle Teile der damals bekannten Welt umfaßte, bedurfte es guter, schneller Verbindungswege. So machte Notwendigkeit die römischen Ingenieure zu großen Straßenbauern. Bald führten also – auch im ganz wörtlichen Sinne – alle Straßen nach Rom als dem Zentrum der Herrschaft. Den römischen Legionen folgten Wissen und mediterrane Kultur in die nördlichen Provinzen des Reiches. Deshalb steht der Name Roms bis heute für mehr als nur für Eroberung und Macht.
Als der römische Kaiser Konstantin um 330 n.Chr. Residenz und Regierungssitz von Rom nach Byzanz verlegte, gab er der neuen Hauptstadt – einem ehemaligen uralten griechischen Handelsplatz am Bosporus – nicht nur seinen Namen. Auf die neue Metropole Konstantinopel ging nach Konstantins ausdrücklichem Willen sowohl die reale Macht, wie auch der Nymbus der alten Hauptstadt über. So entstand im Osten des Reiches das „Zweite Rom“. Der Name war zu einem Ehrentitel geworden, doch zu einem, an dem ein realer Machtanspruch hing.
Als die Zeit der Römer zu Ende ging, nahm Konstantinopel wieder den alten Namen an. Doch Byzanz – und das Reich von Byzanz, wie es sich nannte – blieb das Zweite Rom – in seinem Selbstverständnis und in dem der Welt. Es bewahrte beides, die Macht und den Geist des ersten. So wurde Byzanz zur Heimstatt vieler Kulturen. Wissen und Kunst des Orients fanden von hier aus ihren Weg in die Mitte Europas. Und noch im Untergang, unter dem Ansturm der Türken, machte das Zweite Rom der Welt sein vielleicht größtes Geschenk: Die griechischen Gelehrten, die 1453 aus dem von den Türken eroberten Konstantinopel flohen, brachten die klassischen Überlieferungen der Antike nach Italien zurück. Die große Epoche der Renaissance nahm ihren Anfang.
Neben Rom war Konstantinopel-Byzanz das wichtigste Zentrum der Christenheit. So kamen vom Stuhle des Patriarchen die Missionare, die den Völkern Rußlands das Christentum brachten. Aber das griechisch-orthodoxe Bekenntnis kannte nicht – wie die lateinische Kirche – die Trennung von Thron und Alter. Das gab der engen religiösen Verbindung zwischen Byzanz und Moskau eine politische Dimension. Diese prägte das russische Staatsverständnis, das etwa zur gleichen Zeit entstand, wie die Macht von Byzanz zerbrach. Ein Mönch aus Pskow – sein Name war Filofei, Philotheos in griechischer Form – formulierte um 1510 den entscheidenden Satz, der Jahrhunderte überdauern sollte. Etwa siebenunddreißig Jahre vor Iwan Grosnys / des Schrecklichen Krönung zum ersten russischen Zaren schrieb dieser Filofei über Moskau, den künftigen Regierungssitz: „Zwei Rome sind gefallen, aber das Dritte besteht – und ein Viertes wird es niemals geben!“
Im Fortgang der Geschichte nahm die ursprünglich religiöse Idee immer stärker die Farbe politischen Sendungsbewußtseins an. An der Schwelle des zwanzigsten Jahrhunderts griff dieses – mit dem Panslawismus – schon einmal weit über Rußlands Grenzen hinaus. Und glaubten nicht auch die „Roten Zaren“ wie die Kommunisten in allen Ländern, in Moskau habe das Heil der Welt seinen Sitz und die Moskowiter handelten im Auftrage der Geschichte, dieses Heil aller Welt zu bringen? Die Hauptstadt der Sowjetunion sei „der Mittelpunkt der Welt“, erklärte noch 1975 in vollem Ernst ein höherer politischer Funktionär in Moskau einer erstaunten Deutschen. Sein Großvater hatte mit Lenin in der Verbannung gesessen. Über die Zeitläufe hin blieb also der Mythos lebendig.
Doch über Rom und über das Zweite Rom als Vermittler hatten einst die großen Kulturen der Völker zueinander gefunden. Auf den Straßen, die das Rote Dritte Rom mit der Welt verbanden, marschierte nur der Terror einher, und hinterdrein schlich die Angst! Das Grauen dehnte sich aus, so weit nur die Bajonette der Rotarmisten sowjetische Machtansprüche stützen konnten.
Für das, was seit 1917 in Rußland geschehen war und nun außerhalb seiner Grenzen begann, fanden der Russe Alexander Solschenizyn und der deutsche Dichter Heiner Müller kein besseres Bild als jenes, das Dante einst in seiner „Göttlichen Komödie“ beschrieben hatte: das Inferno der Verdammten, die Hölle. Solschenizyn, der den GULag am eigenen Leibe erlebte, wußte genau, wovon er schrieb. Doch auch Heiner Müller, dem erfolgreichsten Stükkeschreiber der DDR, floß später ein solcher Vergleich mit Dantes großem Schauergemälde in die Feder.
Eingefangen
Wie einst im eigenen Lande taten Stalins Schergen auch im besetzten Osten Deutschlands Tore zu vielen Höllen auf – zu unzähligen neuen Stätten der Qual und des Sterbens, aber auch zu alten, bekannten: den – scheinbar, angeblich – eben geschlossenen Hitler-KZs.
Der Weg dahin konnte sehr kurz sein. Für Angelika Tabbert, Pharmaziestudentin in Ostberlin, war er nicht weiter als bis zur nächsten Haltestelle des Busses, mit dem sie täglich zur Arbeit und abends nach Hause fuhr:
„Es war am 5. März 1947 in Ostberlin, in Pankow, wo ich großgeworden bin. Draußen lag Schnee, der vor Kälte knirschte. Deshalb hatte ich wenigstens einen Mantel an. Das hat mir später sehr geholfen, in Sachsenhausen.
Ja, also – meine Verhaftung. In Berlin-Niederschönhausen machte ich gerade mein Apotheken-Praktikum. Morgens und abends benutzte ich den Bus dorthin. Wie ich später herausfand, wußten sie, um welche Zeit ich an der Haltestelle stehe, weil sie mir wochenlang eine Spitzelin auf den Hals gehetzt hatten. Da haben sie mir aufgelauert und mich einfach von der Straße, von der Haltestelle weggeschleppt. Es waren drei Männer – nein, mehr! Sechs Russen müssen es wohl gewesen sein. Richtig ein ‚Großer Bahnhof‘! Die Kerle haben mich gepackt und buchstäblich kopfüber in das Auto gezerrt. Weg war ich. Meine Mutter hatte mindestens zwei Jahre überhaupt keine Ahnung, wo ich abgeblieben war! Ich kam einfach abends nicht wieder nach Hause – ohne einen Ton, ohne irgend ein Lebenszeichen.
Ach ja – natürlich habe ich getobt und aus Leibeskräften geschrien: ‚Ich will zur deutschen Polizei!’ – Aber die zerrten mich da einfach rein, kopfüber ins Auto – und ab. Dass ich mich so gewehrt habe, war aber trotzdem ganz gut. Dadurch waren Passanten aufmerksam geworden. Irgend jemand, der mich gar nicht kannte, hatte alles genau beobachtet und brachte es unter die Leute. Er muß mich sehr gut beschrieben haben.
Die Geschichte wurde wahrscheinlich dann im ganzen Stadtteil Gespräch. Jedenfalls, wie die Story von Mund zu Munde herumging, kam sie auch an eine Bekannte meiner Mutter. Was, hat die sich gesagt – wie hat das Mädchen ausgesehen? So und so? – Das ist doch Trudes verschwundene Tochter! Und ist gleich zu meiner Mutter gerannt: ‚Weißt du, wo Angelika ist? Die Russen haben sie geholt!’ – Daran konnte sich meine Mutter nun klammern. Aber ein rechter Trost ist das ja nun auch nicht gewesen, nicht wahr? Denn zwei Jahre hatte sie eben doch keine Ahnung, wo ich nun abgeblieben war. Erst im Sommer 1949 konnte ich aus Sachsenhausen zum ersten Mal ein Lebenszeichen geben. Und erst neuneinhalb Jahre später, genau auf den Tag, kam ich wieder nach Hause.“
Bleibt die Frage, was Angelika verbrochen hatte. Ihre Geschichte ist schnell erzählt:
„Am 5. März 1947 war ich verhaftet worden, am 5. September stand ich vor dem Kriegsgericht: Dwazadj ljet – Sibir! Zwanzig Jahre Sibirien wegen Spionage nach § 58 des Sowjetischen Strafgesetzbuches, hieß es da kurz und bündig. Und wofür? Ich war damals in einer Apotheke tätig und habe natürlich die Abführpillen und die Hustentropfen ausspioniert! – Ja, so lächerlich das klingt – aber die Anklage war auch nicht viel seriöser.
Mein Chef, der Besitzer der Apotheke, war Morphinist, was ich damals noch nicht einmal wußte. Aber dass er ganz böse, dunkle Schiebereien mit Medikamenten machte, war gar nicht zu übersehen. Um einen Mitwisser seiner krummen Geschäfte loszuwerden, hat er mich an irgend so einen Kommunisten verklingelt. Das war der Hauptgrund meiner Verhaftung.
Als Vorwand bot sich an, dass ich einen Engländer kannte. Er war ein biederer Familienvater in mittleren Jahren, ein bißchen dicklich und gar nicht so, wie man sich einen Engländer vorgestellt hat. Kennengelernt hatte ich ihn auf dem Schwarzen Markt. Denn ich rauchte damals schon, und die paar Zigaretten, die auf Bezugskarte zugeteilt wurden, reichten nicht hin und nicht her. So versuchte ich also, Zigaretten schwarz zu kaufen, und sprach diesen Mister Sowieso an. Er wollte mir welche schenken, aber das wollte ich nun wieder nicht. Woher ich denn so gut Englisch könnte, wollte er dann wissen. Ich konnte Englisch damals wirklich gut. Von neun Jahren Schulunterricht, sagte ich, und so gab ein Wort das andere, bis er bat, mal zu mir nach Hause kommen zu dürfen. Denn das war’s, weshalb er da so herumging: Er wollte gerne eine deutsche Familie kennenlernen.
Meine Mutter war einverstanden, und so kam er zu uns nach Hause, und wir spielten Rommé. Da er beim Kontrollrat Dienst tat, hatte er keine Probleme, in den Ostsektor Berlins zu kommen. Er ließ sich mit dem Wagen bringen und auch wieder holen. Die Stadt war ja damals sowieso noch völlig offen und ungeteilt.
Der Zufall hatte es gefügt, dass in unserem Sechs-Familien-Haus auch ein Russe einquartiert worden war, Ingenieur und jetzt Demontage-Offizier, auch nicht mehr ganz jung. Der kam auch zu uns herunter – und so hatten wir beim Rommé nun England, Deutschland und Rußland zusammen. Wir haben uns alle recht gut verstanden.“
Wer die Zeichen der Zeit zu lesen verstand, konnte im zweiten Jahr nach der deutschen Niederlage kaum noch übersehen, dass das Verhältnis der einstigen Alliierten zueinander erhebliche Risse bekommen hatte. Das bedeutete Gefahr für eine Völkerfreundschaft am Rommé-Tisch, der im Sowjetsektor stand. Hätte Angelika, hätte ihre Mutter, eine ältere Dame, das erkennen müssen? Beide hatten auf Politik nie einen Gedanken verwandt. So erinnert sich Angelika an jene Zeit:
„Ich ging früh in die Apotheke, wo ich jetzt Praktikantin war, und kam abends stracks nach Hause zu meiner Mutter zurück. Und da spielten wir dann ein bißchen Rommé oder dies und das und beschäftigten uns miteinander. Wie es politisch stand, erfuhr ich eigentlich erst in der Untersuchungshaft.“
In der ersten Vernehmung kam es deshalb zu einer fast komischen Szene. Denn auf den Vorwurf der Spionage, den man ihr machte, sagte sie anfangs im vollen Ernst:
„Was wollen Sie denn eigentlich von mir? Sie alle vier sind doch Verbündete, Alliierte!“
Angelika berichtet weiter:
„Ja, nun hatte mein Chef mich also denunziert, dass ich Kontakt mit Engländern hatte. Daraufhin hatten mir die Russen dann wochenlang eine deutsche Spitzelin auf den Hals geschickt. Eine Spitzelin – ja, eine Spitzelin war sie – auch wenn ich sie ja irgendwie verstehen konnte. Sie war mit einem SS-Mann verheiratet gewesen, der verschollen war. Nun saß sie da mit vier kleinen Kindern, die sie alleine durchbringen mußte. Diese Frau haben sie in die Mangel genommen. Wenn sie keine Leute bringen – also denunzieren – würde, dann würde man sie selber dabehalten. Und das bei vier unversorgten kleinen Kindern! Was soll man da sagen?
Ob es einen Haftbefehl gab? Keiner hat mir einen gezeigt. Ob ich später einen unterschrieben habe? Was weiß ich! Ich mußte ja vieles unterschreiben – in Russisch, was ich gar nicht lesen konnte. Dolmetscher? Natürlich gab es die. Aber was für welche! Die beherrschten ja kaum ihre eigene Muttersprache!“
Dolmetscher, Übersetzer einer großen Besatzungsmacht, die nicht einmal die eigene Sprache sicher beherrschten? Ob es das wirklich gegeben hat? Eine Moskauerin, Russin, Dolmetscherin für Deutsch, darf sicher als unverdächtige Zeugin gelten. Als ihr 1993 zum ersten Mal alte Vernehmungsprotokolle vor die Augen kamen, brach es spontan aus ihr heraus: Dieses Russisch sei so primitiv und so fehlerhaft, dass sie sich dafür schäme! Schwere sprachliche Mängel im Russischen waren beileibe kein Einzelfall, von den Übersetzungen ins Deutsche gar nicht zu reden.
Spitzel säumten auch weiter Angelikas Weg, dessen erste Station in einem Keller lag. Wahrscheinlich war das in der Schönholzer Straße in Ostberlin, gleich hinter dem Rathaus von Pankow.
„Es war in einem GPU-Keller, also einem stinkenden Kellerloch – ohne Decke, ohne Matratze, ohne alles! Kein Tisch, kein Stuhl, nur so eine Art Liege aus Brettern. Auf dem nackten Holz haben wir dann rumgelegen. Was natürlich auch verboten war. Am Tage durften wir nicht schlafen. Aber ich hatte es ganz schön raus: Beine angezogen, Kopf drauf, und wenn die da rumschlichen draußen, die Posten, da habe ich so mehr oder weniger im Halbschlaf in den Spion geglotzt. Und dann gingen die wieder vorbei.
Nachts war mit Schlafen auch nicht viel. Da mußten wir zum Verhör, d.h. ich. Die andere, mit der ich zusammenlag, war auch eine Spitzelin. Aber das merkt man ja immer zu spät! 51 Vernehmungen habe ich gezählt, 51mal nachts kein Schlaf und auch am Tage nicht. Und immer wieder runter in dieses stinkende Ding, das überhaupt keine Lüftung hatte. Ein tiefer Schacht, das Kellerfenster lag unten. Und oben waren Zementplatten draufgelegt – so, wie man heute Kellerschächte mit Betonplatten gegen Diebe sichert. Ich habe mich gewundert, dass ich das überhaupt ausgehalten hab – kein Strahl Tageslicht, keine Luft – und das vier Monate lang!
Ja, und dann wollte ich türmen. Ich merkte, ich wurde immer schwächer und schwächer. Die Spitzelin hat mich immer noch animiert, weil sie sich eine goldene Nase verdienen wollte. Regelrecht angetrieben hat sie mich, dass ich es auch ja versuche. ‚Mensch, mach! Hier krepierst du doch!‘ hat sie immer gesagt. Das sah ich genauso. Wir kriegten ja auch kaum was zu essen. Einen Liter Brühe gab es täglich – aber nichts als saures Wasser war das. Kein Gramm Fett, kein Fetzchen Fleisch! Ein paar Kohlblätter schwammen drin rum.
Mein Fluchtplan war ganz einfach, und ich hatte wirklich eine Chance – wenn es eben nicht verraten worden wäre. Wir mußten kübeln gehen, das heißt, einmal am Tage gingen wir die Blechkübel leeren, die uns das Klo ersetzten. Zum Kübeln ging es die Kellertreppe rauf in den Hausflur. Das war ein offener Durchgang zur Straße, der nur von einem Posten gesichert wurde. Ich dachte, wenn du da durchwetzt, dann kommst du eventuell raus. Die Gegend kennst du ja.
Die erste Möglichkeit zur Flucht ließ ich ungenutzt vergehen, da habe ich mich noch nicht recht getraut. Bei der zweiten Gelegenheit hatte ein anständiger Posten Dienst. Dem wollte ich keine Schwierigkeiten machen. Der dritte Posten, bei dem ich es dann probierte, war ein Schuft. Da wäre es nicht schade drum gewesen. Aber an dem Tage, an dem ich es nun versuchte, waren durch den Verrat die Posten verdreifacht worden! Ich sehe das und denke: ‚Trotzdem! Jetzt oder nie! Sollen sie doch schießen!’ Aber sie schossen nicht. Der eine stellte mir ein Bein, der zweite kriegte mich im Genick, und dann … wie eine nasse Katze reingeschleift, die Treppe runtergeschmissen …
Der Posten, bei dem ich fliehen wollte, hat mich dann auch verwalkt. Dass der nicht gerade rosig auf mich gesonnen war, konnte ich sogar verstehen – wo ich doch den vollen Schietkübel nach ihm geschmissen hatte, um ihn außer Gefecht zu setzen! Ach ja, noch was: Bei der Dresche ist mein Steißbein etwas ramponiert worden. Weil ich so fürchterlich mager geworden war, stand das jahrelang wie so ein kleiner Schwanz hinten raus.“
Eine beherzte Person und hart im Nehmen. Auf die Frage, ob auch die Vernehmer sie geschlagen hätten, nur die trockene Antwort:
„Nein. – Ach doch, ja. Aber das war nicht schlimm. Einmal hat er mir eine Akte auf den Kopf gehauen. Einmal zack! – Ich habe ja auch nur zwanzig Jahre gekriegt.“
Die Verurteilung fand in Lichtenberg statt. Auf dem Transport dorthin sah die Gefangene zum ersten Male nach Monaten wieder Tageslicht. Durch einen Fensterspalt konnte sie sogar verfolgen, wohin der Wagen fuhr: am Stadtrand entlang und durch Gärten, in denen Johannisbeeren reiften. Juni oder Juli mußte es also inzwischen geworden sein. Was für ein Wochentag, was für ein Datum? Sie wußte es nicht. Denn in dem dunklen Kellerverlies hatte sie längst jedes Zeitgefühl verloren.
Nach vier Monaten in solch einem Kellerloch erschien das Gefängnis Lichtenberg ihr jetzt wie das reinste Dorado:
„Ich kriegte sogar eine Decke! Vorher hatte ich nämlich gar nichts gehabt. Ich konnte mich nur in meinen Mantel rollen. Das war alles! Jetzt waren zwei hölzerne Liegen in der Zelle. Zu viert haben wir da quer gelegen, mit angezogenen Knien, ineinander verschachtelt. Da konntest du zwar nicht aussteigen, denn die Zellen waren zu schmal. Die Liegen füllten sie von Wand zu Wand fast völlig aus. Aber man hatte wenigstens eine Unterlage, so eine Art Matratze, nicht nur das nackte Brett wie vorher im Keller. Wir lagen jetzt im dritten Stock, hatten Schuten aus Holz vor den Fenstern. Wenn die auch bis oben hin an den Fensterrand reichten – ein bißchen Tageslicht kam ja trotzdem rein. Nachts brannte in Lichtenberg allerdings immer helles Licht. Deshalb kam man kaum in richtig tiefen Schlaf.“
Wann sie verurteilt wurde – am 5. September 1947, ein halbes Jahr nach der Entführung – das erfuhr Angelika erst jetzt durch die Rehabilitation. Und wofür sie ihre zwanzig Jahre bekommen hatte? Tatsächlich wegen Spionage. Die Begründung dafür hatte die Spitzelin aus dem Keller geliefert:
„Louise hieß sie, die da mit mir zusammen in der Zelle gewesen war. Die hatte versucht, mich auszuhorchen. Nur war nichts zu horchen, ich hatte ja überhaupt nichts getan. Und da hat sie gesponnen. Ja, hat sie den Vernehmern berichtet, ich hätte erklärt, ich wäre eine große Spionin, aber das würde ich niemals zugeben. Diese Spitzelausage kam nun ins Protokoll. Aber das wußte ich nicht. Das habe ich erst später gemerkt. Denn man hat mir zwar vorgelesen, was – angeblich – im Protokoll stand – d.h. man übersetzte es ins Deutsche. Von ‚großer Spionin’ war da nicht die Rede. Aber das, was ich unterschreiben mußte, war Russisch, in kyrillischer Schrift. So konnte ich eben selber gar nicht lesen, was ich eigentlich unterschrieb. Ich mußte einfach unterschreiben und tat dies auch. Denn ich wollte da nun endlich rauskommen! Ja, und so habe ich eben etwas ganz anderes unterschrieben, als was die mir vorgelesen haben.
Spionin! Große Spionin – bolschaja Spionka! – das sagte der Posten immer zu mir, den ich nicht ausstehen konnte. Es war so einer mit grünen Augen. Der riß immer die Tür auf zu unserem Kellerloch. ‚Bolschaja Spionka!‘ Und dann diese üblichen Flüche, die sie immer so sagten.
Die Louise war, glaube ich, zum 1. Mai freigekommen für ihre Spitzelei. Nachher wurde sie mir noch mal gegenübergestellt, als ich in Lichtenberg mein Urteil kriegte. Ich hatte keine Brille auf, und ohne Brille sehe ich ja schon gar nichts. Sie war aufgedonnert bis dorthinaus, dass ich sie gar nicht erkannte. ‚Kennen Sie mich?‘ Ich sage: ‚Nee.‘ Louise hat dann gesagt, wie es mit mir – angeblich – war, und ich habe dann gesagt, wie es wirklich war. Na, und dann haben wir das über Kreuz irgendwie unterschrieben, dass ich praktisch den Unsinn, den sie über mich erzählte, auch mit unterschrieben habe. Aber eben in Russisch. Es blieb mir ja gar nichts anderes übrig! Ich wollte nicht noch kaputt geschlagen werden – wie so viele von unseren Männern!“
Angelika wurde aus dem Osten, aus Ostberlin entführt. Aber auch im Westen Berlins zu wohnen, bot keine Sicherheit vor dem Zugriff des NKWD. Drei Jahre später, im Oktober 1950, spielte sich in der Harzer Straße in Berlin Neu-Köln eine ähnliche Szene ab. Das Opfer war eine zierliche junge Frau von 27 Jahren, Claudia Mühlstein:
„Die Grenze zum sowjetischen Sektor lief genau in der Straßenmitte. Später zog sich hier die Mauer lang. Aber ich bin ja lange vorher, schon 1950, verhaftet worden, viele Jahre vor dem Mauerbau. Damals standen da große Schilder: ‚Caution! You are leaving the American sector!’ -’Achtung! Sie verlassen den amerikanischen Sektor Berlins!’ Oder so ähnlich.
Ja, sie haben mich richtig weggefangen – wie ein Tier, dem man auflauert. Eingefangen. Einfach so, von der Straße weg.
Ich wollte ausgehen, ins Theater war es, glaube ich. Komme aus dem Haus auf die Straße, und neben mir fährt ein Auto. Und hält. Ein paar Männer in Zivil springen raus, ziehen mich rein und fahren sofort in den Ost-Sektor rüber, nach Hohenschönhausen. Dort wurde ich das erste Mal vernommen. Und dann ging es weiter nach Weimar“.
Die Reise führte schließlich noch weiter und sollte erst in Sibirien ihr Ende finden. Mehr als fünf Jahre wurde die zierliche Claudia dort bei schwerster Zwangsarbeit – Bäume fällen – festgehalten. Warum und wofür? Die Westberlinerin hatte für ihren im Osten wohnenden Cousin ein paar mal Briefe in Westberlin befördert. Den Inhalt kannte sie nicht. Wohl hätte sie sich denken können, dass die Post kaum ein Lob der Methoden enthalten würde, mit denen die Sowjets in ihrer Zone hausten, dass sie die östliche Propaganda als freche Lügen entlarven könnten. Denn Claudias ganze Familie – in Ost wie in West – war entsetzt und empört über die Vorgänge in der SBZ, wie man die Sowjetische Besatzungszone damals überall nannte. Aber können, dürfen Gedanken ein Grund zu Verfolgung und Verurteilung sein, sogar über Grenzen in fremdes Hoheitsgebiet hinein? Claudias Cousin, der Schreiber der Briefe in der Sowjetischen Besatzungszone, wurde übrigens weniger hart bestraft als sie – obwohl ja die Sowjets allenfalls ihn als ihr „Subjekt“, das heißt, als einen „Gehorsamspflichtigen“ hätten betrachten können.
So kurz der Weg ins Unglück für Angelika Tabbert und Claudia Mühlstein gewesen war, so weit sollte er sich für Agnes Globa strekken. Viele Kilometer führte er sogar über westdeutsche Autobahnen. In Westdeutschland hatte der Fall schließlich auch sein gerichtliches Nachspiel, nachdem Frau Globa im Frühjahr 1954 aus Hoheneck entlassen worden war. Ein vergilbtes Zeitungsblatt aus der GÖTTINGER ZEITUNG vom 25. Mai 1955 erzählt die Geschichte, die man kaum für wahr halten möchte: „Menschenraub nach acht Jahren gesühnt. – Ehemaliger Polizist um Mitternacht im Gericht verhaftet“, heißt es da. Und weiter:
„Über acht Jahre, nachdem das schwere Verbrechen des Menschenraubes an der Zonengrenze bei Walkenried begangen worden ist, konnte es jetzt gesühnt werden. Der damalige Polizeimeister in Walkenried, Hermann J., wurde jetzt von der Großen Strafkammer in Göttingen (…) wegen Beihilfe zur erschwerten Freiheitsberaubung zu zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt und um Mitternacht, als das Urteil verkündet wurde, sofort im Gerichtssaal verhaftet. – Erst nachdem die heute 44jährige Verschleppte nach über siebenjähriger grauenvoller Haftzeit (…) zurückgekehrt ist, konnte sie diesen Prozeß in Gang bringen.“
Mit zwei Jahren und sechs Monaten billig davongekommen! Denn was wiegt eine solche Strafe gegen Frau Globas viele Jahre unter der Knute des NKWD, später der Volkspolizei der DDR? Aus den mehr als sieben Jahren, die sie in deren Zuchthäusern zubringen mußte, hätten leicht sogar volle fünfzehn werden können. Denn fünfzehn Jahre hatte das Sowjetische Militär-Tribunal 1947 verhängt.
Was in der GÖTTINGER ZEITUNG nicht zu lesen stand: Die lange Haft hatte die Gesundheit der damals noch jungen Frau und Mutter nachhaltig untergraben. Zur kaputten Wirbelsäule kamen Rheuma und eine chronische Blasenerkrankung. Beides gehört zu den typischen Folgen jener unsäglichen Lebensverhältnisse, denen die Gefangenen bei Russen und DDR-Organen jahrelang ausgesetzt waren. Ein Leben lang davon behindert und von Schmerzen geplagt, war die inzwischen Verstorbene schon viele Jahre vor ihrem Tod zu einer schwerkranken, ganz an das Haus gefesselten Frau geworden.
Auch sie hatte damals zwei kleine Kinder verlassen müssen, etwa im gleichen Alter wie bei vielen Verhafteten ihrer Generation. Der Ältere war zehn, und der Kleine hatte gerade das zweite Lebensjahr begonnen. Ihren Fall und ihre Verhaftung erinnert Frau Globa so:
„Ich war in einem kleinen Ort mitten in Deutschland zu Hause, der jetzt, nach dem Ende des Krieges, plötzlich an einer Grenze lag. Interzonengrenze nannte man das damals. Wir waren auf der östlichen Seite, nicht weit von Walkenried, das nun ‚Westen‘ war.