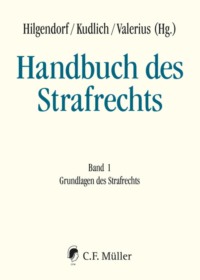Kitabı oku: «Handbuch des Strafrechts», sayfa 10
[203]
Weiterführend Bock, Die Eigendynamik der Verrechtlichung in der modernen Gesellschaft, in: Lampe (Hrsg.), Zur Entwicklung des Rechtsbewusstseins, 1997, S. 403 ff.
[204]
Grundlegend Taupitz, Die Standesordnungen der freien Berufe: Geschichtliche Entwicklung, Funktionen, Stellung im Rechtssystem, 1991.
[205]
§ 18 EStG definiert den „freien Beruf“ allgemein als „selbstständig ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit.“ Zu den „freien Berufen“ zählt etwa die Tätigkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte, Notare und Patentanwälte.
[206]
Ein Beispiel ist der Entzug einer ärztlichen Approbation nach § 5 Abs. 2 BÄO.
[207]
Hinzu kommen weitere auch rechtsethisch gewichtige Argumente für eine Zurückhaltung des Strafrechts, dazu Duttge NJW 2016, 120 ff.
[208]
von Zezschwitz, Ärztliche Suizidbeihilfe im Straf- und Standesrecht, 2016, S. 78 ff.
[209]
VG Berlin, ZfL 2012, 80 ff.
[210]
Dies erklärt die vielzitierte Kennzeichnung des (Straf-)Rechts als „ethisches Minimum“ bei Jellinek, Die socialethische Bedeutung von Recht, Unrecht und Strafe, 1878, S. 42 f.
[211]
Näher zu den Aufgaben der Dogmatik → AT Bd. 1: Eric Hilgendorf, Die deutsche Strafrechtswissenschaft der Gegenwart, § 18.
[212]
Schon häufig wurde darauf hingewiesen, dass die Wissenschaft bei der Formulierung von konkreten Sorgfaltsregeln vor erheblichen Schwierigkeiten steht, vgl. nur Burgstaller, Das Fahrlässigkeitsdelikt im Strafrecht, 1974.
[213]
BGH NJW 2000, 2754; 2758; NStZ 2005, 446, 447; krit. etwa Duttge, NStZ 2006, 266, 269; Kudlich JuS 2005, 848, Walter JZ 2005, 686; allg. zur Argumentation mit Maßstabsfiguren Schmoller, JBl 1990, 631; Ida, Hirsch-FS, S. 225.
[214]
Siehe aber Duttge, Zur Bestimmtheit des Handlungsunwertes von Fahrlässigkeitsdelikten, 2001.
[215]
LPK-Kindhäuser, § 15 Rn. 61 ff.
[216]
LPK-Kindhäuser, § 15 Rn. 58 ff.
[217]
Zum ärztlichen Standesrecht siehe oben Rn. 100.
[218]
In der von der CEN/CENELEC 2007 herausgegebenen Europäischen Norm EN 45020 heißt es, eine technische Norm sei ein „Dokument, das mit Konsens erstellt und von einer anerkannten Institution angenommen wurde und das für die allgemeine und wiederkehrende Anwendung Regeln, Leitlinien oder Merkmale für Tätigkeiten oder deren Ergebnisse festlegt, wobei ein optimaler Ordnungsgrad in einem gegebenen Zusammenhang angestrebt wird“. Dazu auch Deml, Europarechtliche Anforderungen und Grenzen der technischen Normung, 2009, S. 15.
[219]
Zum Ganzen auch Nickisch, BB 1983, 261 ff.
[220]
Tilch/Arloth, Deutsches Rechts-Lexikon, Bd. 3, 2001, Artikel „Technische Standards“, S. 4106.
[221]
Ebenda. Es soll genügen, dass experimentelle Tests vorgenommen wurden und aufgrund der hieraus gewonnenen Erkenntnisse mit hinreichender Gewissheit auf praktische Eignung geschlossen werden kann. Beispiele finden sich etwa in § 3 Abs. 6 BImSchG, § 3 Nr. 11 WHG, § 2 Abs. 11 GefStoffV.
[222]
Ebenda.
[223]
Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 über die Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung.
[224]
Zur Feststellung des jeweils „besten Stand der Technik“ siehe Fahlbruch/Meyer, Ausarbeitung von Arbeitshilfen zur methodischen Ereignisanalyse und Ergebnisauswertung zur Fortschreibung des Stands der Technik. Endbericht, 2017 (www.umweltbundesamt.de).
[225]
Kudlich, Otto-FS, S. 373, 387; Schürer-Mohr, Erlaubte Risiken, 1998, S. 195; Lackner/Kühl, § 15 Rn. 39.
[226]
Umfassend Hecker, Europäisches Strafrecht; Satzger, Internationales und Europäisches Strafrecht.
[227]
Besonders scharf Schünemann, Die Europäisierung der Strafrechtspflege als Demontage des demokratischen Rechtsstaats, 2013.
[228]
→ AT Bd. 1: Robert Esser, Internationalisierung des Strafrechts, § 13.
[229]
Dazu gehört vor allem das Völkerrecht, auch, aber nicht nur durch die Festlegung von internationalen Menschenrechtstandards. Näher dazu → AT Bd. 1: Schmahl, § 2 Rn. 7 ff.
[230]
Dazu etwa E. Zitelmann, Die Möglichkeit eines Weltrechts, 1888, W. Schücking, Die Organisation der Welt, 1909; H. Gomperz, Die Idee der überstaatlichen Rechtsordnung, 1922; W. Bodmer, Das Postulat des Weltstaats. Eine rechtstheoretische Untersuchung, 1952, zusammenfassend P. Coulmas, Weltbürger. Geschichte einer Menschheitssehnsucht, 1990.
[231]
Mit der Einrichtung des Internationalen Strafgerichtshofes (ICC) auf der Grundlage des Römischen Statuts vom 17. Juli 1998 hat die Idee eines „Weltstrafrechts“ wieder an Interesse gewonnen. Gleichzeitig verdeutlichen die erheblichen Akzeptanzprobleme des ICC z.B. in den USA, in Russland oder in China, warum es sich wohl noch auf lange Sicht hinaus um eine Utopie handeln wird.
[232]
Hilgendorf/Valerius, Computer- und Internetstrafrecht, Rn. 151 ff., 156.
[233]
Statistische Angaben bei www.fowid.de.
[234]
Natürlich gab es aber auch im 19. Jahrhundert eine Trennung von Klassen, Schichten und Ständen. Die These von der weltanschaulichen Homogenität gilt also nur cum grano salis.
[235]
Kulturelle Pluralisierung ist eine unmittelbare Folge von Globalisierung und hat heute nahezu alle wohlhabenden Staaten erfasst. Eine der wenigen Ausnahmen ist Japan.
[236]
Dazu umfassend Valerius, Kultur und Strafrecht. Die Berücksichtigung kultureller Wertvorstellungen in der deutschen Strafrechtsdogmatik, 2011.
[237]
LG Köln, NJW 2012, 2128.
[238]
Hilgendorf, Paulus-FG, S. 87–101.
[239]
Dazu Mager, Art. 4 Rn. 50, in: von Münch/Kunig (Hrsg.), GG-Kommentar, Bd. 1.
[240]
Lackner/Kühl-Heger, § 166 Rn. 1.
[241]
Umfassend → AT Bd. 1: Valerius, § 25.
[242]
Siehe oben Rn. 63 ff. Der gemeinsame Nenner, auf den die genannten Wertorientierungen hinauslaufen, ist der Leitwert der Humanität, dazu Hilgendorf, Humanismus und Recht – Humanistisches Recht? Eine erste Orientierung, in: Groschopp (Hrsg.), Humanismus und Humanisierung, 2014, S. 36–56.
[243]
Pfahl-Traughber, Albert-FS, S. 177 ff.; vgl. auch Hilgendorf, ebenda, S. 359 ff.
[244]
Ausführlich zu den Dimensionen des Neutralitätsgrundsatzes Czermak/Hilgendorf, Religions- und Weltanschauungsrecht, 2. Aufl. 2018, Rn. 166 ff.
[245]
Durch den Zuzug von weit mehr als 1 Million Flüchtlingen überwiegend aus muslimischen Ländern in den Jahren 2015 und 2016 dürfte das Problem sogar neue Dringlichkeit erhalten haben.
[246]
Hilgendorf, JZ 2012, 825, 827 ff.
[247]
Dazu näher → AT Bd. 1: Rotsch, Criminal Compliance, § 26.
[248]
Diese Position wird vor allem der sog. „Frankfurter Schule der Strafrechtswissenschaft“ zugeschrieben, siehe etwa die Beiträge in dem Sammelband: Institut für Kriminalwissenschaften Frankfurt a.M. (Hrsg.) Vom unmöglichen Zustand des Strafrechts, 1995.
[249]
Zum Ultima-Ratio-Grundsatz und Verhältnismäßigkeitsprinzip → AT Bd. 1: Schmahl, § 2 Rn. 16.
[250]
Zu denken ist hier vor allem an den strafrechtlichen Lebensschutz, wo sich die traditionelle Vorstellung der Nicht-Verfügbarkeit menschlichen Lebens angesichts der neuen Möglichkeiten, sterbendes Leben fast ad infinitum künstlich zu verlängern, nicht mehr aufrechterhalten lässt.
[251]
Grundlegend Rottleuthner, Rechtswissenschaft als Sozialwissenschaft; vgl. auch Hilgendorf, Die Renaissance der Rechtstheorie 1965–1985, 2005.
[252]
In diesem Zusammenhang dürfte der empirischen Technikfolgenabschätzung eine wesentlich größere Rolle zukommen, als ihr bislang von Strafrechtswissenschaft und Kriminalpolitik zugestanden wurde, vgl. vor allem Grunwald, Technikfolgenabschätzung, 2. Aufl. 2010.
[253]
Der letztgenannte Gesichtspunkt verdeutlicht den engen Zusammenhang zwischen der Rechtsoziologie und dem Rechtsvergleich, s. dazu auch Rheinstein, Einführung in die Rechtsvergleichung, 2. Aufl. 1987, S. 20 f.
[254]
Ein hervorragendes Beispiel hierfür ist Kress, Ethik der Rechtsordnung, 2012.
[255]
Näher zu den Bedingungen gelingender Interdisziplinarität Hilgendorf, JZ 2010, 913.
[256]
Siehe oben Rn. 3.
[257]
Näher → AT Bd. 1: Hörnle, § 12.
1. Abschnitt: Das Strafrecht im Gefüge der Gesamtrechtsordnung › § 2 Verfassungsrechtliche Vorgaben für das Strafrecht
Stefanie Schmahl
§ 2 Verfassungsrechtliche Vorgaben
für das Strafrecht
A.Strafrecht und staatliche Strafgewalt im verfassungsrechtlichen Gesamtgefüge1 – 11
I.Grundgesetzliche Parameter1 – 6
II.Europa- und völkerrechtliche Implikationen7 – 9
III.Normenhierarchie und Gewaltenverschränkung10, 11
B.Staatsstrukturprinzipien und grundlegende allgemeine Verfassungsgebote12 – 37
I.Achtung der Menschenwürde12
II.Rechtsstaatsprinzip und seine wesentlichen strafrechtsrelevanten Emanationen13 – 22
1.Grundsatz der Verhältnismäßigkeit14 – 18
2.Objektives Willkürverbot19
3.Funktionsfähigkeit der Strafrechtspflege20 – 22
III.Demokratieprinzip23 – 25
IV.Sozialstaatsprinzip26
V.Bundesstaatsprinzip27, 28
VI.Materielle Grundrechte29 – 31
VII.Rechtsschutzgarantie32 – 34
VIII.Beschleunigungsgebot35 – 37
C.Justizgrundrechte als besondere verfassungsrechtliche Einzelgarantien38 – 82
I.Recht auf den gesetzlichen Richter (Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG)38 – 41
II.Verbot der Todesstrafe (Art. 102 GG)42
III.Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG)43 – 47
IV.Nullum crimen, nulla poena sine lege (Art. 103 Abs. 2 GG)48 – 67
1.Gesetzlichkeitsgebot (nulla poena sine lege scripta)51 – 55
2.Bestimmtheitsgebot (nulla poena sine lege certa)56 – 60
3.Rückwirkungsverbot (nulla poena sine lege praevia)61 – 67
V.Ne bis in idem crimen judicetur (Art. 103 Abs. 3 GG)68 – 72
VI.Verfassungsgarantien bei Freiheitsbeschränkung und -entziehung (Art. 104 GG)73 – 82
1.Allgemeine Anforderungen an Freiheitsbeschränkungen75 – 77
2.Spezielle Vorgaben bei Freiheitsentziehungen78 – 82
D.Grundrechtlich fundierte strafrechtsrelevante Maximen und Gebote83 – 95
I.Recht auf ein faires Verfahren83 – 85
II.Gebot der Waffengleichheit86, 87
III.Prozessuale Fürsorgepflicht des Gerichts88
IV.Nulla poena sine culpa89 – 91
V.Unschuldsvermutung92
VI.Nemo tenetur se ipsum accusare93, 94
VII.In dubio pro reo95
E.„Strafverfassungsrecht“ und verfassungsgerichtliche Kontrolle einfachgesetzlicher Gewährleistungen96 – 100
Ausgewählte Literatur
1. Abschnitt: Das Strafrecht im Gefüge der Gesamtrechtsordnung › § 2 Verfassungsrechtliche Vorgaben für das Strafrecht › A. Strafrecht und staatliche Strafgewalt im verfassungsrechtlichen Gesamtgefüge
A. Strafrecht und staatliche Strafgewalt im verfassungsrechtlichen Gesamtgefüge
I. Grundgesetzliche Parameter
1
Das materielle Strafrecht (ius poenale) sowie das Strafverfahrens- und Strafvollstreckungsrecht (ius puniendi) haben die Aufgabe, die vom Staat gesetzte Rechtsordnung zu sichern, den Rechtsfrieden zu erhalten oder wiederherzustellen und den Einzelnen und die Gemeinschaft gegen grobe Rechtsverletzungen zu schützen.[1] Dabei stehen materielles Strafrecht und institutionell-verfahrensrechtliche Durchsetzung des Strafanspruchs zueinander in einem notwendigen Ergänzungsverhältnis.[2] Eine Strafrechtsordnung ohne staatliche Strafgewalt vermag ebenso wenig dem Rechtsgüterschutz und dem sozialen Frieden zu dienen wie umgekehrt eine zielorientierte Verfahrens- oder Vollstreckungsregelung nicht möglich ist, wenn sie materiell-rechtliche Vorgaben und Rechtsfolgen außer Acht lässt.[3] Eine willkürliche oder übermäßige Ausübung staatlicher Strafgewalt kann allerdings auch die Freiheit des Betroffenen gefährden. Daher sieht die Verfassung nicht nur Freiheitsgewährleistungen durch die staatliche Strafgewalt, sondern auch gegenüber der staatlichen Strafgewalt vor.[4]
2
Die Kriminalstrafe ist der schärfste Freiheitseingriff, den die deutsche Rechtsordnung kennt.[5] Sie geht deutlich über die zivilrechtliche Ausgleichsfunktion und Schadensersatzpflicht bei schädigenden Handlungen hinaus; Strafe wird als Rechtsfolge einer Verwirklichung von materiellen Strafvorschriften auch gegenüber ersatzbereiten und -fähigen Tätern verhängt.[6] Bereits die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens und der damit verbundene drohende Schuldspruch stellen – ungeachtet der Unschuldsvermutung – ein ehrenrühriges Unwerturteil über eine Verhaltensweise des Betroffenen dar, das ihm eine defizitäre Einstellung zur Norm attestiert und ihn dadurch in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) trifft.[7] Verhängung und Vollstreckung der Strafe begründen gar einen schwerwiegenden Eingriff in Freiheit oder Vermögen (Art. 2 Abs. 2 S. 2 oder Art. 2 Abs. 1 GG).[8] Derartige Grundrechtseingriffe können nur dann verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein, wenn sie auf materiellen Strafnormen und prozeduralen Vorschriften beruhen, die bestimmten rechtsstaatlichen Mindeststandards genügen.[9] Entsprechendes gilt für sonstige, dem Strafrecht vorbehaltene Tatfolgen, die zwar nicht Strafe sind, wie Maßregeln der Besserung und Sicherung, aber an eine schuldlos begangene Tat grundrechtsrelevante Rechtsfolgen knüpfen, wie z.B. die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gemäß § 63 StGB.
3
Die staatliche Strafgewalt ist freilich nicht nur Bedrohung grundrechtlicher Freiheit, sondern zugleich ihr wesentlicher Schutz und Garant.[10] In ihrer Schutzpflichtendimension verpflichten die Grundrechte den Staat, die elementaren Schutzgüter des Einzelnen wirkungsvoll vor Übergriffen Dritter zu bewahren.[11] Ohne das Instrument der Strafandrohung und ohne eine funktionstüchtige Strafverfolgung wäre dieser grundrechtliche Schutz nicht realisierbar.[12] Nicht von ungefähr hat das Bundesverfassungsgericht die staatliche Schutzpflichtenlehre gerade anhand einer „Pflicht zum Strafen“ entwickelt[13] und betont, dass der Staat seiner grundrechtlichen Schutzpflicht nur genüge, wenn er elementare Rechtsgutsverletzungen unter Strafe stellt und an das Legalitätsprinzip (§§ 152 Abs. 2, 160 Abs. 1 StPO) gebundene Strafverfolgungsbehörden einrichtet.[14] Auch die von Lehre und Rechtsprechung entwickelten Straftheorien, insbesondere die Vereinigungstheorie, die sämtliche Strafzwecke in ein ausgewogenes Verhältnis zueinander bringt,[15] werden vom Bundesverfassungsgericht zur Konturierung staatlicher Schutzpflichten herangezogen.[16] Ob darüber hinaus aus der Schutzpflichtendimension sogar ein verfassungsrechtlich verbürgter subjektiver Anspruch des Opfers auf Strafverfolgung des Täters erwächst, ist nicht geklärt.[17] Nicht bestreiten lässt sich aber, dass die zentralen Rechte des Opfers im Strafprozess (etwa als Nebenkläger) ihre Wurzel ebenfalls in den grundrechtlichen Schutzpflichten haben und damit nicht vollständig zur Disposition des Gesetzgebers stehen.[18]
4
Das materielle Strafrecht sowie die Ordnungen des Strafprozesses, der Strafvollstreckung und des Strafvollzugs als Verfahren zur Verwirklichung des staatlichen Strafanspruchs stellen bedeutsame Bewährungsfelder des Rechtsstaates und der freiheitlichen demokratischen Grundordnung dar.[19] Nicht von ungefähr wird insbesondere das Strafverfahrensrecht als „Seismograph der Staatsverfassung“,[20] als „angewandtes Verfassungsrecht“[21] oder als „Magna Charta des Rechtsstaats“[22] bezeichnet. Denn vor allem am Zustand des Strafprozessrechts lässt sich ablesen, wie es um die Freiheitlichkeit, aber auch um die rechtsstaatliche Fähigkeit zu verlässlicher Sicherheitsgewährleistung eines Staatswesens bestellt ist.[23] Daneben ist auch das materielle Strafrecht nicht „verfassungsfest“, sondern muss sich an den Prinzipien der gewaltengegliederten Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit, insbesondere am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, messen lassen.
5
Die staatliche Strafgewalt ist im Grundgesetz nur fragmentarisch und zudem bloß punktuell-verstreut konstituiert. Ein dem Finanzverfassungsrecht (Art. 104a–115 GG) entsprechender Abschnitt ist dem „Strafverfassungsrecht“ im Grundgesetz nicht gewidmet.[24] Vielmehr wird die staatliche Strafgewalt in verschiedenen Vorschriften (z.B. Art. 9 Abs. 2, 11 Abs. 2, 20 Abs. 3, 74 Abs. 1 Nr. 1, 92, 95, 101, 103 Abs. 2 GG) schlicht vorausgesetzt.[25] Ihre institutionelle Ausformung sowie die Normierung ihrer Handlungs-, Verfahrens- und Entscheidungsbefugnisse und deren materiell-rechtlichen Bewertungsgrundlagen obliegen primär dem Gesetzgeber.[26] Damit lässt die Verfassung Raum für die demokratische Gestaltungsfreiheit bei Schaffung und Ausgestaltung des Strafgesetzbuches, der Strafprozessordnung, des Gerichtsverfassungsgesetzes und der (Landes-)Strafvollzugsgesetze und anerkennt darüber hinaus die dogmatische Eigenständigkeit des Fachrechts.[27]
6
Auf der anderen Seite unterliegt die staatliche Strafgewalt verschiedenen verfassungsrechtlichen Vorgaben und Begrenzungen. Die allgemein gegenüber jeder staatlichen Gewalt nach dem Grundgesetz bestehenden grundlegenden Gewährleistungen und Staatsstrukturprinzipien (insbesondere Menschenwürde, Rechtsstaatsprinzip, Demokratieprinzip, Sozialstaatsprinzip, Bundesstaatsprinzip, materielle Grundrechte, Rechtsschutzgarantie und Verfassungsbeschwerde) gelten auch gegenüber der staatlichen Strafgewalt und binden diese sowohl in materiell-rechtlicher als auch in institutionell-verfahrensrechtlicher Hinsicht.[28] Aufgrund ihres in hohem Maße abstrakten Regelungsgehalts bedürfen diese grundlegenden Verfassungsgarantien allerdings der Konkretisierung und gesonderten Absicherung. Dies geschieht durch spezifische Vorkehrungen im Grundgesetz selbst.[29] Dabei richten sich manche dieser Vorkehrungen wiederum an die Staatsgewalt im Allgemeinen (Art. 92, 97, 101 Abs. 1 S. 2, 103 Abs. 1 GG) und sind nicht ausschließlich auf die Strafgewalt zugeschnitten. Andere konkretisierende Verfassungsgarantien, insbesondere die Justizgrundrechte, haben jedoch spezifisch die staatliche Strafgewalt im Blick und etablieren spezielle verfahrensrechtliche (Art. 104 Abs. 2–4 GG) oder besondere materiell-rechtliche (Art. 102, 103 Abs. 2–3, 104 Abs. 1 GG) Vorgaben.[30] Hinzu treten verschiedene strafrechtsorientierte Verfassungsgewährleistungen mittlerer Abstraktion, die das Bundesverfassungsgericht aus einer Gesamtschau der verfassungsrechtlichen Kernprinzipien wie Rechtsstaatlichkeit, Willkürverbot, Menschenwürdegarantie und allgemeinem Persönlichkeitsrecht entwickelt hat, etwa das Recht auf ein faires Verfahren, das Gebot der Waffengleichheit, die prozessuale Fürsorgepflicht des Gerichts und die verfahrensrechtliche Maxime des nemo tenetur se ipsum accusare.[31]
II. Europa- und völkerrechtliche Implikationen
7
In das Grundrechtsschutzsystem eingebunden sind auch die Garantien der Europäischen Menschenrechtskonvention.[32] Wiewohl sie formell nur den Rang eines Bundesgesetzes nach Maßgabe des Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG bekleidet,[33] dient die Konvention, einschließlich der zu ihr ergangenen Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, als Auslegungshilfe für die Bestimmung von Inhalt und Reichweite von Grundrechten und rechtsstaatlichen Garantien des Grundgesetzes.[34] Vor allem der Normtext und die Auslegung von Art. 3 EMRK (Folterverbot), Art. 5 EMRK (Begrenzung des staatlichen Festnahmerechts), Art. 6 EMRK (Garantie des fair trial) und Art. 8 EMRK (Recht auf Privatleben) durch den Straßburger Gerichtshof haben sich in Deutschland zu einer veritablen „strafrechtlichen Nebenverfassung“[35] entwickelt.[36] Art. 6 EMRK wohnt eine Reihe von strafprozessualen Verfahrensgarantien inne, die das deutsche Verfassungsrecht nicht ausdrücklich oder nicht in derselben Detailgenauigkeit kennt.[37] Das Bundesverfassungsgericht hat deshalb – meist sogar unter explizitem Rekurs auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte – die zentralen Aussagen des Art. 6 EMRK, namentlich das Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 Abs. 1 EMRK), die Garantie der Unschuldsvermutung (Art. 6 Abs. 2 EMRK) und den Schutz gegen eine unangemessen lange Verfahrensdauer (Art. 6 i.V.m. Art. 13 EMRK) auch als Verfassungsgarantien des Grundgesetzes anerkannt.[38]
8
Darüber hinaus gewinnt der Grundrechtsschutz auf unionsrechtlicher Ebene für das deutsche Straf- und Strafverfahrensrecht zunehmend an Bedeutung. Zwar binden die Unionsgrundrechte die Organe der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten gemäß Art. 51 Abs. 1 S. 1 GRCh ausschließlich bei Anwendung und Durchführung des Unionsrechts, also nicht im Rahmen der gesamten innerstaatlichen Strafrechtspflege.[39] Da sich der Aufgaben- und Tätigkeitsbereich der Europäischen Union aber auch auf den „Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ (Art. 3 Abs. 2 EUV, Art. 67 ff. AEUV) erstreckt, nimmt der Bereich der unionsrechtlich determinierten Strafrechtspflege beständig zu. Art. 82 AEUV erklärt die gegenseitige Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen zur Grundlage der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen.[40] Art. 83 AEUV stellt eine mittlerweile vermehrt in Anspruch genommene Kompetenzgrundlage zum Erlass von (ausfüllungsbedürftigen) Mindestvorschriften zur Festlegung von Straftaten und Strafen für bestimmte Kriminalitätsbereiche fest,[41] die in den (deutschen) innerstaatlichen Rechtsraum über Art. 23 Abs. 1 S. 2 GG hineinwirken.[42] In seinem Urteil zum Lissabon-Vertrag hat das Bundesverfassungsgericht das materielle und formelle Strafrecht zwar zu den besonders souveränitätsrelevanten Kernbereichen demokratischer Gestaltung gerechnet. Dennoch hat es nicht in Frage gestellt, dass eine Integration auf dem Feld des Strafrechts, soweit es um Kriminalität mit grenzüberschreitender Dimension geht, in einem Binnenmarkt unverzichtbar ist und auch verfassungsrechtlich zulässig sein kann.[43] Insbesondere wirkt sich dieses Postulat auf den Anwendungsbereich des Verbots der Mehrfachbestrafung (Art. 103 Abs. 3 GG) aus, dem nunmehr auch ein europäisiertes Konzept zugrunde liegt.
9
Angesichts gestiegener Mobilität ist ferner ein steigender praktischer Einfluss des Völkerrechts auf die verfassungsrechtliche Konturierung der deutschen Strafgewalt zu konstatieren. Zum einen werden seit alters her bestimmte Personen von der deutschen Gerichtsbarkeit befreit, auch wenn sie sich auf dem Staatsgebiet befinden. Diese Exemtionen gründen sich sowohl auf die über Art. 25 GG verbindlichen allgemeinen Regeln des Völkerrechts als auch auf die beiden Wiener Übereinkommen über diplomatische bzw. konsularische Beziehungen,[44] die gemäß Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG im Rang eines Bundesgesetzes stehen. §§ 18 bis 20 GVG greifen die völkerrechtlichen Immunitätsvorgaben einfachgesetzlich auf. Zum anderen erstreckt sich der räumliche Geltungsbereich des deutschen Strafrechts auf Sachverhalte mit Auslandsberührung (vgl. §§ 3–7 StGB). Bei diesen Vorschriften des sog. „Internationalen Strafrechts“ handelt es sich zwar lediglich um die extraterritoriale Anwendung des innerstaatlichen Rechts, das selbst keinen völkerrechtlichen Ursprung hat.[45] Im Blick auf das völkerrechtliche Einmischungsverbot (vgl. Art. 2 Ziff. 1, 7 UN-Charta) ist eine extraterritoriale Erstreckung des nationalen Strafanspruchs aber nur so lange und so weit unproblematisch, wie ein legitimer Anknüpfungspunkt zum deutschen Staat besteht.[46] Genuine völkerrechtliche Vorgaben sind schließlich dem Völkerstrafrecht zu entnehmen, dessen Entwicklung mit dem Statut des Internationalen Militärgerichtshofs von Nürnberg begann,[47] über die vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ad hoc eingesetzten Internationalen Strafgerichtshöfe für das ehemalige Jugoslawien[48] und für Ruanda[49] weiterentwickelt wurde und heute im Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs[50] seinen vertraglichen Niederschlag findet. Den völkerrechtlichen Regelungen zur Begründung einer internationalen Strafgerichtsbarkeit, die mit der Ahndung schwerwiegender völkerrechtlicher Verbrechen (insbesondere Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen) betraut ist, steht auf nationaler Ebene das deutsche Völkerstrafgesetzbuch[51] gegenüber. Es fokussiert dieselben Verbrechen, etabliert aber über den Weg des Weltrechtsprinzips eine Jurisdiktion der deutschen Strafgerichtsbarkeit.[52] Verflechtungen zwischen innerstaatlicher und völkerrechtlicher Rechtsordnung treten dadurch auf, dass zum einen die nationalen Stellen mit dem Gerichtshof zur Zusammenarbeit verpflichtet sind,[53] und zum anderen ein Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof nach dem Komplementaritätsgrundsatz des Art. 17 IStGH-Statut nur zulässig ist, wenn die staatliche Strafgerichtsbarkeit nicht tätig wird.