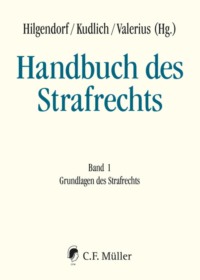Kitabı oku: «Handbuch des Strafrechts», sayfa 9
[43]
Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rechts (1913), 4. Aufl. 1989, S. 146.
[44]
Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rechts (1913), S. 146.
[45]
E. Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rechts (1913), 4. Aufl. 1967, S. 146.
[46]
König, Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozess, 1985; siehe auch A. König, Mode, in: Endruweit/Trommsdorff/Burzan (Hrsg.), Wörterbuch der Soziologie, S. 325 ff.
[47]
Einen Überblick über diese weitgefasste, in besonderem Maße dem historischen Wandel unterworfene Kategorie gibt Göttert, Zeiten und Sitten. Eine Geschichte des Anstands, 2009.
[48]
Dazu schon von Jhering, Der Zweck im Recht, 1923, S. 45 f.
[49]
Acham, Struktur, Funktion und Genese von Institutionen aus sozialwissenschaftlicher Sicht, in: G. Melville (Hrsg.), Institutionen und Geschichte. Theoretische Aspekte und mittelalterliche Befunde, 1992, S. 25 ff.
[50]
Kelsen, Allgemeine Theorie der Normen, 1979, S. 1; dem folgend etwa Mayer-Maly, Rechtsphilosophie, 2001, S. 17.
[51]
Peukert, in: Korte/Schäfers (Hrsg.), Einführung in Hauptbegriffe der Soziologie, 9. Aufl. 2016, S. 128.
[52]
Ebenda; umfassend → AT Bd. 1: Johannes Kaspar, Grundlagen der Kriminologie, § 19 Rn. 12 ff.
[53]
Durkheim in: R. König (Hrsg.), Die Regeln der soziologischen Methode, 2. Aufl. 1965, S. 160.
[54]
Karsten/von Thiessen (Hrsg.), Normenkonkurrenz in historischer Perspektive, 2015.
[55]
Zu nennen sind hier vor allem die rechtfertigende Pflichtenkollision und der rechtfertigende Notstand, § 34 StGB, wobei der Anwendungsbereich der rechtfertigenden Pflichtenkollision auf die Kollision von Handlungspflichten beschränkt ist. Welche Pflichten kollidieren, ist bei den genannten Rechtfertigungsgründen nicht von vornherein festgelegt. Dagegen sind bei der Notwehr, § 32 StGB, die Kollision von Fremdschädigungsverbot und Recht auf Selbstschutz bereits im Normwortlaut festgeschrieben.
[56]
BGHSt 4, 3; Laubenthal/Baier GA 2000, 205; ausf. → AT Bd. 1: Brian Valerius, Strafrecht und Interkulturalität, § 25.
[57]
Frisch, Schroeder-FS, S. 11, 16 ff.
[58]
Dazu unten Rn. 115 ff.
[59]
Im Folgenden soll zwischen der Moral als einer besonderen Art sozialer Normen und der Ethik als Reflexion auf diese Normen unterschieden werden.
[60]
Geiger, Vorstudien, S. 251.
[61]
Geiger, Vorstudien, S. 254.
[62]
Geiger, Vorstudien, S. 254 f. Ähnlich schreibt er in Über Recht und Moral, 1979, S. 170: „Genetisch gesehen besteht zwischen Recht und Moral ein enger Zusammenhang (. . .). Beide haben als Systeme regelmäßigen Verhaltens ihren gemeinsamen Ursprung in Gewohnheit, Brauch und Sitte. Insoweit kann man sagen, daß embryonale Moral und embryonales Recht in eins zusammenfallen. In einem primitiven Stadium wird das Gemeinschaftsleben durch gewohnte Verhaltensformen bestimmt, die zum einen von einem religiösen Tabu umgeben sind und zum anderen von der Umgebung gegen den einzelnen durchgesetzt werden. Eine sowohl innere wie auch äußere Motivation bewirkt in diesem Stadium die Aufrechterhaltung des hergebrachten Verhaltens. Danach setzt ein Polarisierungsprozeß ein, in dessen Verlauf sich Moral und Recht als zwei selbständige Systeme zunehmend voneinander entfernen.“
[63]
Geiger, Vorstudien, S. 253.
[64]
Geiger, Vorstudien, S. 261.
[65]
Geiger, Vorstudien, S. 262.
[66]
Geiger, Vorstudien, S. 263.
[67]
Geiger, Vorstudien, S. 263.
[68]
Geiger, Vorstudien, S. 264.
[69]
Auswahl: Aus der älteren Literatur Laun, Recht und Sittlichkeit, Rektoratsrede Berlin 1924, in: ders., Recht und Sittlichkeit, 3. Aufl. 1935, S. 1–28; Nef, Recht und Moral in der deutschen Rechtsphilosophie seit Kant, 1937; weitere Nachweise bei Henkel, Einführung in die Rechtsphilosophie, 2. Aufl. 1977, § 8. Aus der jüngeren Literatur Beck/Thies (Hrsg.), Moral und Recht, 2011; Deimling, Recht und Moral. Gedanken zur Rechtserziehung, 1972; Drath, Grund und Grenzen der Verbindlichkeit des Rechts. Prolegomena zur Untersuchung des Verhältnisses von Recht und Gerechtigkeit, 1963; Geddert, Recht und Moral. Zum Sinn eines alten Problems; Geiger, Über Moral und Recht. Streitgespräch mit Uppsala; Hilgendorf, Recht und Moral, in: Aufklärung und Kritik 2001, S. 72–90; Greco, Lebendiges und Totes in Feuerbachs Straftheorie, 2009, S. 109–160; Kuhlen, Normverletzungen im Recht und in der Moral, in: Baurmann/Kliemt (Hrsg.), Die moderne Gesellschaft im Rechtsstaat, 1990, S. 63–108; Podlech, Recht und Moral, in: Rechtstheorie 1972, S. 129–148; Sandkühler (Hrsg.) Recht und Moral, 2010. Vgl. auch die Beiträge von Ryffel, Hügli, Ruzicka, Menet, Ott, Wolf und Holzhey in: Holzhey/Kohler (Hrsg.), Verrechtlichung und Verantwortung, 1987. Aus dem angelsächsischen Sprachraum Greenawalt, Conflicts of Law and Morality, 1987.
[70]
Geiger, Vorstudien, S. 130; vgl. auch Vorstudien, S. 168.
[71]
In der Gegenwart ist die Rede vom „gesellschaftlich organisierten Zwang“ praktisch gleichbedeutend mit „staatlich organisiertem Zwang“. Zum jüngeren Phänomen eines Rückzugs des Staates aus der Rechtsetzung Kadelbach/Günther (Hrsg.), Recht ohne Staat? Zur Normativität nichtstaatlicher Rechtsetzung, 2011.
[72]
Dem steht nicht entgegen, dass sowohl in der Alltagssprache als auch in der juristischen Fachsprache Recht und Moral oft miteinander verbunden sind. Besonders deutlich wird dies etwa am Ausdruck „Unrecht“.
[73]
Zu Unrecht wird diese Unterscheidung in der deutschen Rechtsphilosophie und Strafrechtstheorie in erster Linie mit Immanuel Kant (1724–1804) in Verbindung gebracht. Sie findet sich bereits bei den Autoren der Früh- und Hochaufklärung wie Montesquieu und Beccaria.
[74]
Beccaria, Über Verbrechen und Strafen. Nach der Ausgabe von 1766 übersetzt und herausgegeben von W. Alff, 1966, S. 53. Dazu auch Seminara, JZ 2014, 1121 ff.
[75]
Kress, Medizinethik, 2003, S. 135 ff.
[76]
Kress, Medizinethik, 2003, S. 162 ff.
[77]
Gerade die Bestimmungen des Kernstrafrechts (Mord und Totschlag, Diebstahl, Beleidigung) finden in aller Regel eine Entsprechung in der Sozialmoral, also in den moralischen Überzeugungen der Mehrheit der Bevölkerung. Einen wichtigen „Transmissionsriemen“ zwischen Sozialmoral und Strafrecht bilden heute Umfragen, wie sie etwa im Auftrag großer organisierter Interessengruppen durchgeführt werden. Rechtsvergleichend (und noch erstaunlich aktuell) Lee/Robertson, „Moral Order“ and The Criminal Law. Reform Efforts in the United States and West Germany, 1973.
[78]
Für einen Überblick über die Geschichte der Regelung des Schwangerschaftsabbruchs AWHH-Hilgendorf, § 5 Rn. 1 ff. m.w.N.
[79]
Kelsen, Reine Rechtslehre, 2. Aufl. 1960, S. 347, 351.
[80]
Dass dies in vielen Fällen ein höchst unsicherer Maßstab ist, braucht nicht weiter ausgeführt zu werden.
[81]
Der Begriff „Vorverständnis“ wurde vor allem durch das 1970 publizierte Werk von J. Esser, Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung, bekannt.
[82]
Besonders deutlich kommt dieser Meinungswandel etwa im „Fesselungsfall“ (BGHSt 49, 166 ff.) zum Ausdruck.
[83]
Weitere Facetten von „Ehre“ behandeln Vogt/Zingerle, Zur Aktualität des Themas Ehre und zu seinem Stellenwert in der Theorie, in: dies. (Hrsg.), Ehre. Archaische Momente in der Moderne, 1994, S. 9–33, insb. S. 16.
[84]
Dieser Achtungsanspruch lässt sich auch mit „Anspruch auf Respekt“ umschreiben.
[85]
Davon zu unterscheiden ist die Vorstellung einer besonderen „sittenbildenden“ Aufgabe der Rechtswissenschaft, dazu Burmeister, Über den Auftrag der Jurisprudenz zur Pflege des rechtsethischen Konsenses in der Gesellschaft, in: Jung/Kroeber-Riel/Wadle (Hrsg.), Entwicklungslinien in Recht und Wirtschaft. Akademische Reden der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität des Saarlandes 1988/1989, 1990, S. 31–53.
[86]
Mayer, Strafrecht, 1953, S. 23. Vgl. auch schon Dicey, Lectures on the Relation between Law and Public Opinion in England During the Nineteenth Century, London 1905, der die Ansicht vertrat, man könne mit Gesetzen die öffentliche Meinung lenken.
[87]
Rottleuthner, Recht, Moral und Politik – rechtssoziologisch betrachtet, Philosophica 23 (1979), S. 97–127. Aus dem angelsächsischen Rechtskreis Walker/Argyle, Does the Law Affect Moral Judgements?, in: British Journal of Criminology 4 (1964), S. 570–581; Berkowitz/Walker, Laws and Moral Judgements, Sociometry 30 (1967), S. 410–422.
[88]
BGBl. I, S. 2746.
[89]
BGBl. I, S. 2177.
[90]
Zum geistesgeschichtlichen Hintergrund Decher, Die Signatur der Freiheit, 1999, insb. S. 59 ff.
[91]
Die Strafbarkeit des Ehebruchs wurde durch das Erste Gesetz zur Reform des Strafrechts vom 25. Juni 1969 (BGBl. I, 645) aufgehoben.
[92]
Der durch das Rechtsstrafgesetzbuch 1871 eingeführte § 175 StGB wurde erst durch das 29. Strafrechtsänderungsgesetz vom 31. Mai 1994 (BGBl. I 1168) aufgehoben.
[93]
Sch/Sch-Eisele, § 184 Rn. 1 ff.
[94]
Sch/Sch-Eser, Vorbem. §§ 218–219b, Rn. 1 ff.
[95]
BGBl. 2017 I, S. 2787.
[96]
Radbruch, Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, in SJZ 1946, 107 ff. ND in: GRGA Bd. 3, 1990, S. 83 ff.
[97]
BGHSt 39, 1, 8 ff.; 168, 181 ff.; 40, 241, 242 ff.; 41, 101, 104 ff.; 42, 65, 70 f.; NJW 2000, 443, 450 f.; BVerfGE 65, 135.
[98]
Frisch, Grünwald-FS, S. 133 ff.; Lüderssen, JZ 1997, 530; vgl. auch Rottleuthner, Gustav Radbruch und der Unrechtsstaat, in: Borowski/Paulson (Hrsg.), Die Natur des Rechts bei Gustav Radbruch, 2015, S. 91–117.
[99]
Stolleis, Gemeinwohlformeln im nationalsozialistischen Recht, 1974.
[100]
Besonders berüchtigt Larenz, Rechtsperson und subjektives Recht, in: ders. (Hrsg.), Grundfragen der neuen Rechtswissenschaft, 1935, S. 241 der mit Hilfe durchsichtiger definitorischer Tricks Juden aus dem Kreis der „Rechtsgenossen“ ausschied.
[101]
Hoerster, NJW 1986, S. 2482.
[102]
→ AT Bd. 1: Stefanie Schmahl, Verfassungsrechtliche Vorgaben für das Strafrecht, § 2 Rn. 7 f.
[103]
→ AT Bd. 1: Schmahl, § 2 Rn. 9.
[104]
Erhellend zum geistesgeschichtlichen Hintergrund des Konzepts „Abwägung“ Rückert, JZ 2011, 913 ff.
[105]
Detjen, Die Werteordnung des Grundgesetzes, 2009.
[106]
Derartige Formulierung sollten nicht ohne weiteres belächelt oder negativ bewertet werden. Jede etablierte Gemeinschaft, die nicht an der Schwelle der Selbstauflösung steht, wird dazu neigen, die eigenen Werte zu verteidigen, wenn dies erforderlich erscheint. Ein Beispiel hierfür ist die Verteidigung der „freiheitlich-demokratischen Grundordnung“ Deutschlands, die das Bundesverfassungsgericht wie folgt definiert hat: „eine Ordnung, die unter Ausschluss jeglicher Gewalt- und Willkürherrschaft eine rechtsstaatliche Herrschaftsordnung auf der Grundlage der Selbstbestimmung des Volkes nach dem Willen der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und Gleichheit darstellt. Zu den grundlegenden Prinzipien dieser Ordnung sind mindestens zu rechnen: die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, vor allem vor dem Recht der Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung, die Volkssouveränität, die Gewaltenteilung, die Verantwortlichkeit der Regierung, die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, die Unabhängigkeit der Gerichte, das Mehrparteienprinzip und die Chancengleichheit für alle politischen Parteien mit dem Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung einer Opposition“ (BVerfGE 2, 1, 12 f.; 5, 85, 140; 20, 56, 97 f.).
[107]
V. Kraft, Die Grundlagen einer wissenschaftlichen Wertlehre, 2. Aufl. 1952, S. 5 ff.
[108]
Wildfeuer, „Wert“, in: Kolmer/Wildfeuer (Hrsg.), Neues Handbuch philosophischer Grundbegriffe, Bd. 3, 2011, S. 2484–2504, insb. S. 2488 ff.
[109]
Näher zu den verschiedenen Verwendungsformen von „Kognitivismus“ Wimmer in: Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Bd. 4, 2. Aufl. 2010, S. 249 f.
[110]
BGHSt 6, 52 f.; vgl. auch Weinkauff, NJW 1960, 1689 ff.
[111]
Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, 1921, S. 262.
[112]
Hartmann, Ethik, 1925, S. 136.
[113]
Hartmann, Ethik, S. 141.
[114]
A.a.O., S. 142.
[115]
A.a.O., S. 142.
[116]
Hilgendorf, Tatsachenaussagen und Werturteile, 1998, S. 166 ff.
[117]
Hilgendorf, Tatsachenaussagen und Werturteile, 1998, S. 49. Zu den sich daraus ergebenden Problemen näher unten Rn. 72 ff.
[118]
D. Frey (Hrsg.), Psychologie der Werte, 2016.
[119]
Vgl. aber auch P. Furtado (Hrsg.), Histories of nations. How their identities were forged, 2012, wo der interessante Versuch unternommen wird, den „Volkscharakter“ über prägende historische Ereignisse zu bestimmen.
[120]
P. Stein/J. Shand, Legal Values in Western Society, 1974.
[121]
Hilgendorf, Werte in Recht und Rechtswissenschaft, in: Krobath (Hrsg.) Werte in der Begegnung, S. 230. Zur damit angesprochenen Rechtsanthropologie näher Antweiler, Was ist den Menschen gemeinsam? Über Kultur und Kulturen, 2. Aufl. 2012; ders., Heimat Mensch. Was uns alle verbindet, 2009; vgl. auch Pirie, The Anthropology of Law, Oxford 2013.
[122]
Es trifft also nicht zu, dass der wertphilosophische Subjektivismus, also die auch hier vertretene Zurückführung von Werten auf menschliche Wertungen, in allen Fällen eine bloß partikulare Geltung von Werten impliziert.
[123]
Krobath, Werte. Ein Streifzug durch Philosophie und Wissenschaft, S. 460 ff.; 514 ff.
[124]
Hillmann, Wertewandel. Ursachen, Tendenzen, Folgen, 2003, S. 512.
[125]
Artikel „Wert/Wertewandel“, in Endruweit/Trommsdorff/Burzan (Hrsg.), Wörterbuch der Soziologie. S. 610. Als „klassisch“ gilt mittlerweile die Definition des US-Kulturanthropologen C. Kluckhohn: „A value is a conception, explicit or implicit, distinctive of an individual or characteristic of a group, of the desirable which influences the selection from available modes, means and ends of action“ (Kluckhohn u.a., Values and Value-orientation in the theory of action: an exploration in definition and classification, in: Parsons (Hrsg.), Toward a general theory of action, 1962, S. 388–433, insb. S. 395.
[126]
Siehe etwa die Beiträge in Müller/Isensee (Hrsg.), Wirtschaftsethik – Wirtschaftsstrafrecht, 1991.
[127]
Umfassend Antweiler, Was ist den Menschen gemeinsam?, 2. Aufl. 2012.
[128]
Siehe oben Rn. 9.
[129]
Die zuständigen Disziplinen sind vor allem die Soziologie, insb. die Rechtssoziologie, aber auch die neuen Interkulturalitätstheorien und die Ethik.
[130]
Siehe dazu auch das Würzburger Projekt „Globale Systeme und interkulturelle Kompetenz“, www.gsik.de, näher dazu Marschelke, Knemeyer-FS, S. 617 ff.
[131]
Gensicke/Neumeier, Artikel „Wert/Wertwandel“, in Endruweit/Trommsdorf/Burzan (Hrsg.), Wörterbuch der Soziologie, S. 610 unter Berufung auf Dewey, Theory of Valuation, 1939.
[132]
Zu Unrecht werden Topoi wie „Zweck“, „zweckmäßig“ oder „instrumentell“ in Teilen der deutschen Rechtswissenschaft, vor allem in der Rechtsphilosophie, negativ konnotiert. Kritisch dazu Hilgendorf, Gesetzlichkeit als Instrument der Freiheitssicherung: Zur Grundlegung des Gesetzlichkeitsprinzips in der französischen Aufklärungsphilosophie und bei Beccaria, in: Kudlich/Montiel/Schuhr (Hrsg.), Gesetzlichkeit und Strafrecht, 2012, S. 17–33, insb. S. 28 ff.
[133]
v. Liszt, Lehrbuch, 21. Aufl. S. 4 spricht vom „rechtliche geschützten Interesse“. Da Werte nach dem hier vertretenen Ansatz auf Interessen beruhen, ist der Unterschied zu v. Liszt nicht groß. Immerhin wird man sagen können, dass nicht beliebige Interessen rechtlich geschützt werden, sondern nur solche, die von der Mehrheit der Rechtsgemeinschaft als Werte anerkannt wurden.
[134]
Siehe oben Rn. 41 ff.
[135]
Eingehend Hillmann, Wertewandel, 2003; zum Wandel individueller Werthaltungen Krobath, Werte, S. 446 ff.; zum Wertwandel aus einer philosophischen Perspektive Lobkowicz, in: Fikentscher u.a., Wertewandel, Rechtswandel. Perspektiven auf die gefährdeten Voraussetzungen unserer Demokratie, 1997, S. 167–190.
[136]
Hilgendorf, Neumann-FS, S. 1391–1402.
[137]
Zur Lage des Datenschutzes in den USA und China siehe Weichert, Datenschutz und Überwachung in ausgewählten Staaten, in: Schmidt/Weichert (Hrsg.), Datenschutz. Grundlagen, Entwicklungen und Kontroversen, 2012, S. 419 ff., 422 f.
[138]
Es gibt aber durchaus Ausnahmen, vgl. etwa die Abschaffung der Todesstrafe nach 1945/1949.
[139]
Zur damit zusammenhängenden Unbeliebtheit von Juristen Hilgendorf, in: Universitas 2000, S. 205–214.
[140]
Fischer, § 176 Rn. 1. Noch in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde diskutiert, ob Pädophilie überhaupt strafwürdig ist, dazu Frommel, Kritische Justiz 2013, 46–56.
[141]
Hilgendorf, Neue Kriminalpolitik 2010, S. 125 ff.; vgl. auch Cremer-Schäfer/Steinert, Straflust und Repression. Zur Kritik der populistischen Kriminologie, 1998, S. 94 ff.
[142]
Das Auftreten von Punitivitätswellen steht offenkundig in einem engen Zusammenhang mit der Berichterstattung in den Massenmedien.
[143]
Einen ausgezeichneten Überblick gibt Baldus, Kämpfe um die Menschenwürde. Die Debatten seit 1949, 2016; ferner Demko/Seelmann/Becchi (Hrsg.), Würde und Autonomie, 2015; für den angelsächsischen Bereich McCrudden (Hrsg.), Understanding Human Dignity, 2013.
[144]
Hilgendorf, Humanismus und Recht – Humanistisches Recht? Eine erste Orientierung, S. 36–56.
[145]
Dreier, Art. 1 Abs. 1 Rn. 41, in: ders. (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. 1, 3. Aufl. 2013.
[146]
Ebenda, Rn. 46.
[147]
Baldus, Kämpfe um die Menschenwürde. Die Debatten seit 1949, 2016.
[148]
Maunz/Dürig-Herdegen, Art. 1 Abs. 1 GG Rn. 28, 34.
[149]
Siehe nur Dreier, Art. 1 Abs. 1 Rn. 55, in: ders. (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. 1, 3. Aufl. 2013 (mit umfangreichen Nachweisen).
[150]
Hilgendorf, Puppe-FS, S. 1653–1671.
[151]
Hilgendorf, Puppe-FS, S. 1665 ff.
[152]
Nicht alles, was politisch oder moralisch bedenklich erscheint, ist ohne Weiteres ein Verstoß gegen die Menschenwürde.
[153]
Hilgendorf, Humanismus und Recht, in: Groschopp (Hrsg.), Humanismus und Humanisierung, 2014, S. 36–46, insb. S. 42 ff.
[154]
Zur letztgenannten Gruppe gehörten namentlich die Rechtswissenschaften Lateinamerikas, Ostasiens und der Türkei, wobei die Einflüsse der Strafrechtswissenschaft inzwischen größer sein dürften als die der Zivilrechtswissenschaft. Die deutschsprachige Wissenschaft vom Öffentlichen Recht besitzt bislang keinen vergleichbaren Auslandseinfluss, obwohl z.B. das Modell der deutschen Verfassungsgerichtsbarkeit inzwischen weltweit beachtet und in manchen Ländern Osteuropas und in Südafrika auch nachgeahmt wird. Auch der vom deutschen Bundesverfassungsgericht häufig herangezogene Verhältnismäßigkeitsgrundsatz wird im Ausland zunehmend rezipiert.
[155]
Dazu auch → AT Bd. 1: Eric Hilgendorf, Strafrechtswissenschaft, § 18.
[156]
Siehe etwa Kindhäuser, Strafprozessrecht, Roxin/Schünemann, Strafverfahrensrecht.
[157]
Zu den Ursachen der heutigen Effektivitätskrise im Strafverfahrensrecht Roxin/Schünemann, Strafverfahrensrecht, § 2 Rn. 9.
[158]
Die im deutschen Sprachraum „klassische“ Textsammlung ist: Sack/König (Hrsg.), Kriminalsoziologie 1968. Dagegen bezeichnet der Ausdruck „Kriminalistik“ die Lehre von der Verfolgung von Straftaten.
[159]
Vormbaum, Einführung in die neuere Strafrechtsgeschichte; nach wie vor lesenswert auch Schmidt, Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, 2. ND. der 3. Aufl. (1965), 1995.
[160]
Berolzheimer, Strafrechtsphilosophie und Strafrechtsreform, 1963; Lampe, Strafphilosophie. Studien zur Strafgerechtigkeit, 1999.
[161]
Strafrechtstheorie im hier gemeinten Sinn umfasst mehr als nur die Diskussion der überkommenen Straftheorien (→ AT Bd. 1: Tatjana Hörnle, Straftheorien, § 12). Es geht vielmehr um Fragen wie den Handlungsbegriff, die Kausalität, die objektive Zurechnung, die Unterscheidung von Rechtswidrigkeit und Schuld usw., also Themen, die in der deutschen Strafrechtswissenschaft in aller Regel im Allgemeinen Teil diskutiert werden. Nach wie vor lesenswert sind die Arbeiten K. Engischs, vgl. etwa seine „Beiträge zur Rechtstheorie“, hrsg. von P. Bockelmann und A. Kaufmann, 1984, oder seine bis heute immer wieder aufgelegte „Einführung in das juristische Denken“, 12. Aufl. 2018.
[162]
Siehe nur Schurz/Carrier (Hrsg.), Werte in den Wissenschaften. Neue Ansätze zum Werturteilsstreit, 2013 (mit Gesamtbibliographie S. 421 ff.).
[163]
Hilgendorf, Zum Begriff des Werturteils in der Reinen Rechtslehre, in: Stadler/Walter (Hrsg.), Logischer Empirismus und Reine Rechtslehre. Beziehungen zwischen dem Wiener Kreis und der Hans-Kelsen-Schule, 2001, S. 117–135.
[164]
Das gilt insbesondere für die ab den späten 60er Jahren des 20. Jahrhunderts unter der Bezeichnung „Positivismusstreit“ stattfindende Auseinandersetzung zwischen „Kritischen Rationalisten“ und den Anhängern der „Kritischen Theorie“, zum Ganzen Dahms, Positivismusstreit. Die Auseinandersetzungen der Frankfurter Schule mit dem logischen Positivismus, dem amerikanischen Pragmatismus und dem kritischen Rationalismus, 1994.
[165]
Weber, Der Sinn der „Wertfreiheit“ der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften (1917), in: J. Winckelmann/M. Weber (Hrsg.), Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 7. Aufl. 1988, S. 500.
[166]
Albert, Werturteil und Wertbasis, in: ders., Marktsoziologie und Entscheidungslogik. Ökonomische Probleme in soziologischer Analyse, 1967, S. 92–130, insb. S. 95 ff. Albert behandelt die angesprochenen Problemstellungen in einer anderen Reihenfolge als hier vorgeschlagen.
[167]
Dazu (am Beispiel des „Erfolgs in seiner konkreten Gestalt“) Hilgendorf, GA 1995, 515–534.
[168]
Dazu auch Rottleuthner, Methodologie und Organisation der Rechtswissenschaft, in: Hilgendorf/Schulze-Fielitz (Hrsg.), Selbstreflexion der Rechtswissenschaft, 2015, S. 207–222.
[169]
Ähnlich z.B. auch Mayer-Maly, Rechtswissenschaft, 5. Aufl. 1991, S. 8.
[170]
Röhl, Rechtssoziologie, S. 86.
[171]
Drastisch formulierte M. Weber, „von allen Arten der Prophetie (sei, E.H.) die … ‚persönlich‘ gefärbte Professorenprophetie zahlreicher offiziell beglaubigter Propheten, die nicht auf den Gassen oder in den Kirchen oder sonst in der Öffentlichkeit, … sondern in der angeblich objektiven, unkontrollierbaren diskussionslosen, vor allem Widerspruch sorgsam geschützten Stille des vom Staat privilegierten Hörsaals ‚im Namen der Wissenschaft‘ Kathederentscheidungen von Weltanschauungsfragen zum besten geben, die einzige ganz und gar unerträgliche“ (zit. nach Nau (Hrsg.): Die Äußerungen zur Werturteilsdiskussion im Ausschuß des Vereins für Sozialpolitik (1913), 1996, S. 147–186, insb. S. 151).
[172]
Birnbacher, Analytische Einführung in die Ethik, 2. Aufl. 2007, S. 2.
[173]
Höffe (Hrsg.), Aristoteles. Nikomachische Ethik, 2010 (Klassiker Auslegen, Bd. 2).
[174]
Bereits diesen Ansatz kritisierend Albert, Traktat über kritische Vernunft, 5. Aufl. 1991, S. 13 ff., demzufolge sich jeder Versuch, eine bestimmte Position „letztzubegründen“, im „Münchhausen-Trilemma“ verstrickt und nur die Wahl zwischen einem dogmatischen Abbruch des Begründungsverfahrens, einem Zirkel im Begründungsgang oder einem infiniten Regress lässt.
[175]
Einführend Coing, Grundzüge der Rechtsphilosophie, 4. Aufl. 1985, S. 10 ff.
[176]
Überblick bei Hilgendorf, Recht und Moral, in: Aufklärung und Kritik 2001, S. 72–90.
[177]
Die Antwort hängt ganz offensichtlich davon ab, welchen Inhalt man dem Begriff „Person“ gibt. Auf diese Weise lassen sich moralische und politische Entscheidungen durch einfache Definitionen erschleichen. Ähnliche Probleme stellten sich schon in der Begriffsjurisprudenz.
[178]
Hilgendorf, Recht und Moral, in: Aufklärung und Kritik 2001, S. 72–90, insb. S. 86 ff.
[179]
Albert, Traktat über kritische Vernunft, 5. Aufl. 1991, S. 88 ff.
[180]
Von der Pfordten, Rechtsethik, 2. Aufl. 2011; vgl. auch die Beiträge in Fischer/Strasser (Hrsg.), Rechtsethik, 2007.
[181]
Kress, Ethik der Rechtsordnung. Staat, Grundrechte und Religionen im Licht der Rechtsethik, 2012.
[182]
Wiesing (Hrsg.), Ethik in der Medizin. Ein Studienbuch, 4. Aufl. 2012; siehe auch Kress, Medizinische Ethik, 2. Aufl. 2007.
[183]
In der Scharia fallen rechtliche und religiöse Gebote noch heute im Wesentlichen zusammen, dazu näher Rottleuthner, Foundations of Law, 2005, S. 50 ff.
[184]
Dies ging so weit, dass eine Straftat nicht bloß als Verletzung weltlicher Interessen verstanden wurde, sondern auch als Verstoß gegen den Willen des christlichen Gottes. Entsprechend hart fielen die Strafen aus. Näher dazu Fischl, Der Einfluß der Aufklärungsphilosophie, 1913, ND 1981, S. 8 f.
[185]
In diesen Zusammenhang gehört auch die Herausbildung von „Parallelgesellschaften“ mit einer eigenen „Paralleljustiz“, dazu etwa Schiffauer, Parallelgesellschaften. Wie viel Wertekonsens braucht unsere Gesellschaft? Für eine kluge Politik der Differenz, 2008; Banweis, Religiöse Paralleljustiz. Zulässigkeit und Grenzen informeller Streitschlichtung und Streitentscheidung unter Muslimen in Deutschland, 2016.
[186]
Siehe die Beiträge in: Dreier/Hilgendorf, Kulturelle Identität als Grund und Grenze des Rechts. Akten der IVR-Tagung vom 28.–30. September 2006 in Würzburg, 2008.
[187]
Kress, Ethik der Rechtsordnung, 2012, S. 30 ff.
[188]
Böckenförde, Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation, 1967, in: Recht Staat, Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie und Verfassungsgeschichte, 1991, S. 92–114, insb. S. 112 f.
[189]
A.a.O., S. 113.
[190]
Zahlen nach https://fowid.de.
[191]
Zum Folgenden näher Hilgendorf, JZ 2014, 826 f.
[192]
Das klassische Beispiel für einen solchen Konflikt ist der Fall Galileo Galileis.
[193]
Maier, Wie universal sind die Menschenrechte?, 1997, S. 55 ff.
[194]
Darauf läuft letztlich die Debatte um die Möglichkeit eines „Euro-Islam“ hinaus.
[195]
Dies dürfte vor allem darauf zurückzuführen sein, dass das Christentum dem gesellschaftlichen Wertewandel seit der Aufklärung in aller Regel folgte, wenngleich meist mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung. Umgekehrt ist das europäische Recht von Anfang an stark vom Christentum beeinflusst worden.
[196]
Aufsehenerregend war vor allem der Fall der infolge eines Exorzismus ums Leben gekommenen Würzburger Studentin Anneliese Michel, dazu Hilgendorf, Paulus-FG, S. 87–101.
[197]
Ältere Beispiele sind die Ablehnung von Impfung oder Bluttransfusionen (durch „Zeugen Jehovas“).
[198]
Als „Ethos“ soll hier der Inbegriff der von einem Individuum oder einer Gruppe akzeptierten, in aller Regel durch Tradition gestützten moralischen Normen und Werte verstanden werden. Das „Handwerkerethos“ umfasst diejenigen (tradierten) Normen und Werte, die sich speziell auf das Handwerk beziehen.
[199]
Näher zum Standesrecht unten Rn. 98 ff.
[200]
May, ARSP 83 (1997), 316 ff., 322 ff.; Foote, California Law Review 80 (1992), S. 317 ff. spricht von einem „benevolent paternalism“ des japanischen Strafrechtssystems.
[201]
Wichtige Vertreter des Kommunitarismus sind etwa M. Sandel, A. MacIntyre und C. Taylor.
[202]
Davon zu unterscheiden ist die Anwendung allgemeiner moralischer Normen auf Einzelfälle, also die Herleitung eines konkreten Tätigkeitsge- oder -verbotes aus einer allgemeinen Norm für einen Einzelfall.