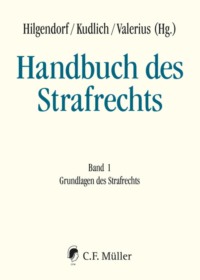Kitabı oku: «Handbuch des Strafrechts», sayfa 7
G. (Straf-)Recht und Religion
86
In vielen nicht-europäischen Gesellschaften sind die Beziehungen zwischen Strafrecht und Religion außerordentlich eng.[183] Dasselbe war in Europa bis zur Aufklärung der Fall,[184] und angesichts der vielbesprochenen „Rückkehr der Religion(en)“ ist es keineswegs ausgemacht, dass die Bedeutung von Religiosität und Religionen nicht auch in Europa wieder zunehmen könnte.[185] Dies rechtfertigt es, auf das in der Strafrechtstheorie erstaunlicherweise kaum behandelte Thema des Zusammenhangs von Religion und (Straf-)Recht etwas genauer einzugehen:
87
Religion ist eine sozio-kulturelle Institution, die dem Recht in zweifacher Weise gegenübergestellt zu werden pflegt: zum einen als Grundlage, zum anderen aber auch als Grenze des Rechts.[186] Vor allem in jüngerer Zeit findet sich aber auch die Gegenposition, wonach im demokratischen Rechtsstaat Recht als Grenze der Religion anzusehen ist.[187]
88
Die wohl bekannteste Version der These, Religion – im weitesten Sinne verstanden – bilde die Grundlage des Staates und damit auch des (Straf-)Rechts, stammt von Ernst-Wolfgang Böckenförde, der im Rahmen einer Analyse der Herkunft des modernen Staates ausführte, der säkularisierte Verfassungsstaat beruhe auf (religiösen, E.H.) Grundlagen, die er selbst nicht bereitstellen könne:
„Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit willen, eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen Substanz des einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft, reguliert. Anderseits kann er diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit den Mitteln des Rechtszwanges und autoritativen Gebots zu garantieren suchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben und – auf säkularisierter Ebene – in jenen Totalitätsanspruch zurückzufallen, aus dem er in den konfessionellen Bürgerkriegen herausgeführt hat“.[188]
89
Böckenförde deutet an, „auch der säkularisierte weltliche Staat [müsse] letztlich aus jenen inneren Antrieben und Bindungen leben …, die der religiöse Glaube seiner Bürger vermittelt.“[189] Böckenfördes These ist allerdings schon deshalb problematisch, weil in seiner Analyse der Religionsbegriff sehr unbestimmt bleibt. Möglicherweise erschien dem Autor die Gleichsetzung von Religion mit dem Christentum so selbstverständlich, dass er nähere Ausführungen zu Inhalt und Ausgestaltung des von ihm verwendeten Religionskonzeptes für überflüssig hielt. Diese Position mag 1967, dem Jahr der Publikation des Aufsatzes, vertretbar gewesen sein; heute ist sie angesichts der enormen kulturellen und auch religiösen Pluralisierung der deutschen Gesellschaft problematisch geworden. Im Jahr 2015 waren nur noch 28,9 % der deutschen Bevölkerung katholisch, 27,1 % evangelisch, 4,4 % muslimisch und 36 % gehörten keiner Religionsgemeinschaft mehr an.[190] Eine allgemeinverbindliche und für alle Bevölkerungsgruppen akzeptable normative Basis kann deshalb kaum mehr von einer bestimmten religiösen Richtung allein bereitgestellt werden.
90
Fraglich bleibt darüber hinaus der von Böckenförde behauptete Zusammenhang zwischen Religion und Moral. Um Böckenfördes These zu prüfen, ist es deshalb erforderlich, das oft allzu undifferenziert verwendete Konzept von „Religion“ etwas genauer zu betrachten. Dabei lassen sich verschiedene Dimensionen von Religion unterscheiden:[191]
91
Religionen besitzen zunächst eine kognitive Dimension, die etwa aus Aussagen über die Entstehung der Welt, ein Leben nach dem Tode oder die Existenz einer oder mehrerer Gottheiten besteht. Es liegt auf der Hand, dass derartige Annahmen mit unserem Erfahrungswissen, und insbesondere mit den Sätzen der empirischen Wissenschaften, in Konflikt geraten können.[192] Hinzu tritt eine normative Dimension, welche die für eine Religion wichtigen Werte und Verhaltensregeln (also religiöse Ge- und Verbote) enthält. Dabei lässt sich unterscheiden zwischen solchen Werten und Normen, die nur für die Gläubigen selbst gelten sollen, und solchen, die nach Überzeugung der Gläubigen auch für Ungläubige gelten. Die rituelle Dimension einer Religion umfasst ritualisierte Handlungen, also etwa Gebete oder andere kultische Verrichtungen. Zur institutionellen Dimension gehören die spezifischen Über- und Unterordnungsverhältnisse (Hierarchien), die eine Religion ausgebildet hat. Die ästhetische Dimension besteht aus religionsspezifischen Zeichen, Symbolen, Formen, Gerüchen und Klängen. Hinzu tritt eine psychische Dimension, die von Gefühlen des Trosts und Vertrauens bis hin zu Erfahrungen der religiösen „Ekstase“ reichen kann. Besonders intensiv wird die psychische Dimension von Religion offenbar in Gruppen erlebt.
92
Böckenfördes These dürfte in erster Linie auf die normative Dimension von Religion abzielen. Sie würde dann besagen, dass der moderne Verfassungsstaat und sein Recht auf Werte und Normen angewiesen sind, die aus der religiösen Sphäre stammen. Nun trifft zwar zu, dass das moderne Recht für Einflüsse aus der Sphäre der Sitte und der Moral offen ist (vgl. oben Rn. 29 ff.). Sehr fraglich ist aber, ob die rezipierten Normen und Werte in erster Linie oder gar ausschließlich religiöser Herkunft sind oder auch nur sein sollten. Zentrale Werte des modernen demokratischen Verfassungsstaates wie Menschenwürde, Menschenrechte und Demokratie entstammen Humanismus und Aufklärung und mussten im 18. und 19. Jahrhundert gegen den hartnäckigen Widerstand der christlichen Kirchen erkämpft werden. Erst im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts, im Rahmen des zweiten Vatikanischen Konzils, konnte sich die katholische Kirche dazu durchringen, mit den politischen Idealen der Aufklärung Frieden zu schließen.[193] In anderen Religionen, vor allem dem Islam, müssen die Ideen der Aufklärung erst noch durchgesetzt werden.[194] Vor diesem Hintergrund verliert die These Böckenfördes, der moderne Verfassungsstaat bedürfe zu seiner Funktionsfähigkeit oder gar seiner Legitimation religiöser Werte oder Normen, erheblich an Überzeugungskraft.
93
Sehr viel plausibler ist es, Recht, und damit auch das Strafrecht, im demokratischen Verfassungsstaat als Grenze von Religion anzusehen. Die dem Staatswesen zugrundeliegenden Werte sind die Menschenwürde und die auf ihr aufbauenden Menschenrechte. Soweit Religionen in einer ihrer Dimensionen mit diesen basalen Werten in Konflikt geraten, stellt sich die Frage nach ihrer Einhegung oder Zähmung – nicht zuletzt durch das Recht. Gerade religiös motivierte Praktiken, die mit dem geltenden Strafrecht in Konflikt stehen, erfordern höchste Aufmerksamkeit. Lange Zeit wurde die Religionsfreiheit, (Art. 4 GG), so weit verstanden, dass religiöse Praktiken kaum einzuschränken waren.[195] Eine Ausnahme bildete allenfalls der Exorzismus.[196] Angesichts religiös gestützter Erscheinungen wie Kinderehen, Genitalbeschneidung und Ablehnung der Gleichstellung von Mann und Frau stellt sich jedoch die Frage, in welchem Ausmaß religiöse Praktiken, die den humanistischen Leitwerten unserer Verfassung, also der Menschenwürde und den Menschenrechten, widersprechen, toleriert werden können.[197]
1. Abschnitt: Das Strafrecht im Gefüge der Gesamtrechtsordnung › § 1 Strafrecht im Kontext der Normenordnungen › H. Bereichsspezifische Sitten, Bereichsmoralen und das Standesrecht
H. Bereichsspezifische Sitten, Bereichsmoralen und das Standesrecht
I. Gruppenspezifische Normen
94
Neben den religiös gestützten Werten und Moralvorstellungen existieren noch viele andere Formen sozialer Normen in der Gesellschaft. Viele von ihnen sind bereichsspezifisch, d.h. sie gelten nur innerhalb bestimmter sozialer Gruppen. Sie können von bloßer Gewohnheit (mit bloß geringer normativer Wirkung) bis hin zum ausdifferenzierten Berufsethos[198] reichen; teilweise sind bereichsspezifische Regelungen sogar als Standesrecht festgeschrieben.[199] In Europa und den USA scheint die Bedeutung derartiger Normierungen „unterhalb“ des staatlich gesetzten (Straf-)Rechts zurückzugehen, während sie in Ostasien, gerade in Japan, nach wie vor eine sehr große Rolle spielen, auch und gerade im Zusammenhang mit der Kriminalitätsprävention.[200] Im sog. „Kommunitarismus“, einer in den 1970er Jahren v.a. in den USA und Kanada aufgekommenen Strömung in der Moralphilosophie, wird die Relevanz von bereichsspezifischen Moralen betont und ihre Stärkung gefordert.[201]
95
Einen Sonderfall einer nicht gruppenspezifischen, sondern eher „tätigkeitsspezifischen“ bereichsspezifischen Moral bilden solche Moralanforderungen, die an bestimmte Tätigkeiten anknüpfen.[202] Beispiele hierfür sind die „Steuermoral“, die „Zahlungsmoral“ oder auch die „Kampfmoral“. Gemeint damit ist die jeweils spezifische Einstellung von Personen als Steuerpflichtige, Zahlungspflichtige oder Soldaten. Derartige tätigkeitsspezifische Moralen sind wohl nur dann empirisch zu fassen, wenn man auf die jeweiligen Subjekte abstellt und z.B. die Zahlungsbereitschaft einer bestimmten Gruppe von Menschen zu einer bestimmten Zeit und in einem überschaubaren örtlichen Zusammenhang betrachtet. Auf diese Weise lassen sich tätigkeitsspezifische Moralen auch als gruppenspezifische Normkomplexe analysieren.
96
Eines der wichtigsten Beispiele für eine gruppenspezifische Moral ist das Handwerkerethos oder das Ethos der Handeltreibenden mit seinem Leitbild des „ehrbaren Kaufmanns“, also die Summe aller moralischen Sondernormen, die sich am Leitbild eines „ehrbaren Kaufmanns“ orientieren. Sieht man genauer hin, so findet sich in fast allen traditionellen Berufen ein entsprechendes Ethos. Durch derartige Normen definiert der jeweilige Berufsstand seinen idealen Vertreter. Für die Herausbildung einer Gruppenidentität – mit Rückwirkungen auf das individuelle Handwerkerethos – sind derartige gruppenspezifische Moralen von größter Bedeutung.
97
Es ist bemerkenswert, dass eine starke Verrechtlichung (auch und gerade mit den Mitteln des Strafrechts) gruppen- bzw. berufsspezifische Moralordnungen offenbar zurückdrängen und u.U. so stark schwächen kann, dass das überkommene Ethos nur noch als Folklore weiterlebt oder sich ganz auflöst.[203] Derartige Verrechtlichungsschübe sind schon deshalb problematisch, weil das gruppenspezifische Ethos Verhalten oft besser zu regulieren vermag als die als fremd und aufgezwungen empfundenen Rechtsnormen. Mit der Auflösung der gruppenspezifischen Moralordnung geht daher nicht selten eine Auflösung oder zumindest Abschwächung auch der individuellen Moral (etwa einer Handwerkermoral) einher.
II. Standesrecht
98
Als Standesrecht bezeichnet man das Recht eines Berufsstandes, dem der Gesetzgeber die Befugnis übertragen hat, die bereichsspezifischen berufsbezogenen Moralvorstellungen in Rechtsform selbst zu verwalten.[204] Dieses Recht wird traditionell vor allem den sog. „freien Berufen“,[205] insbesondere Ärzten und Rechtsanwälten, zugestanden.
99
Standesrecht besitzt für die Rechtsordnung, auch und gerade die Strafrechtsordnung, eine große Bedeutung. Durch den Verzicht auf eine eigene rechtliche Regelung erkennt der Staat die Eigenständigkeit und Bedeutung der jeweiligen Berufsgruppe an. Sie wird in die Lage versetzt, ihr eigenes Berufsethos in rechtliche Formen zu gießen. Auf diese Weise können die eben erwähnten negativen Auswirkungen einer Verrechtlichung vermieden oder zumindest abgeschwächt werden. Zugleich wird das jeweilige Ethos explizit gemacht und kann so gezielt fortentwickelt werden. Standesrecht normiert in aller Regel Detailfragen, die von der allgemeinen Rechtsordnung nicht entschieden werden. Standesrecht kann deshalb auch dort Verbote formulieren, wo das allgemeine Strafrecht kein Verbot kennt, und vermag u.U. sogar standesrechtliche Sanktionen festzusetzen, deren Wirkung für die davon Betroffenen einer Strafe gleichkommt.[206]
100
Problematisch wird das Auseinanderfallen von Standesrecht und Strafrecht dann, wenn damit spürbare Wertungswidersprüche verbunden sind. Dies ist etwa seit dem Jahr 2011 im Hinblick auf den ärztlich assistierten Suizid der Fall. Im Strafrecht ist die Beihilfe eines Arztes zum Suizid eines anderen, z.B. eines Patienten, schon im Hinblick auf den Grundsatz der limitierten Akzessorietät straflos.[207] Dagegen enthält die Musterberufsordnung der Ärzte seit 2011 in § 16 S. 3 eine Klausel, die die Hilfe zur Selbsttötung verbietet. Eine ärztliche Suizidassistenz ist also nicht strafbar (und nach Maßgabe der herrschenden Sozialmoral auch nicht strafwürdig); dieser Wertung folgt aber nur ein Teil der Landesberufsordnungen, während das ärztliche Standesrecht anderer Landesärztekammern die ärztliche Suizidassistenz untersagt.[208]
101
Die Situation wird noch dadurch kompliziert, dass nach wohl überwiegender Meinung das Grundrecht der Gewissensfreiheit (Art. 4 GG) auch im Arzt-Patienten-Verhältnis zu beachten ist und einem ausnahmslosen Verbot der Suizidassistenz entgegensteht.[209] Für Ärzte und Patienten ist diese nur durch die Zusammenschau mehrerer Regelungsebenen erfassbare Rechtslage kaum mehr verständlich. Schon wegen der zentralen Bedeutung des Lebensschutzes für eine an humanistischen Grundsätzen orientierte Rechtsordnung sind Wertungswidersprüche auf diesem Gebiet auch rechtsstaatlich problematisch. Gerade beim Schutz so zentraler Rechtsgüter wie dem Leben sollten Grundrechte (hier: die allgemeine Handlungsfreiheit und die Gewissensfreiheit), das Strafrecht, die Sozialmoral und die einzelnen Standesrechte konform gehen.
1. Abschnitt: Das Strafrecht im Gefüge der Gesamtrechtsordnung › § 1 Strafrecht im Kontext der Normenordnungen › I. Sorgfaltsanforderungen, Technische Normen und Technikstandards
I. Sorgfaltsanforderungen, Technische Normen
und Technikstandards
102
Zahlreiche Normen der Sitte und der Moral verbieten das „grundlose“ Verletzen fremder Interessen. So gilt es als unmoralisch, zu stehlen, andere zu töten, am Körper zu verletzen, fremde Sachen zu beschädigen usw. Derartige Verbote orientieren sich am Leitbild gezielten, d.h. in der Sprache des Rechts: vorsätzlichen Handelns. Verletzungen, die aus Unvorsichtigkeit oder aus Leichtsinn zugefügt werden, werden milder beurteilt, auch wenn sie als moralisches Unrecht angesehen werden. Da, wie oben bereits ausgeführt, unterschiedliche Moralen existieren, und Moralen nur in Ausnahmefällen explizit gemacht werden (etwa in Untersuchungen zur angewandten Ethik oder in standesrechtlichen Ordnungen), herrscht über die bei der Entscheidung über das Vorliegen von „Unvorsichtigkeit“ oder gar „Leichtsinn“ anzuwendenden Maßstäbe oft keine Einigkeit; im Regelfall alltagspraktischer Bewertung wird diese Frage nicht einmal gestellt.
103
Strafrecht entstammt meist den gleichen sozialen Normen und Wertungen wie die Sozialmoral einer Gesellschaft.[210] Strafnormen stellen deshalb in der Regel explizit gemachte, durchstrukturierte und rationalisierte Formen von Verbotstatbeständen der Sozialmoral dar. Auch die Strafrechtsdogmatik, also die Analyse der gegebenen Strafrechtsnormen und -praxis mit dem Ziel konsistenter Begriffsverwendung und Systematisierung, geht häufig von den alltagspraktischen Begriffen, Normen und Wertungen aus, macht diese explizit und rationalisiert sie, indem die Alltagspraxis von Widersprüchen befreit und in ein System gebracht wird.[211] Man könnte dies als Prozess „rationaler Rekonstruktion“ bezeichnen. Beispiele derartiger „Rekonstruktionen“ sind etwa die strafrechtswissenschaftlichen Präzisierungen von Alltagskonzepten wie „Handlung“, „Kausalität“, „Notwehr“ oder „Provokation“.
I. Ungeschriebene Sorgfaltsanforderungen
104
Dieser „Umsetzungsprozess“ aus der allgemeinen Sozialmoral, aber auch aus bereichsspezifischen Sondermoralen in das Recht findet auch bei der Entscheidung über das Vorliegen von Fahrlässigkeit statt. Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt, § 276 BGB. Trotz der außerordentlichen praktischen Bedeutung der Fahrlässigkeitsnormen für das Strafrecht (und ebenso für das Zivilrecht) sind weder die Grundlagen noch die Details der Fahrlässigkeitsverantwortung zufriedenstellend geklärt.[212]
105
Die Rechtspraxis geht (hierin wieder eine verbreitete Alltagspraxis aufgreifend und explizierend) häufig von Maßfiguren aus und fragt, wie sich ein „einsichtiger und besonnener Mensch“ in der konkreten Lage des Handelnden verhalten hätte.[213] Derartige Formeln stehen stets unter Zirkularitätsverdacht, weil allzu leicht eine eigene Entscheidung vorweggenommen und aus der heterogenen sozialen Wirklichkeit diejenigen Praktiken als Maßstab herausgegriffen werden, die dem eigenen Vorurteil entsprechen.
106
Eine allseits überzeugende Methode zur inhaltlichen Bestimmung des Handlungsunwerts bei Fahrlässigkeitsdelikten steht noch aus.[214] Weitgehend unbestritten ist allenfalls, dass Sorgfaltspflichten dann entstehen, wenn ein Rechtsgut gefährdet erscheint und ein Schadenseintritt durch entsprechend „vorsichtiges“ Verhalten des in Frage stehenden Akteurs vermieden werden kann, dass Sorgfaltspflichten mit der Bedeutung des gefährdeten Rechtsguts und der Wahrscheinlichkeit seiner Verletzung ansteigen und durch Gesichtspunkte wie dem Vertrauensgrundsatz[215] und dem Gedanken des erlaubten Risikos[216] begrenzt werden. Es handelt sich um eine Normsetzung bzw. Normkonkretisierung mit starken rechtsschöpferischen Elementen, die in enger Anlehnung an die Sozialmoral vollzogen wird.
II. Technische Normen
107
In vielen Bereichen haben sich die in Einzelfällen postulierten Sorgfaltsnormen zu gewissen Standards verfestigt. Dies gilt etwa für die Regeln der ärztlichen Kunst.[217] Noch einen Schritt weiter gehen sog. technische Normen. Darunter versteht man private, oft von wirtschaftsnahen Organisationen verabschiedete einheitliche Regelungen, etwa zu technischen Verfahren, Qualitätsstandards, Sicherheit oder zu einer standardisierten Vertragsgestaltung.[218]
108
Von technischen Normen zu unterscheiden sind technische Klauseln, also gesetzliche oder vertragliche Verweise auf einen bestimmten Stand der technisch-wissenschaftlichen Erkenntnis. Es lassen sich (mindestens) drei Typen von Technikklauseln unterscheiden: die „allgemein anerkannten Regeln der Technik“, der „Stand der Technik“ und der „Stand von Wissenschaft und Technik“:[219]
| 1. | Allgemein „anerkannte Regeln der Technik“ sind Regeln, die sich aufgrund fortdauernder praktischer Erfahrung bewährt haben und in der Wissenschaft als theoretisch richtig (vorläufig) anerkannt sind[220] (vgl. etwa § 13 Abs. 1 S. 2 VOB/B). |
| 2. | Der „Stand der Technik“ (§ 3 Abs. 6 BImSchG) beschreibt technische Möglichkeiten zu einem bestimmten Zeitpunkt, basierend auf gesicherten Erkenntnissen von Wissenschaft und Technik. Im Gegensatz zu allgemein anerkannten Regeln der Technik, bei denen technische Verfahrensweisen bereits Eingang in die betriebliche Praxis gefunden und sich dort bewährt haben müssen, legt der Terminus „Stand der Technik“ geringere Anforderungen zugrunde.[221] |
| 3. | Die Formulierung „Stand von Wissenschaft und Technik“ verweist auf neueste, realisierbar erscheinende Ergebnisse wissenschaftlicher und technischer Forschung.[222] Diese Formel wird vornehmlich in atomrechtlichen Vorschriften verwendet, vgl. etwa § 7 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 AtomG. |
| 4. | Auf EU-Gemeinschaftsebene findet sich auch der Begriff der „besten verfügbaren Technik“. Er entspricht in etwa dem in Deutschland verwendeten Begriff des „Standes der Technik“. Der Begriff wurde durch das Gemeinschaftsrecht der europäischen Union, vor allem durch die sog. IVU-Richtlinie,[223] in das nationale Recht der Mitgliedstaaten eingeführt.[224] |
109
Eine Verletzung technischer Normen stellt ein starkes Indiz für das Vorliegen eines Sorgfaltsverstoßes i.S.d. Strafrechts dar, ist damit jedoch nicht gleichzusetzen. Es ist denkbar, dass in einer bestimmten Situation (z.B. bei der Herstellung eines Produkts) alle geltenden technischen Vorschriften eingehalten werden, dennoch aber ein Sorgfaltspflichtverstoß anzunehmen ist.[225] Gerade bei neueren technischen Normen wird man allerdings im Regelfall von einem Gleichlauf zwischen technischer Norm und allgemeiner Sorgfaltspflicht ausgehen können.
1. Abschnitt: Das Strafrecht im Gefüge der Gesamtrechtsordnung › § 1 Strafrecht im Kontext der Normenordnungen › J. Strafrecht vor neuen Herausforderungen