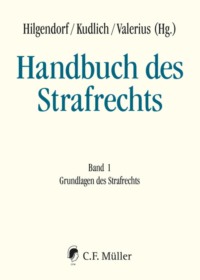Kitabı oku: «Handbuch des Strafrechts», sayfa 8
J. Strafrecht vor neuen Herausforderungen
110
Das Strafrecht sieht sich seit einiger Zeit neuen Herausforderungen ausgesetzt. Dazu gehören zum einen die starke Zunahme europäischer Vorgaben, zum anderen aber auch Globalisierungsphänomene wie Migration und innerstaatliche kulturelle Pluralisierung, die dazu führen, dass deutsche Strafvorschriften mit Moral– und Rechtsnormen anderer Staaten und Kulturen in Konflikt geraten. Außerdem führt der technische Fortschritt dazu, dass Sachverhalte zu bewerten sind, für die klare moralische Vorgaben (noch) nicht existieren. Infolge der Globalisierung gibt es, überspitzt formuliert, zu viele Moralangebote, zur Bewältigung des technischen Fortschritts zu wenige. Das überkommene deutsche Strafrecht und mit ihm die deutsche Strafrechtswissenschaft kann diesen Phänomenen nicht ausweichen, ob und wie sie sie bewältigen kann, ist noch offen.
I. Europäisierung und Globalisierung
111
Eine erste Herausforderung liegt in der Europäisierung und Globalisierung des Rechts, die mehr und mehr auch das Strafrecht berühren. Unter der „Europäisierung“ des deutschen Strafrechts soll hier das Phänomen verstanden werden, dass immer mehr Elemente des nationalen Strafrechts von Entscheidungen europäischer Normsetzer, sei es das europäische Parlament oder die Kommission, geprägt werden.[226] Teilweise gehen die Vorgaben so weit, dass dem deutschen Gesetzgeber kaum noch Handlungsspielraum verbleibt. Die deutsche Strafrechtswissenschaft steht diesen Tendenzen zu Recht überwiegend skeptisch gegenüber.[227] Kritisiert wird zum einen die schwache demokratische Legitimation vieler derartiger Einflussnahmen, verbunden mit einer deutlich punitiven Tendenz, und die Missachtung zentraler rechtsstaatlicher Grundsätze, etwa des Ultima-Ratio-Gedankens.
112
Von der Europäisierung des deutschen Strafrechts zu unterscheiden ist seine Internationalisierung, also die Öffnung gegenüber Einflüssen aus anderen Ländern und Kulturbereichen.[228] Derartige Einflüsse sind grundsätzlich positiv zu bewerten; soweit sie von fremden Strafrechtsordnungen ausgehen, sind sie Gegenstand des Strafrechtsvergleichs. Es existieren jedoch auch grenzüberschreitende Einflüsse, die Bedenken erregen müssen. Vor allem über das Internet ist der Einzelne heute mit einer unüberschaubar großen Menge von Inhalten konfrontiert, von denen zumindest einige unseren kulturellen Standards und Moralvorstellungen, und teilweise auch den Strafnormen des Staates zuwiderlaufen. Das Internet kennt keine nationalen Grenzen. Derartige Erscheinungen geben den alten Debatten über die Notwendigkeit grenzüberschreitender rechtlicher Standards[229] bis hin zu einem „Weltrecht“[230] bzw. „Weltstrafrecht“[231] neuen Auftrieb.
113
Bei der Anwendung des eigenen Strafrechts auf ausländische Sachverhalte ist Zurückhaltung geboten; Deutschland würde sich etwa mit der Rolle eines „Internet-Weltpolizisten“ übernehmen. Deshalb sollte auch das internationale Strafrecht (verstanden als nationales Rechtsanwendungsrecht) nicht über Gebühr ausgedehnt werden, etwa über die Umdeutung abstrakter Gefährdungsdelikte in Erfolgsdelikte.[232] Die Probleme, die durch den Zusammenprall unterschiedlicher kultureller Standards und Moralvorstellungen über das Internet entstehen, können nur zu einem geringen Teil mit den Mitteln des Strafrechts bewältigt werden.
II. Kulturelle Pluralisierung und neue Interkulturalität
114
Parallel zur Globalisierung existiert innerhalb der deutschen Gesellschaft ein Trend zur kulturellen Pluralisierung. Ursachen hierfür sind einerseits die Migration nach Deutschland seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts, andererseits der starke Bedeutungsverlust des traditionell die Kultur prägenden Christentums.[233] Die ehedem weitgehend homogene Sozialmoral[234] hat sich seit den 60er Jahren teilweise aufgelöst und einer kulturell heterogenen Gesellschaft Platz gemacht. Ganz ähnliche Prozesse haben sich auch in anderen westlichen Industrienationen vollzogen, etwa den USA, England, Kanada und Frankreich.[235]
115
Damit stellt sich die Frage, ob die überwiegend vor dem Hintergrund vergangener gesellschaftlicher Verhältnisse entstandene Strafrechtsordnung Deutschlands den neuen Verhältnissen angepasst werden muss.[236] Vor allem die Auseinandersetzung um die religiös motivierte Genitalbeschneidung bei Säuglingen[237] hat die Schwierigkeiten offenbart, die sich beim Aufeinandertreffen von religiös gestützten Moralvorstellungen und den ihnen entsprechenden Traditionen mit dem modernen säkularen Strafrecht ergeben. Ältere Auseinandersetzungen dieser Art bezogen sich etwa auf die Durchführung von Exorzismen,[238] das Schächten von Tieren[239] und auf als unangemessen oder gar verwerflich empfundene Kritik an religiösen Glaubensinhalten (Blasphemie).[240]
116
Die bislang herrschende Meinung in der Strafrechtswissenschaft geht zu Recht davon aus, dass zur Lösung der damit angesprochenen Probleme tiefergreifende Änderungen des deutschen Strafrechts nicht erforderlich sind und rechtspolitisch auch nicht sinnvoll wären.[241] Dies bedeutet, dass der im Strafrecht festgeschriebene Rechtsgüterschutz auch gegenüber Positionen durchgesetzt wird, die sich auf religiöse Einstellungen oder auf eine bestimmte kulturelle Praxis berufen. Ein Strafrecht, welches sich am Grundgesetz, insbesondere am Rechtsstaatsprinzip, an den Grundrechten und an der Menschenwürde orientiert,[242] muss rechtsgutsverletzende Praktiken auch dann erfassen können, wenn diese aus Sicht der Gläubigen durch Religion oder durch altehrwürdige Traditionen motiviert werden.[243]
117
Andererseits ist zu bedenken, dass die Religionsfreiheit grundrechtlich geschützt wird (Art. 4 Abs. 1 und 2 GG) und das Grundgesetz den Religionen nicht lediglich neutral-tolerierend, sondern grundsätzlich positiv-fördernd gegenübersteht.[244] Zudem sprechen in der modernen, kulturell stark pluralisierten Gesellschaft starke rechtspolitische Gründe dafür, religiöse und fremdkulturelle Einstellungen und Praktiken, auch wenn sie von der Mehrheitsgesellschaft abgelehnt werden, zu tolerieren und wenn möglich sogar als gleichberechtigte Ausprägungen kulturellen Lebens zu akzeptieren. Eine angemessene Grenzziehung zu finden ist überaus schwierig und gerade deswegen eine der wichtigsten rechtspolitischen Aufgaben der Zukunft. Die Debatte um das Verhältnis von Strafrecht und neuer Interkulturalität ist noch lange nicht abgeschlossen.[245]
III. Technische Entwicklung
118
Eine weitere große Herausforderung für das Recht, und damit auch das Strafrecht, stellt die immer weiter fortschreitende technische Entwicklung dar, die neue Handlungsmöglichkeiten eröffnet, damit aber auch Regelungsprobleme aufwirft, sofern man nicht der Prämisse folgen möchte, alles, was technisch möglich ist, müsse auch zulässig sein. Kennzeichnend für viele dieser Regelungsprobleme ist, dass die überkommene Sozialmoral darauf bislang keine überzeugende Antwort zu geben vermag. Dies gilt für neue Möglichkeiten der Medizin, etwa im Zusammenhang mit der Verlängerung menschlichen Lebens, ebenso wie für moderne Formen der Humanbiotechnologie (Klonen menschlicher Zellen, Stammzellforschung, usw.). Besonders schwierig zu beantworten sind derartige Regelungsfragen dann, wenn infolge der kulturellen Pluralisierung unterschiedliche Regelungsvorstellungen aufeinandertreffen und religiöse mit säkularen, liberale mit weniger liberalen Regelungsansätzen konkurrieren.
119
Es existieren aber auch durch technische Entwicklungen hervorgerufene Regelungsprobleme, bei denen (bisher?) keine weltanschaulichen Gegensätze aufbrechen. Ein Beispiel hierfür sind die Fragen, die sich bei der strafrechtlichen Bewältigung neuer Formen sozialschädlichen Verhaltens im Internet oder Problemen der Anwendung überkommener strafrechtlicher Zurechnungsmodelle auf den teilautomatisierten Straßenverkehr stellen. Die Strafrechtswissenschaft steht hier vor einer dreifachen Aufgabe: 1) der Beratung rechtanwendender Instanzen bei der Bewertung der neuen Techniken und ihrer Subsumtion unter den gegebenen Normenbestand, 2) der Beratung der gesetzgebenden Instanzen im Hinblick auf die erfolgversprechendsten Formen des Rechtsgüterschutzes und 3) der Beratung der Techniker (Ingenieure, Informatiker) im Hinblick darauf, wie (straf-)rechtliche Haftungsrisiken vermieden werden können.[246] Letzteres kann als eine Form der Sicherung juristischer „Compliance“ verstanden werden.[247]
120
Die Ansicht, Strafrecht habe sich auf den Schutz eines Kernbestands von Rechtsgütern zu beschränken und könne deshalb zur juristischen Einhegung der neuen Risiken nichts beitragen, überzeugt nicht.[248] Um die durch die technische Entwicklung entstandenen Regelungsfragen angemessen lösen zu können, scheint es dennoch ratsam zu sein, von einer vorschnellen Hinwendung zu primär strafrechtlichen Lösungsversuchen abzusehen und die Entwicklung der Sozialmoral abzuwarten. Dies ergibt sich nicht zuletzt aus dem ultima-ratio-Grundsatz.[249] In der offenen Gesellschaft ist es nicht Aufgabe des Staates, die Lösung drängender moralischer Fragen mit den Mitteln der Strafgesetzgebung vorab zu entscheiden. In manchen Fällen[250] werden traditionelle Moralauffassungen auch im Strafrecht zurückzutreten haben, wenn sie mit neueren Entwicklungen der von der Mehrheit getragenen Sozialmoral nicht mehr übereinstimmen.
IV. Antworten
121
Die neuen Herausforderungen lassen sich nur bewältigen, wenn die Strafrechtswissenschaft ihre Fixierung auf Strafrechtsdogmatik kritisch reflektiert und sich gegenüber anderen Disziplinen stärker öffnet. Dies gilt zum einen in Richtung auf die (empirischen) Sozialwissenschaften,[251] deren Erkenntnisse z.B. in Bezug auf die Wirkungen von Globalisierung, interkulturelle Spannungen und Nebenwirkungen des technischen Fortschritts[252] in viel stärkerem Maß als bisher rezipiert und in den Prozessen der Rechtsanwendung und Gesetzgebung berücksichtigt werden sollten. Vor allem die Rechtssoziologie hat zu den neuen Fragestellungen viel beizutragen, von einer empirisch soliden Problembeschreibung über das Aufzeigen möglicher Problemlösungen bis hin zur vergleichenden Darlegung von Lösungsansätzen anderer Länder.[253] Ohne kriminologische und insbesondere auch kriminalstatistische Grundlagen ist eine rationale Strafrechtsanwendung kaum möglich. Noch dringlicher ist die realwissenschaftliche Aufklärung für die Kriminalpolitik.
122
Aber auch die Ergebnisse der modernen angewandten Ethik verdienen größere Aufmerksamkeit, als ihnen bislang von Seiten der Strafrechtswissenschaft entgegengebracht wurde. Teile der Ethik, insbesondere die analytische Ethik, verfügen über Begrifflichkeiten, Methoden und Analysekonzepte, die an Trennschärfe und Konsistenz denen der Strafrechtsdogmatik ebenbürtig sind und sie bisweilen sogar übertreffen dürften. Die Rechtspolitik, auch und gerade die Strafrechtspolitik, kann von der angewandten Ethik viel lernen.[254] Die ethische Reflexion kann dazu dienen, die anstehenden Fragestellungen klar zu erfassen, zu analysieren und zu strukturieren. Sie kann Problemlösungsvorschläge erarbeiten und kritisch prüfen. Die Ergebnisse derartiger Bemühungen lassen sich sodann gesetzlich umsetzen. Jede anspruchsvolle Rechtspolitik ist auf ethische Reflexion angewiesen.
123
Viel spricht dafür, die erforderliche Öffnung der Strafrechtswissenschaft schon in der juristischen Ausbildung vorzubereiten, um spätere Kommunikations- und Verständnisprobleme vermeiden zu helfen.[255] Dies ließe sich etwa dadurch erreichen, dass der ethischen Reflexion in der Juristenausbildung eine stärkere Rolle zugewiesen wird. Außerdem sollte bereits den Studierenden die Bedeutung empirischer Forschung (z.B. in der Rechtssoziologie) sehr viel deutlicher gemacht werden, als dies bisher der Fall ist. Es geht nicht darum, die Bedeutung der Rechtsdogmatik zurückzudrängen – dogmatische Arbeit sollte auch in Zukunft im Mittelpunkt der strafrechtswissenschaftlichen Bemühungen stehen. Es gilt jedoch, bestimmte Engführungen, die mit der großen Idee einer „gesamten Strafrechtswissenschaft“[256] nicht zu vereinbaren sind, zu überwinden.
124
Ein modernes, auf Rechtsgüterschutz ausgerichtetes und an der Menschenwürde und den Menschenrechten orientiertes Strafrecht sollte sich nicht länger scheuen, die zentrale Bedeutung von Kriminalitätsprävention für das Strafrecht und die Strafrechtswissenschaft offen anzuerkennen und sich von überholten „absoluten“ Strafkonzepten verabschieden.[257] Ein wichtiger Schritt in diese Richtung kann die Debatte um „Compliance“ sein. Auch wenn das Konzept an einigen terminologischen Verwirrungen und modischen Übertreibungen leidet, lenkt es doch den Blick auf zwei Umstände, die in der neueren Strafrechtsdogmatik teilweise in Vergessenheit geraten sind: 1) Recht, und damit auch Strafrecht, ist nur ein Teil des Normengefüges, welches menschliches Verhalten steuert, und 2) Kernaufgabe des Strafrechts ist nicht die vergangenheitsorientierte Verarbeitung von Kriminalfällen, sondern die zukunftsgerichtete Gestaltung der Gegenwart.
1. Abschnitt: Das Strafrecht im Gefüge der Gesamtrechtsordnung › § 1 Strafrecht im Kontext der Normenordnungen › Ausgewählte Literatur
Ausgewählte Literatur
| Ehrlich, Eugen | Grundlegung der Soziologie des Rechts (1913), 4. Aufl. 1989. |
| Forst, Rainer/Günther, Klaus (Hrsg.) | Die Herausbildung normativer Ordnungen. Interdisziplinäre Perspektiven, 2011. |
| Geddert, Heinrich | Recht und Moral. Zum Sinn eines alten Problems, 1984. |
| Geiger, Theodor | Über Moral und Recht. Streitgespräch mit Uppsala, 1979. |
| Geiger, Theodor | Studien zu einer Soziologie des Rechts, 4. Aufl. durchgesehen und herausgegeben von Rehbinder, 1987. |
| Hilgendorf, Eric | Humanismus und Recht – Humanistisches Recht? Eine erste Orientierung, in: Groschopp (Hrsg.), Humanismus und Humanisierung, 2014, S. 36 ff. |
| König, René | Das Recht im Zusammenhang der sozialen Normensysteme, in: Hirsch/Rehbinder (Hrsg.), Studien und Materialien zur Rechtsoziologie. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 11/1967, S. 36 ff. |
| Krobath, Hermann | Werte. Ein Streifzug durch Philosophie und Wissenschaft, 2009. |
| Krobath, Hermann | Werte in der Begegnung. Wertgrundlagen und Wertperspektiven ausgewählter Lebensbereiche, 2011. |
| v. Liszt, Franz | Über den Einfluss der soziologischen und anthropologischen Forschungen auf die Grundbegriffe des Strafrechts (1893), in: ders. (Hrsg.), Strafrechtliche Vorträge und Aufsätze, 2. Bd., 1905, S. 75 ff. |
| Popitz, Heinrich | Soziale Normen, herausgegeben von Friedrich Pohlmann und Wolfgang Eßbach, 2006. |
| Röhl, Klaus F. | Rechtssoziologie. Ein Lehrbuch, 1987. |
| Rottleuthner, Hubert | Rechtstheorie und Rechtssoziologie, 1981. |
| Rottleuthner, Hubert | Foundations of Law, 2005 (Pattaro (Hrsg.), A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence, Bd. 2). |
| Weber, Max | Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie (1922), 5. Aufl. 1972. |
Anmerkungen
[1]
Diese „Indikatorfunktion“ von Strafrechtsnormen wird in der Rechtssoziologie unter anderen Vorzeichen schon seit längerem diskutiert, etwa bei Durkheim, Über soziale Arbeitsteilung. Studie über die Organisation höherer Gesellschaften (1930), 7. dt. Aufl. 2016, der zwischen repressivem und restitutivem Recht unterscheidet und Bezüge zur sozialen „Solidarität“, also der moralischen Grundverfassung einer Gesellschaft, herausarbeitet. Diesen Hinweis verdanke ich Herrn Kollegen Hubert Rottleuthner, der den nachfolgenden Text schon in einer frühen Fassung kritisch gegengelesen und kommentiert hat, wofür ich ihm auch an dieser Stelle noch einmal herzlich danken möchte. Näher zu Durkheims Konzept einer Indikatorfunktion des (Straf-)Rechts Rottleuthner, Foundations of Law, S. 122 ff.
[2]
Die Formulierung stammt von Hassemer, Produktverantwortung im modernen Strafrecht, 2. Aufl. 1994, S. 8.
[3]
Schultz, Abschied vom Strafrecht, in Rehbinder (Hrsg.), Schweizerische Beiträge zur Rechtssoziologie. Eine Auswahl, 1984, S. 125–134, insb. S. 126.
[4]
v. Liszt, Über den Einfluss der soziologischen und anthropologischen Forschungen auf die Grundbegriffe des Strafrechts, in: ders., Strafrechtliche Vorträge und Aufsätze, Bd. 2, S. 80.
[5]
So die Forderungen am Schluss des „Marburger Programms“, v. Liszt, Der Zweckgedanke im Strafrecht (1882), in: ders., Strafrechtliche Vorträge und Aufsätze, Bd. 1, S. 178 f.
[6]
Vormbaum, Moderne Strafrechtsgeschichte, S. 118 ff.; 124 ff.; Eb. Schmidt, Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, 3. Aufl. 1965, ND. 1983, S. 368 ff.; siehe auch Koch, Binding vs. v. Liszt, Klassische und moderne Strafrechtsschule, in: Hilgendorf/Weitzel (Hrsg.), Der Strafgedanke in seiner historischen Entwicklung, S. 127 ff., 133 ff.
[7]
König, Das Recht im Zusammenhang der sozialen Normensysteme, in: Hirsch/Rehbinder (Hrsg.), Studien und Materialien zur Rechtsoziologie. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 11/1967, S. 36–53; Hirsch, Das Recht im sozialen Ordnungsgefüge, in: ders., Das Recht im sozialen Ordnungsgefüge. Beiträge zur Rechtssoziologie, 1966, S. 25–37. Aus dem angelsächsischen Sprachraum Friedman, The Legal System. A Social Science Perspective, 1975; ders., Impact. How Law Affects Behavior, 2016; Posner, Frontiers of Legal Theory, 2001, S. 288 ff.
[8]
Nicht näher behandelt werden soll hier die seit Tönnies umstrittene Unterscheidung zwischen „Gemeinschaft“ und „Gesellschaft“. Nach Tönnies handelt es sich um zwei völlig unterschiedliche Typen sozialer Organisation: Während „Gemeinschaft“ in nicht näher reflektierten Gefühlen von Solidarität und Zusammengehörigkeit wurzele, zeichne sich „Gesellschaft“ durch rationale Kalküle auf der Grundlage individueller Interessen aus (Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, 1887). Die Zugehörigkeit dieser Sicht zum Zeitgeist des ausgehenden 19. Jahrhunderts ist offenkundig. Näher zum Verhältnis von „Gesellschaft“ und „Gemeinschaft“ aus heutiger Sicht Rosa u.a., Theorien der Gemeinschaft zur Einführung, 2010.
[9]
Aristoteles, Politik, 1253a 1–11.
[10]
M. Weber definiert „soziales Handeln“ deshalb als solches Handeln, „welches seinem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und dadurch in seinem Ablauf orientiert ist“ (Wirtschaft und Gesellschaft, S. 1). An anderer Stelle heißt es: „Soziales Handeln (einschließlich des Unterlassens oder Duldens) kann orientiert werden am vergangenen, gegenwärtigen oder für künftig erwarteten Verhalten anderer (Rache für frühere Angriffe, Abwehr gegenwärtigen Angriffs, Verteidigungsmaßregeln gegen künftige Angriffe). Die „anderen“ können Einzelne und bekannte oder unbestimmt viele und ganz Unbekannte sein („Geld“ z.B. bedeutet ein Tauschgut, welches der Handelnde beim Tausch deshalb annimmt, weil er sein Handeln an der Erwartung orientiert, dass sehr zahlreiche, aber unbekannte und unbestimmt viele Andre es ihrerseits künftig in Tausch zu nehmen bereit sein werden).“ (Wirtschaft und Gesellschaft, 5. Aufl. 1972, S. 11).
[11]
H. Popitz, Soziale Normen, S. 74.
[12]
H. Albert spricht in diesem Zusammenhang treffend von einem „natürlichen Wertplatonismus der alltäglichen Weltorientierung“, in: ders., Traktat über kritische Vernunft, 5. Aufl. 1991, S. 66.
[13]
Die Debatte leidet allerdings darunter, dass Konzepte wie „Norm“, „normativ“ oder „Normativität“ in ganz unterschiedlichen Bedeutungen verwendet werden, dazu (am Beispiel des Begriffs „normativ“) Hilgendorf, Rottleuthner-FS, S. 45–61. So verwendet etwa E. Posner den Begriff „social norm“, um Verhaltensregularitäten zu beschreiben, also rein deskriptiv (Posner, Law and Social Norms, 2000, S. 7 f.; 34), während Möllers, Die Möglichkeit der Normen, 2015, Normen als „positiv markierte Möglichkeiten“ versteht. Primär wissenschaftslogisch orientiert sind die Beiträge in Braybrooke (ed.), Social Rules. Origin, Character, Logic, Change, 1996. Klärend Hoerster, Norm: Begriff, Geltung und Wirklichkeit, in: W. Krawietz u.a. (Hrsg.), Politische Herrschaftsstrukturen und Neuer Konstitutionalismus – Iberoamerika und Europa in theorievergleichender Perspektive, 2000, S. 235 ff., und Stemmer, Die Konstitution der normativen Wirklichkeit, in: Forst/Günther (Hrsg.), Die Herausbildung normativer Ordnungen, S. 57 ff.; aus Sicht einer allgemeinen Rechtslehre Meyer-Cording, Die Rechtsnormen, 1971, S. 6 ff.; umfassend Kelsen, Allgemeine Theorie der Normen, hrsg. von Ringhofer und Walter, 1979.
[14]
Grundlegend Geiger, Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts, S. 54 ff.; Deimling, Recht und Moral. Gedanken zur Rechtserziehung, 1972, S. 17 f. Siehe auch Luhmann, Rechtssoziologie, 2. Aufl. 1983, S. 31 ff., 40 ff., der allgemein von Erwartungen als anthropologischen Konstanten ausgeht und zwischen kognitiven und normativen Erwartungen differenziert. Der Unterschied wird allerdings erst im Enttäuschungsfall erkennbar. Normen, welcher Art auch immer, haben ihr Fundament in (normativen) Erwartungen. Dagegen hält Lucke, Artikel „Norm und Sanktion“ in: Endruweit/Trommsdorff/Burzan (Hrsg.), Wörterbuch der Soziologie. 3., völlig überarb. Aufl. 2014, S. 340 die Frage nach der „konkreten Normentstehung“ für nach wie vor „theoretisch und empirisch weithin unbeantwortet“.
[15]
Die Terminologie ist nicht einheitlich.
[16]
Der Begriff „Verhaltensnorm“ wird hier also nicht im Sinne der (für die oben behandelten Zusammenhänge wenig ertragreichen) Normentheorie Bindings behandelt, vgl. Binding, Die Normen und ihre Übertretung, Bd. 1, S. 45. Näher am hier verwendeten Sprachgebrauch liegt Max Ernst Mayer mit seinem Konzept von „Kulturnormen“ (Rechtsnormen und Kulturnormen, 1903, insbes. S. 130 ff. in Auseinandersetzung mit Binding).
[17]
Lucke, Artikel „Norm und Sanktion“, in: Endruweit/Trommsdorff/Burzan (Hrsg.), Wörterbuch der Soziologie, S. 338.
[18]
Deimling hat zu Recht darauf hingewiesen, dass Normen auch heute noch auf diese Weise entstehen: Überall „da, wo Menschen unterschiedlicher kultureller Tradition und Nationalität einander begegnen, die weder eine gemeinsame Sprache sprechen noch über gemeinsame Erfahrungen im Umgang miteinander verfügen, kommt es in der Regel nicht zu einem Chaos. Die gegenseitige Beobachtung und Kontrolle der Mimik und Gestik, der Vibration der Stimme oder anderer verhaltensrelevanter Äußerungen sowie die sich aus der Deutung der beobachteten Phänomene spontan ergebenden Reaktionen der Beteiligten erzeugen Situationen, denen zwar noch keine verbindlichen Verhaltensregeln zugrunde liegen, in denen sich aber, wenn sie nur lang genug dauern und sich öfter wiederholen, gewisse Gleichförmigkeiten des Verhaltens entwickeln.“ (Deimling, Recht und Moral, S. 17 f.) Man beachte, dass Gleichförmigkeiten noch keine Normen sind; der Sprachgebrauch ist allerdings uneinheitlich.
[19]
W. Vogel, Die Religionsstifter, 2008.
[20]
Burns, Leadership, 1978; allgemein zum Führungsbegriff Kerschreiter/Frey, Art. „Führung“, in: Endruweit/Trommsdorff/Burzan (Hrsg.), Wörterbuch der Soziologie, S. 132–136.
[21]
Der Begriff „Moralunternehmer“ oder „moralischer Unternehmer“ (moral entrepreneur) scheint erstmals von dem US-amerikanischen Soziologen Howard Saul Becker verwendet worden zu sein (Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance, 1963).
[22]
Popitz, Soziale Normen, S. 62.
[23]
„So werden z.B. in jeder Kultur in einigen typischen, häufig wiederkehrenden Situationen verschiedenartige Verhaltensgebote an Männer und Frauen gestellt. Der Unterschied der Geschlechter kommt also auch in der Formulierung von Sozialnormen irgendwie zum Ausdruck. Vergleicht man jedoch die etwa den Frauen zugeschriebenen Sozialnormen in den uns bekannten Kulturen miteinander, so erweist es sich als äußerst schwierig, universal gültige Gemeinsamkeiten ‚wesenseigene‘ Verhaltenskonstanten zu finden. Der biologische Unterschied der Geschlechter ist im Hinblick auf das jeweils gebotene Verhalten offensichtlich nicht mehr als ein Startpunkt, ein Ansatzpunkt, von dem aus sich in jeder Kultur eine besondere Reihe von ‚Wesensunterschieden‘ entwickelt. Jede dieser kulturspezifischen Varianten erscheint uns, von außen gesehen, als mehr oder weniger willkürlich – oder besser: als künstlich.“ (Popitz, Soziale Normen, S. 62).
[24]
Popitz, Soziale Normen, S. 62; ebenso schon Murdock, Social Structure, 1949, S. 284 ff.
[25]
Einführend Voland, Von der Ordnung ohne Recht zum Recht durch Ordnung. Die Entstehung von Rechtsnormen aus evolutionsbiologischer Sicht, in: Lampe (Hrsg.), Zur Entwicklung von Rechtsbewusstsein, 1997, S. 111–13; ausführlich ders., Soziobiologie: Die Evolution von Kooperation und Konkurrenz, 4. Aufl. 2013; Bischof, Moral. Ihre Natur, ihre Dynamik und ihr Schatten, 2012. Aus soziologischer Sicht Esser, Soziologie. Allgemeine Grundlagen, 3. Aufl. 1999, S. 143–215. Kritisch zur Leistungsfähigkeit biologischer Ansätze für die Erklärung von Genese oder Inhalt sozialer Normen Rottleuthner, Foundations of Law, 2005, S. 70 ff.; vgl. auch dens., Biologie und Recht, in: Zeitschrift für Rechtssoziologie, 1985, 104–126.
[26]
M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Bd. 1, S. 21; R. König, Das Recht im Zusammenhang der sozialen Normensysteme, 42. Sack, Probleme der Kriminalsoziologie, in: R. König (Hrsg.), Handbuch der empirischen Sozialforschung, 2. Aufl. 1978 (Taschenbuchausgabe), Bd. 12, S. 369 betont die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Typen sozialer Normen.
[27]
Geiger, Vorstudien, S. 60.
[28]
Ebenda.
[29]
Ebenda. Der Sanktionsbegriff erfasst grundsätzlich positive wie negative Reaktionen, wird aber heute meist nur für negativ bewertende Reaktionen verwendet, vgl. Baer, Rechtssoziologie. Eine Einführung in die interdisziplinäre Rechtsforschung, 3. Aufl. 2016, § 9 Rn. 5 ff.; Lucke, „Norm und Sanktion“, in: Endruweit/Trommsdorff/Burzan (Hrsg.), Wörterbuch der Soziologie, S. 338.
[30]
Deimling, Recht und Moral, S. 31.
[31]
v. Liszt, Lehrbuch, S. 27 f.
[32]
Geiger, Vorstudien, S. 82 f.
[33]
Popitz, Soziale Normen, S. 65. Hervorhebung i.O.
[34]
A.a.O., S. 66. Hervorhebung i.O.
[35]
Zum Rollenkonzept näher Schäfers, Einführung in die Soziologie, 2. Aufl. 2016, S. 76 ff.
[36]
A.a.O., S. 68.
[37]
A.a.O., S. 71.
[38]
A.a.O., S. 71. Zum damit angeschnittenen Themenfeld der „sozialen Kontrolle“ Schäfers, Einführung in die Soziologie, 2. Aufl. 2016, S. 81 ff.; Peukert, Abweichendes Verhalten und soziale Kontrolle, in: Korte/Schäfers (Hrsg.), Einführung in Hauptbegriffe der Soziologie, 9. Aufl. 2016, S. 127 ff.
[39]
A.a.O., S. 73.
[40]
Ebenda.
[41]
Deimling, Recht und Moral, S. 31 f.
[42]
Sack, Probleme der Kriminalsoziologie, in: R. König (Hrsg.), Handbuch der empirischen Sozialforschung, 2. Aufl. 1978 (Taschenbuchausgabe), Band 12, S. 370 schreibt, dass „der Typologie von Normensystemen auch eine analoge der Sanktionssysteme“ entspräche, „d.h. die Mittel und Mechanismen, derer sich Gesellschaften und andere soziale Gebilde zur Durchsetzung ihrer Verhaltenserwartungen an ihre Mitglieder bedienen, variieren mit dem Typ des Regelungssystems, das ein bestimmtes Verhalten verletzt“.