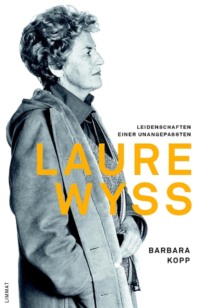Kitabı oku: «Laure Wyss», sayfa 2
Lor Wyss könnte ihren Satz auch persönlich gemeint haben. Das Verzichten wäre ein Verzichten aus Nicht-Können. Der Satz enthielte die Botschaft, dass sie nicht mit Haut und Haaren lieben, sich nicht auf Gedeih und Verderb hingeben kann. Sie hätte eine Scheu vor fester Bindung zugegeben und die Angst, von seiner Heftigkeit erstickt zu werden.
Ernst Zietzschmann holte sich Rat bei der Schwester, und sie, die angehende Juristin, gab ihm eine Antwort, die rechtlich verstanden werden kann.
«Lange noch mit Hanne sprechen. Sie schilt mich, dass ich wieder gefragt habe. Lor will frei sein, will sich nicht beugen.»
Hin und wieder kam Mutter Zietzschmann nach Zürich, besuchte Verwandte und schaute beim Sohn nach dem Rechten, kochte ihm mittags, stopfte und flickte, was schadhaft und löchrig geworden war. Er vermerkte im Kalender:
«Mittags sehr sehr lieb sehr ruhig mit dem Muttel essen. Ein bissel musizieren. Das schmeckt. Du solltest halt doch immer hierbleiben. Dein Junge könnte Dich schon gebrauchen.»
Vor der Abreise nach Berlin schickte ihm Lor keine hausmütterliche Botschaft. In ihrem letzten Brief zitierte sie die berühmte Gedichtzeile von Hans Carossa:
«Verhänge die Spiegel! Weihe dich einer Gefahr!»
FESTSTELLUNGEN I, JEAN-PAUL MARCHAND
«Ich bin 1933 geboren und genau zwanzig Jahre jünger als Lor. Ihre Mutter Anna Berta Wyss-Uhlmann war die jüngere Schwester meiner Großmutter Marie Marchand-Uhlmann. Für mich war Lors Mutter einfach das Tanti Berti und ihr Vater der Onkel Werner. Als ich ein Kind war, fuhren wir im Winter bei Magglingen Ski, und gelegentlich besuchten wir auf dem Heimweg das Ehepaar Wyss zum Tee. Lor war damals verheiratet und bei ihren Eltern manchmal auf Besuch. Einmal nahm sie mich als Neunjährigen zwischen ihre Skier und raste im Karacho von Magglingen nach Leubringen und auf den letzten Schneeflecken hinunter bis in die Stadt.
Meine Großmutter war immer in Geldnöten, sie war als Verschwenderin bekannt und hat immer allen alles geschenkt. Sie war eine sehr stattliche Frau, behäbig, kochte sehr gut, aß auch gerne gut, trank gerne und redete gerne viel. Tante Berti dagegen war hochgewachsen und wurde nicht fest wie ihre Schwester. Sie gab auch nie so viel auf gutes Essen. Sie war eckiger, intellektueller in der Art, zurückhaltend und voller Vorbehalte. Zuweilen war sie auch verbeustigt, also sie wusste, was sie hatte, und das hielt sie zusammen. Tante Berti hatte etwas Sparsames, auch etwas Karges an sich, so wie Gotthelf einen bestimmten Typus von Bäuerinnen darstellte. Beide Schwestern spielten Klavier und liebten Chopin. Meine Großmutter war ausladend, wenn sie Chopin spielte. Bevor sie zwanzig waren, ließen sich die beiden Schwestern alle Zähne ausreißen und ein Gebiss einsetzen, weil es Mode war. Als Bub fragte ich mich immer, weshalb meine Großmutter so regelmäßige Zähne hatte. Das wirkte nicht natürlich, weil damals alle krumme Zähne hatten. Bei Tante Berti war es auch so, obschon die beiden sonst in ihrer Art sehr konträr waren. Etwas hatten sie gemeinsam. Sie waren gwunderig wie alle Uhlmanns, die ein großes Interesse an der äußeren Welt hatten. Sie wussten einfach alles, was in Biel passierte und was über andere Leute gesprochen wurde. Meine Großmutter kolportierte auch Gerüchte. Das tat Tante Berti nicht. Sie war disziplinierter, dadurch war sie als Mutter auch effizienter. Lor opponierte gegen den mütterlichen Gwunder und gegen die Bevormundung. Indem sie ins Ausland ging, kam sie ein wenig aus dem Fokus der Mutter und ihrer Tutel.
Bei unseren Besuchen saß Lors Vater, Onkel Werner, im Lehnstuhl, lächelte ein wenig und sagte nicht viel. Ein Stiller. Er hatte eine fliehende Stirn und ein Glatze. Körperlich war er sehr fest, von gedrungener Gestalt. Er glich äußerlich den Advokaten, wie sie Honoré Daumier gemalt hatte. Er hatte etwas Geschliffenes an sich, aber ihm fehlte das Flamboyante, das Schaupielerische und die Freude, in der Öffentlichkeit zu paradieren. Ich glaube nicht, dass er sich so gerne in der Öffentlichkeit bewegt hatte, obwohl er Stadtrat und Großrat gewesen war. Lor hingegen hatte diese Eigenschaften, dieses Auffällige, Schillernde und sehr Bewusste. Der Vater war softspoken, seine Tochter outspoken.
Der verehrteste Mann in der Familie war Lors Großvater, der Rektor des Bieler Gymnasiums. Jakob Wyss war ein sehr gestrenger Herr. Mein Vater kletterte einmal als Kind aus Übermut die Kletterstange hoch und rüttelte oben übermütig am Gerüst. Der Rektor holte ihn herunter und gab ihm eine Watsche, links und rechts. Voilà. Der Schriftsteller Robert Walser ging bei ihm in den Unterricht und schrieb über ihn, dass er seine Prügel vorschriftsgemäß und gerecht verteilt habe.
Jakob Wyss bewunderte das alte Rom sehr, vielleicht sogar mehr als Griechenland. In der Familie erzählte man sich, dass er sich mit 75 Jahren die Venen aufgeschnitten habe, in der höchsten Blüte seines Daseins, weil er der Welt das Schauspiel von seinem körperlichen Nachlassen habe ersparen wollen. Er habe verhindern wollen, dass andere über ihn bestimmen können, wenn er gebrechlich werde. Man erzählte sich auch, er habe sich die Venen beinahe auf altrömische Art geöffnet, im Freundeskreis, bei gutem Wein und Rezitationen von Horaz und anderen römischen Dichtern. Sein Herzleiden und der Selbstmord sind Tatsachen, der Rest ist Ausschmückung und Kolportage. Man erzählte sich diese Geschichte immer mit Bewunderung und Furcht, weil man Jakob Wyss für fähig hielt, in diesem Sinne den Klassizismus und die Selbstdisziplin auf die Spitze zu treiben.
Eigentlich hatte Jakob Wyss wie ein römischer Republikaner die Haltung, dass es zur Bestimmung und zur Aufgabe eines Menschen gehöre, sich für die Gemeinschaft einzusetzen. Etwas von dieser Haltung vererbte sich in der Familie, ein Pflichtgefühl, ein Verantwortungsbewusstsein. Lorli musste sich irgendwie durch diesen Großvater verpflichtet gefühlt haben. Die Art, sich zu versagen, war jedoch ihrer Schwester fast angeboren. Hildi war zurückhaltend, im Denken sehr sachlich und nüchtern. Sie hatte etwas Trockenes, selbst ihre Stimme war verwundert trocken. Lor dagegen war energisch, heftig, getrieben von Widersprüchen und Ressentiments. Die Willensanstrengung, sich zurückzunehmen, gelang ihr nur bedingt. Aber Lor hatte einen selbstgestalterischen, objektiven Willen, und diesen Willen hatte auch Rektor Wyss.»
BERLINER WEGE
Mitte Oktober 1934 fuhr Lor Wyss mit ihrem «Passeport de la Confédération Suisse» über die deutsche Reichsgrenze, Hanni Zietzschmann reiste aus Hannover mit ihrer neuen Klingenthaler Geige im Gepäck nach Berlin.
Am Fehrbelliner Platz, wo die beiden Studentinnen täglich vorbeikamen, hielt die U-Bahn in einer braunen Säulenhalle, und auf den Schildern der Haltestelle saßen Käuzchen aus Email, als stiegen die Fahrgäste im Eichenwald ein und aus. An den Wänden prangten Darstellungen von Pferdeomnibussen und Dampfstraßenbahnen und adelten die Errungenschaft des unterirdischen Transports. Beim Kassenhäuschen gingen die Fahrgäste unter der Pforte des kriegerischen Fortschritts durch viel Schmiedeisernes mit Kurfürstenkrone, Lorbeer und Eichenlaub. Fehrbellin, so hieß die Ortschaft, wo der Kurfürst Friedrich Wilhelm mit einem Sieg den Dreißigjährigen Krieg beendet hatte und Preußen dank der Erfindung eines stehenden Heeres zur gefürchteten Macht aufgestiegen war. Die Bauherrschaft sah nicht vor, dass durch dieses Tor die Arbeiterschaft zog. Im roten Wedding wurde bei den Haltestellen auf jeglichen Schmuck verzichtet. Am Fehrbelliner Platz aber, im Westen Berlins, sollte der Mittelstand sein Kreuz gerade richten, gestärkt in seiner Untertanentreue und fortschrittsgläubig zur Arbeit gehen.
Die Ausgestaltung des Fehrbelliner Platzes hätte dem preußischen Aufstieg huldigen sollen, die unterirdische Halle wäre der Auftakt zum oberirdischen Pomp gewesen, hätten nicht ein Weltkrieg und die Abdankung des letzten deutschen Kaisers und preußischen Königs die Pläne versanden lassen. Im Herbst ernteten die Laubenpieper zwischen den Chausseen Kohl und Kürbisse, Fußballclubs spielten auf mindestens vier Feldern, und bevor der Zirkus im Winter gastierte, wurde auf dem Gelände wie immer um diese Zeit kräftig Bier gezapft.
Die nationalsozialistische Regierung bereitete nun die Durchgestaltung der Brache vor. Nach den Plänen sollten, im Halbrund angeordnet, Verwaltungsgebäude entstehen, dazwischen ein Triumphbogen, durch den dreißigtausend zur Platzmitte strömen und beim Ehrenmal Aufstellung nehmen sollten. Das Ehrenmal zum «Gedenken unserer für die deutsche Freiheitsbewegung gefallenen Kameraden» stand bereits. Nahe beim Eingang zur U-Bahn-Station ragte zwischen Fahnenstangen ein riesiger Findling aus dem Boden.
Das Maß der Zukunft setzte am Rand der Brache ein Bau mit gleißenden Fensterfluchten und einem Flachdach, das sich in den Himmel schob. Die Deutsche Lebensversicherung. Nicht weit davon ein langgestreckter Komplex mit dem ersten Bürohochhaus von Berlin. Die Reichsversicherungsanstalt der Angestellten. Dazwischen befand sich ein Häuserblock, dem anstelle des Dachs die Zwiebeltürme einer russischen Kirche aufgesetzt worden waren.
Beim Fehrbelliner Platz fanden die beiden Studentinnen an der Mansfelderstraße ein Zimmer in Untermiete. Die Mansfelderstraße führte hinter der Deutschen Lebensversicherung an Landhäusern und weiß gestrichenen Holzzäunen vorbei und endete bei den Garagen, in denen für die nahe gelegene «Automobil-Verkehrs-Übungs-Strecke» AVUS geschweißt und geschmiert wurde. Zwischen den Landhäusern entstanden die ersten Mietshäuser, als am Fehrbelliner Platz die Versicherungen bauten. Wer in einem der neuen Häuser zur Miete wohnte, besaß Geld für Annehmlichkeiten, jedoch nur für das Zweckmäßige. Das Treppenhaus war eng und schmucklos, verfügte jedoch über einen Personenaufzug. In der Beletage erstreckten sich die Wohnungen über vier, fünf Zimmer, besaßen ein Entrée mit angrenzendem Ankleideraum und ein Bad mit Wanne und eigenem Wasserklosett.
«Herrlich», notierte Hanni in ihrer Taschenagenda und fügte den Namen «Frau van der Polle» hinzu. Der Bruder schrieb in seinen Tagesnotizen «Madame v. d. Poll». Sicher ist, dass die Vermieterin Jüdin war, womöglich war sie die soeben verlassene Ehefrau des berühmten holländischen Fotojournalisten Willem van de Poll, der für das «Berliner Tageblatt» und die «Berliner Illustrierte» arbeitete. Allerdings führt das jüdische Adressbuch von Groß-Berlin keinen so oder ähnlich geschriebenen Namen auf.
Der Fehrbelliner Platz gehörte zum ländlichen Teil des Bezirkes Wilmersdorf. Die U-Bahn führte direkt zum Kurfürstendamm, und bis zum Grunewald war es nicht weit. Ärzte und Rechtsanwälte, Studienräte und Staatsbeamte, ferner die Angestellten aus den nahen Versicherungen hatten sich hier niedergelassen. Die Zimmerwahl der beiden Studentinnen war keine Absage an die bürgerliche Welt der Eltern. Sie hatten sich in Berlin einen Stadtteil gesucht, der in manchem den Orten ihrer Herkunft ähnelte.
Die Friedrich-Wilhelms-Universität befand sich Unter den Linden, an der Prachtstraße, die das Brandenburger Tor mit dem Stadtschloss, mit dem Lustgarten und dem Dom verband. Das Hauptgebäude war im einstigen Palais des Prinzen Heinrich von Preußen untergebracht. Im Vorhof hatte die Verwaltung gerade erst den verwilderten Garten gerodet und die frei gewordene Fläche für Aufmärsche gepflastert.
Die Studienbewerber mit deutschem Pass hatten für die Immatrikulation den «Fragebogen zur Feststellung der Abstammung» auszufüllen. Die Konfession des Vaters, der Mutter, der Großeltern väterlicher- wie mütterlicherseits musste nachgewiesen und ein allfälliger Konfessionswechsel offengelegt werden. Weiter prüfte der Fragebogen die Gesinnung.
«Welchen politischen Parteien haben Sie bisher angehört?»
«Welchen sonstigen Vereinigungen irgendwelcher Art haben Sie angehört?»
«Haben Ihr Vater oder Sie selbst im Weltkrieg an der Front für das Deutsche Reich oder für seine Verbündeten gekämpft?»
Für den «Nachweis über engere Beziehungen zum Deutschtum» stand ein ganzes Seitendrittel zur Verfügung. Manche hoben die väterliche Parteizugehörigkeit hervor, beteuerten, eine strenge, vaterländische Erziehung genossen zu haben, und schimpften zum Beweis auf die Weimarer Republik. Andere unterstrichen ihre heimatliche Verbundenheit mit der Uckermark oder dem Erzgebirge, nur unter Deutschen seien sie aufgewachsen, folglich mit jeder Faser ihres Daseins deutscher Denkungsart, deutscher Sitte und deutscher Kultur verpflichtet. Etliche verwiesen auf ihren Bruder oder ihren Cousin bei der SA, viele beteuerten, später dem Vaterland dienen zu wollen, und gelte es mit der Waffe in der Hand. Es gab auch solche, die ihre Unterschrift unter leeres Papier setzten.
Hanni Zietzschmanns Fragebogen ist wie der Großteil aller Fragebögen im Universitätsarchiv unauffindbar. «Möglicher Kriegsverlust», so die Umschreibung des Archivs für Akten, die einst existiert hatten.
Seit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler verschärfte das Rektorat fortwährend die Kontrollmaßnahmen. Zuerst hatten die Studienanfänger das Formular auszufüllen, später auch die Studierenden der höheren Semester. Zur Bewältigung der neuen administrativen Arbeit beauftragte das Rektorat Studierende, die sich im «Nationalsozialistischen Studentenbund» hervorgetan hatten. Der «Ausschuss zur Prüfung für das Studium von Nichtariern» begutachtete die Fragebogen, errechnete den Prozentsatz der «rassischen Abstammung» und entschied über Aufnahme oder Ablehnung, über Fortsetzung oder Abbruch eines Studiums. Der Studentenführer überprüfte den Entscheid und stempelte zur Legitimation den passenden Paragraphen eines kürzlich eingeführten Erlasses auf das Formular. Die Auswirkungen dieser Maßnahmen beschrieb der Rektoratsbericht der Jahre 1935 bis 1937 so:
«Mit solchen Handhaben ist es schon in verhältnismäßig kurzer Zeit gelungen, einen großen Teil der unsauberen Elemente in der Studentenschaft, die sich bei einer Großuniversität wie Berlin erfahrungsgemäß immer einschleichen und die die unklaren Führungsverhältnisse als außerordentlich bequem und angenehm für sich empfanden, zu fassen und zu eliminieren oder zu verdrängen.»
Lor Wyss musste als Ausländerin noch keinen Fragebogen ausfüllen, ein Bewerbungsschreiben reichte. Am selben Tag, als ihr Schreiben mit der Post eintraf, genehmigte der Stellvertreter des Rektors die Zulassung zur Immatrikulation. Danach ging die Akte durch etliche Hände, die überprüften, erfassten, ordneten. Jemand vertiefte sich stillschweigend in die Akte, nachdem der Stellvertreter des Rektors die Genehmigung erteilt hatte. Es mag am Ypsilon im Familiennamen gelegen haben oder am Vornamen, der beim heimlich Prüfenden einen Verdacht weckte. Der Umstand, dass die Antragsstellerin nirgends ihre Konfession angab, auch nichts über ihr Verhältnis zur deutschen Kultur geschrieben hatte, konnte als Indiz gedeutet werden. Jemand setzte auf ihre Bewerbung ein großes Fragezeichen neben den Genehmigungsstempel und fügte hinzu: «mos.?»
Jeder Beamte, jede Sekretärin kannte die Bedeutung der Abkürzung. In den drei Buchstaben manifestierte sich der Verdacht, dass es sich um den Antrag einer Studentin mosaischen Glaubens handeln könnte, einer Jüdin. Der «Ausschuss zur Prüfung für das Studium von Nichtariern» sah möglicherweise ohne Auftrag auch die Bewerbungen aus dem Ausland durch. Nationalsozialistisch gesinnte Studenten machten sich einen Sport daraus, Namen von jüdischen und kommunistischen Kommilitonen zu sammeln und ans Rektorat weiterzuleiten. Auch Universitätsangestellte, denen die offiziellen Maßnahmen zu wenig weit gingen, bespitzelten und denunzierten. Der Verdacht wurde mit feinem Bleistiftstrich auf der Akte hinterlassen, sodass er allenfalls leicht zu entfernen war, ohne auf dem Papier Spuren zu verursachen.
Bei der Immatrikulation gab Lor Wyss auf der Kanzlei ihre Studentenkarte ab. Die Silbe der Kindheit hatte sie vom Namen abgetrennt, aber als sie die Karte ausfüllen musste, endete die Weitläufigkeit wieder bei Biel. Was galt in der deutschen Reichshauptstadt ein Dorf, dessen Außerordentlichkeit sich darin erschöpfte, dass es zwei Ortsnamen besaß? Die ganze Wohnbevölkerung der Schweiz hätte Platz gefunden in den Mietshäusern von Groß-Berlin.
Familienname: Wyss
Rufname: Lor
Wohnung in Groß-Berlin: Wilmersdorf
Wohnort der Eltern: Leubringen
Straße Nr.: ob Biel
Mit dem Wort ob für oberhalb band sie das Dorf an die Stadt, deren Uhrmacherkunst auch in Berlin bekannt sein musste.
Die Akte mit der Verdächtigung lag bei der Immatrikulation auf dem Tisch. Was sich bei der Einschreibung abspielte, hinterließ auf Papier keinen Hinweis, der auf ein außerordentliches Geschehen schließen lässt. Auf dem Bewerbungsschreiben von Lor-Elisabeth Wyss befinden sich oben links der Genehmigungsstempel und die Unterschrift des stellvertretenden Rektors, daneben das Fragezeichen und die drei Buchstaben, rechts davon steht der Datumsstempel der erfolgten Immatrikulation. Danach ging die Akte wiederum durch etliche Hände, die überprüften, erfassten, ordneten. Denkbar ist auch, dass die drei Buchstaben und das Fragezeichen erst nach der Immatrikulation auf die Akte geschrieben wurden, allerdings stellt sich die Frage, weshalb das Fragezeichen nur beim Genehmigungsstempel und nicht auch beim Immatrikulationsstempel hingesetzt wurde.
Hanni Zietzschmann schrieb wie ihr Bruder Tagesnotizen in die Taschenagenda.
Als ersten Eindruck der Berliner Hochschule notierte sie: «Uni – trostlos». Dann: «Uni noch trostloser». Zur Immatrikulation bemerkte sie: «Mo von 9–½ 1 stehen. Anmeldg. zur Immatr. Furchtbar.» Am ersten Semestertag nahm sie das Deprimierende nicht mehr wahr. «Die Hörsäle sind hell + vornehm.» Am zweiten Semestertag musste sich etwas für sie Außerordentliches ereignet haben, denn sie notierte: «Martin Wolff!» An der juristischen Fakultät lehrte Martin Wolff bürgerliches Recht und Rechtsgeschichte. Im Jahr zuvor, als nationalsozialistische Studenten auf dem Opernplatz Bücher verbrannt hatten, waren der jüdische Rechtsprofessor wiederholt schikaniert und seine Vorlesungen gestört worden. Denkbar, dass nationalsozialistisch gesinnte Studenten vor den Studienanfängern ein Exempel statuierten und am zweiten Semestertag gegen den jüdischen Professor hetzten. Immer war irgendwo Geschrei und ergab sich eine Rempelei, rechtsgerichtete Studenten provozierten auf dem Vorhof zur Universität Korpsstudenten, bis irgendeiner zuschlug, Nationalsozialisten hinderten vor den Vorlesungssälen die verbleibenden jüdischen Kommilitonen am Eintreten, politisch unerwünschte Dozenten wurden mit Sprechchören niedergeschrien, kommunistische Studenten zündeten am Jahrestag der russischen Revolution Zettelbomben und ließen Aufrufe zum Sturz Hitlers durch die Luft wirbeln. Hanni notierte nach ihrem Eintrag zum zweiten Semestertag nichts mehr zu den Vorkommnissen an der Universität. Sie wurde von etwas anderem in Beschlag genommen.
Kurz vor ihrem zwanzigsten Geburtstag hatte sie in der Philharmonie gesessen und gesehen, wie Elly Ney zum Konzertflügel schritt, mit unbändiger Mähne, die ihr Gesicht halb verdeckte, und in wallendem Abendkleid, das nur die Unterarme freigab, ihre Nacktheit geradezu hervorhob. Und wie sie spielte:
«Brahms f-moll Sonate!! I. Satz + Scherzo!! Bach Choralkantate (22) + Präludien + Fugen; Beethoven Sonate op. 110 As-Dur!! Schumann Carneval. Toll, phantastisch, mitreißend. Zugaben: Chopin Walzer Nr. 2; As-Dur Polonaise!! Haarig! Kraft, Dämonie! Brahmswalzer + Wiegenlied.
Das größte mitreißendste Konzert!! Eine Frau!! Gewaltigstes Musikerlebnis – sie verfolgt mich mit ihrem Spiel.»
Die Musik war so überwältigend wie der Anblick dieser Frau. Elly Ney hätte ihre Mutter sein können, aber was sie darstellte, war etwas anderes, als die Generation ihrer Mutter vorlebte. Elly Ney hatte eine Tochter, und sie war die Frau, die nicht nur Beethoven spielte, sondern neben diesem Titanen thronte. Musikkritiker beschwörten unermüdlich eine Übereinstimmung zwischen Komponist und Interpretin. So Carl von Pidoll:
«Es zeigt sich eine erschütternde Ähnlichkeit dieses Künstlergesichtes mit einem anderen, das uns allen tief vertraut ist – eine Ähnlichkeit, die sich nicht nur in äußeren Zügen aufzwingt, in Nase, Stirn, Augen, Schädelform, eine Ähnlichkeit, die noch stärker überzeugt durch das innere, verschleiert lodernde Feuer, das hier wie dort das Wesen des Ausdrucks bestimmt. [...]
Jenes Feuer, dessen Inhalt Trotz ist: nämlich für Glaube, Schönheit, Harmonie, Gerechtigkeit, Güte und Sauberkeit zu leben, zu kämpfen, zu sterben.»
Früh hatte sich Elly Ney auf das Werk von Beethoven konzentriert und begonnen, eine ähnliche Lockenfrisur zu tragen. Sie war längst eine bekannte Pianistin, als Hitler an die Macht kam.
Dank der nationalsozialistischen Kulturpolitik stieg ihr Ansehen und ihre Verehrung weiter. Sie war bald die Einzige, die Beethoven interpretierte, als jüdische Pianisten sein Werk nicht mehr spielen und nicht mehr auftreten durften. Im Dienst der nationalsozialistischen Organisation «Kraft durch Freude» gab sie überall Volkskonzerte und spielte mit Vorliebe vor Jugendlichen. Adolf Hitler, den sie verehrte, teilte sie mit, dass Kunst für sie «keine Profession, kein Handel, sondern Religion» sei. An Konzerten führte sie weihevoll in Beethovens Werk ein oder las aus seinem Heiligenstädter Testament vor, bevor sie zu spielen begann. Zum Beethovenfest 1938 verkündete sie der Hitlerjugend:
«Dieser große deutsche Meister erschüttert die Seelen durch das unfassbare Wunder seines Werkes. Schwer bedrängten ihn Gewalten und Mächte – doch er schuf sich Erlösung im Kunstwerk. Er bannte seine übermächtigen Erlebnisse, das schwerste Schicksal in die Form. [...]
So wird er uns zum Vorbild, zur Forderung und Verpflichtung.»
Elly Ney versprach ein Mysterium, das sich durch Beethovens Musik vollziehe, und redete gerne von «Erschütterung», von «Ergriffensein» und vom «Strömen der Seelenkräfte». Sie verhieß große Gefühle und den Glauben an die Formbarkeit des eigenen Lebens. Ihre Auftritte rührten bei Hanni Zietzschmann an eine Sehnsucht nach Hingabe und Bedeutung. Elly Ney wurde ihr weibliches Idol, dem sie wie ein Teenager erlag.
In Berlin nahm sie Geigenstunden bei Agnes Ritter, einer Nachwuchsmusikerin aus Hannover, die von Elly Ney zum Kaffee empfangen wurde. Am 18. Dezember schrieb sie in ihre Taschenagenda:
«Vielleicht – heute Abend – –? Stumpf geschlafen. ½ 7 im Funkhaus. Und dann saß ich neben ihr + blätterte um. Ich!!»
Als Erstes wurde im Radiostudio geprüft, ob sie die Noten zum richtigen Zeitpunkt zu wenden wusste, während Elly Ney spielte. Später wurde ihre Eignung zur Erledigung von Korrespondenz getestet. Daraufhin entschloss sich Hanni, ihr Studium aufzugeben oder zumindest zurückzustellen, um den Dienst bei ihrem Idol anzutreten. Der Bruder dachte an familiäre Erwartungen. Er kommentierte: «Einigermaßen verrückt. Arme Mutt.»
Ernst Zietzschmann zog seit dem Tag, an dem seine Schwester und seine Geliebte nach Berlin abgereist waren, über die Seiten seines Taschenkalenders einen Querstrich. Über dem Strich notierte er, was er aus Lors Briefen für erwähnenswert hielt, unter dem Strich wandte er sich seinem eigenen Leben zu. Vor Semesteranfang steht über dem Strich:
«Du bist in Potsdam + Sanssouci den ganzen Tag. Allein.»
«Du bist im Deutschen Museum.»
«Universität. Warten mittags in der überfüllten Mensa. Ekel im Hals.»
Bei Semesterbeginn blieb der Platz über dem Strich die ersten Tage leer. Am 8. November 1934 notierte er:
«Bekenntniskirche. Kaiserdamm. 15 000 Menschen. Dann nachts Funkturm.»
An diesem Abend sprach auf dem Gelände der Messe beim Kaiserdamm der Berliner Pfarrer Martin Niemöller. Er war einer der Anführer der Bekennenden Kirche, ein Bündnis, in dem sich soeben evangelische Theologen und Laien gegen die nationalsozialistisch gesinnten Deutschen Christen zusammengeschlossen hatten und sich Hitlers Kirchenpolitik widersetzten. Adolf Kurtz, Pfarrer in Berlin-Schöneberg, hielt ebenfalls eine Ansprache und schrieb in seinen Erinnerungen über diesen Abend:
«Zehn Tage danach [nach den Reformationsfeiern] fanden wiederum in den Ausstellungshallen am Kaiserdamm etwa 16 000 Menschen zusammen, in denen Niemöller, Präses [vermutl. Karl] Koch, [Thomas] Breit und Kurtz sprachen. Obwohl Parallelversammlungen in den Stadtmissionskirchen eingerichtet waren, in denen dieselben Redner sprachen, mussten wiederum Tausende wegen Überfüllung umkehren. Es bleibt unvergesslich, dass in dem Augenblick, als Niemöller das Wort sprach: ‹Die Pforten der Hölle werden die Kirche nicht überwältigen›, Gegner dazwischenriefen: ‹Aber Adolf Hitler wird es tun!›»
Hitler hatte nach seiner Ernennung zum Reichskanzler Kirchenwahlen angeordnet, die den Deutschen Christen im ganzen Land die Mehrheit in den Synoden brachten. Die Synoden beschlossen, dass der staatliche Arierparagraph auch in der Kirche gelte, und wer jüdische Vorfahren hatte oder mit einer Jüdin verheiratet war, verlor sein Kirchenamt. Auch hatten die Deutschen Christen gefordert, dass alles, was mit dem Judentum zusammenhänge, aus der Bibel zu entfernen sei. Martin Niemöller war ihnen verhasst, weil er zusammen mit anderen den Pfarrernotbund gegründet hatte, der den Ariernachweis ablehnte und Betroffene unterstützte. Daraus entstand die Bewegung der Bekennenden Kirche, die sich auf die Bibel als einzig verpflichtende Lehre und auf das Ideengut der Reformation berief.
Lor Wyss stand im Gedränge und hörte erstmals Martin Niemöller sprechen. Was sie nach den Reden nachts beim Funkturm tat, ist ungeklärt. Einmal warf sie in der Nacht für die Bekennende Kirche Nachrichten in Briefkästen und hätte, wäre sie dabei aufgegriffen worden, Beschimpfungen, Schläge und Fußtritte riskiert, je nach Lust des Uniformierten. Sie setzte ihr Leben nicht aufs Spiel, die Bekennende Kirche war nicht verboten wie die Sozialdemokratische Partei und die Kommunistische Partei. Aber die Versammlung in den Ausstellungshallen war die letzte von der Regierung erlaubte. Danach konnte die widerständische Bewegung nur noch in Kirchen geschlossene Zusammenkünfte abhalten.
In den ersten Wochen besuchte Lor Wyss in Berlin häufig die Familie des Studienrates Blankenburg. «Lebhafte Familie», notierte Hanni Zietzschmann, und ihr Bruder vermerkte, dass die Familie über eine «Hausorgel» verfüge. Diese Bekanntschaft war vielleicht Zufall, das bildungsbürgerliche protestantische Milieu hingegen war Lor aus Biel vertraut. Die Familie Blankenburg vertrat die Haltung der Bekennenden Kirche und bot ihr Erklärungen zu den Vorkommnissen. Die Bekennende Kirche kämpfte gegen die staatliche Einmischung und für kirchliche Selbstbestimmung. Sie leistete keinen politischen Widerstand gegen den nationalsozialistischen Staat, noch bezog sie Stellung für die Juden. Ihr Kämpfen galt allein der eigenen Sache. Den Menschen bot die Bekennende Kirche einen Ort, an dem eine Botschaft verkündet wurde, die nicht der offiziellen entsprach. Es war ein Ort der individuellen Verweigerung, des persönlichen Protests. In den Ausstellungshallen erlebte Lor Wyss die Kraft einer Menschenmasse, beim nächtlichen Verteilen von Nachrichten machte sie die Erfahrung der eigenen Handlungsfähigkeit.
An der Universität suchte sie sich Nischen und besuchte die Pädagogikvorlesungen der altgedienten Professoren Eduard Spranger und Nicolai Hartmann, beide waren Konservative, aber keine Nationalsozialisten. Im Gutachten zur Aufnahme in den NSD-Dozentenbund steht über Nicolai Harmann: «Dem Nationalsozialismus gegenüber hat er sich zwar frei gehalten von der Überheblichkeit, der die Bewegung vor 1933 vielfach begegnete, aber er ist auch von sich aus nicht zum Nationalsozialismus gekommen.» Begeistert hörte sie die öffentliche Vorlesung «Glaube und Frömmigkeit Friedrich Hölderlins» von Romano Guardini, der als Gastprofessor für Katholische Weltanschauung eine Sonderstellung an der Universität hatte.
Kein Interesse hatte sie für die Vorlesungen Emil Dovifats, der an der Universität das neue Fach Zeitungswissenschaft und Allgemeine Publizistik lehrte und seinen Studenten eine praxisbezogene Einführung in den Journalismus bot.
Am Abend, als Lor Wyss auf dem Messegelände unter den Aufbegehrenden stand, saß Hanni Zietzschmann im Theater und sah das Drama «Spielereien einer Kaiserin» von Max Dauthendey, der im nationalsozialistischen Kulturbetrieb wegen seiner Themen zunehmend an den Rand gedrängt wurde. Die «Sekretärin von Frau Ney», wie sie sich selbst nannte, arbeitete auf Abruf und zu jeder Tages- und Nachtzeit, wenn Elly Ney gerade zwischen zwei Konzertreisen in Berlin weilte oder wenn sie jemanden brauchte, der an einem Konzert die Notenblätter wendete.
«8.00 Uhr auf. Zur Ney. Helfen. Einräumen. Sortieren. ½ 12 zu Baronin Arnim. Ney übt op. 111!!! (2. Satz) Ich ordne Korrespondenz – puh.
½ 1 geht sie fort.
Ich heim.
Schlimmes Halsweh. [...]
Zurück ins Hotel Victoria. Sie ½ 5 zurück. Arbeit – Schufterei bis Abends.»
Und am nächsten Tag:
«Nicht geschlafen: Halsweh. Schlimm – Fieber.
½ 9 bei der Ney.
Helfen. Diktieren an Chefredakteur des Dresdner Anzeigers wegen mieser distanzloser Kritik.
Sie ½ 11 ab nach Wien.
Geld –
Hotel. Frierend.
Taxi. Für Tippeuse.»
Sie vertrat die Interessen einer ambitionierten Pianistin, die sich sehnlich wünschte, für den Führer spielen zu dürfen, verhandelte mit Walter Stang, einem Abteilungsleiter mit Einfluss im Amt des «Beauftragten des Führers für die gesamte geistige und weltanschauliche Erziehung der NSDAP», besprach sich mit Friedrich W. Herzog, dem Leiter der Musikabteilung der Nationalsozialistischen Kulturgemeinde, telefonierte mit Funk und Presse.