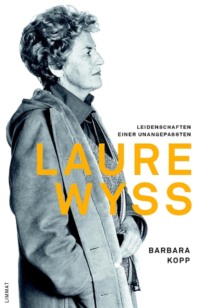Kitabı oku: «Laure Wyss», sayfa 3
Hanni Zietzschmanns Kulturgenuss war bürgerlich, für Modernes und Avantgardistisches interessierte sie sich weniger. Aber sie begleitete einen kunstverständigen Verehrer zu Ausstellungen von Käthe Kollwitz oder Otto Dix, deren Werke wenige Jahre später als «Entartete Kunst» galten. Sie saß auch mit Lor in der Singakademie unter aufgebrachten Studenten und hörte die Musik des avantgardistischen Komponisten Paul Hindemith. Nach der Aufführung klatschten und stampften die Studenten aus Protest. Soeben war Hindemith an der Hochschule für Musik zum unerwünschten Professor erklärt worden, und Propagandaminister Joseph Goebbels hatte ihn öffentlich als «Scharlatan» und «atonalen Geräuschmacher» verleumdet. Für Hanni war das Gehörte nicht «herrlich herrlich herrlich» wie die Konzerte von Elly Ney, doch sie schrieb: «Hindemith gut! Ovationen.»
Bewegte Hanni Zietzschmann die Hetzjagd auf jüdische Kommilitonen und Professoren, oder nahm sie die Vorfälle an der Universität ungerührt hin, schaute weg? Brachte ihr Wille, im Leben von Elly Ney eine Rolle zu spielen, ihr Unrechtsbewusstsein zum Schweigen? Mit der Geigenlehrerin Agnes Ritter sprach sie über Paul Hindemith und über Wilhelm Furtwängler, der sein Amt als Dirigent der Berliner Philharmoniker aus Protest wegen Hindemith vorübergehend niederlegte. Danach notierte sie: «Traurig am Abend.»
In ihren Tagesnotizen fühlte sie mit Elly Ney, demonstrierte Arbeitseifer. Konzerte von Pianisten wie Frederic Lamond oder Walter Gieseking maß sie stets an den Interpretationen ihres Idols, und niemand konnte nach ihrem Verständnis ebenso großartig spielen. Zur nationalsozialistischen Kulturpolitik äußerte sie sich in ihren Einträgen weder begeistert noch ablehnend. Sie verriet auch keinen Stolz, dass sie nun mit Regierungsvertretern verhandelte. Stolz war sie aber auf ihre Nation, als die Saarländer am 13. Januar 1935 für die Eingliederung ins Deutsche Reich stimmten. Mit drei Ausrufezeichen kommentierte sie das Abstimmungsresultat. Einmal erlaubte sie sich eine negative Bemerkung. «Unangenehme Bekanntschaft», notierte sie über den Musikabteilungsleiter der Nationalsozialistischen Kulturgemeinde Friedrich W. Herzog.
Am Ende eines Arbeitstages bei Elly Ney notierte sie ab und zu: «müde», «todmüde». Dann: «Schöner Sonntag mit der Lor. Endlich wieder einmal. Gemütlich essen zu Haus.»
Lor begleitete ihre Freundin nach der Abstimmung im Saarland zum Konzert von Elly Ney in Dresden. An diesem Abend wurde ihr möglicherweise erstmals bewusst, in welchem Milieu sich Hanni bewegte. Elly Ney wallte in Abendrobe durch den Saal, setzte sich einer Hohepriesterin gleich an den Flügel und stimmte zur «Heimkehr der Saar» das Horst-Wessel-Lied an. Ein Schmettern und Brummen aus allen Stuhlreihen. Danach, als wieder still war, spielte sie Beethoven.
Drei Wochen nach diesem Konzert notierte Hanni in ihrer Taschenagenda:
«Lor ist lieb. Vieles Unausgesprochene ist nicht mehr trennend.»
Hanni benannte ihre Erleichterung, dass sich Lor, nachdem sie ihr eine Zeitlang nicht «lieb» erschienen war, nun wieder umgänglich zeigte. Das Ungesagte war nicht aus der Welt geschafft. Nur belastete das Unstimmige Hanni nicht mehr, seit sich Lor nicht länger ablehnend benahm und das Unvereinbare überspielte. War Elly Ney das Trennende, und Lor trug Hanni nach, dass sie sich mit einer Nationalsozialistin eingelassen hatte? Grollte sie vielleicht, weil sie sich in Berlin von ihrer Freundin allein gelassen fühlte? Rieben sie sich aneinander, seit sie zusammenwohnten?
SOLO FÜR CELLO
In Berlin lernte Lor Cello spielen. Sie nahm Privatstunden und übte, den Bogen über die Saiten zu führen. Abstrich, Aufstrich, bis es nicht mehr kratzte. Abstrich: C–G–d–a. Aufstrich: a–d–G–C. Merke: Cäsar geht durch Athen. Und: Ach du großes Cello. Ab und auf, auf und ab, bis die Saiten sangen.
«Du schreibst an mich 2 innig lb. Briefe.»
«Mittags ein ganz herrlich-lieber Brief von Dir da, Du gute lb. Frau!»
«Mittags ist ein kalter fürchterlicher Brief von Dir da.»
In Zürich notierte er den Erhalt ihrer Briefe und bewies sich ihre Treue oder bestätigte sich seine Angst, sie könnte einem anderen schöne Augen machen.
«Und dass Du nicht schreibst, regt mich sehr auf. Ich schreibe einen hässlichen Brief an Dich. Und zerreiße ihn.»
Sie nahm Stunden beim besten Cellisten von Berlin. Ernst Silberstein spielte im Klingler-Quartett, das weltberühmt war für Deutung und Klang. Beethoven trug es mit moderner Sachlichkeit und verhaltener Leidenschaft vor. Sie hatte noch nie ein Instrument gespielt, überhaupt wenig Interesse am Musizieren gezeigt. In Leubringen stand in der Stube ein Klavier, die Mutter spielte Chopin und hatte es recht weit gebracht.
«Telefon Berlin. Wollen wir heiraten? Im Frühling. Meitschi, was Du da sagst, ist so ungeheuerlich, dass ich es fast nicht glauben kann.»
Ein Taumel am ersten Advent. Unverhofft gab sie ihm ihr Jawort, auf das er gedrängt hatte und nicht bekam. Im Ungewissen musste er sie ziehen lassen. Drei Monate waren vergangen seit ihrer Abreise.
Sie nahm Unterricht aus Verliebtheit und nahm Stunden aus Protest. Wer unter den Studenten wagte bei einem Juden Musikstunden zu nehmen? Ernst Silberstein, der Solist, war an der Berliner Oper entlassen worden. Karl Klingler hielt zu seinem Cellisten, auch wenn die Reichsmusikkammer dem Quartett mit Auftrittsverbot drohte.
In Zürich jubelte Ernst Zietzschmann, die Saar wurde deutsch und das Reich war in Europa wieder eine Macht.
«Dies ist der größte herrlichste Festtag für das deutsche Vaterland. Ich bin den ganzen Tag in großer Freude.»
Er hatte ein Vaterland, und er hoffte auf die Schweizer Staatsbürgerschaft und war zerknirscht, als ein Freund seinen Jubel nicht verstand.
Als in Berlin an der Friedrich-Wilhelms-Universität das Semester zu Ende war, kehrte Lor Wyss mit ihrem «Passeport de la Confédération Suisse» und dem Cello zurück, Hanni Zietzschmann reiste mit ihrer Klingenthaler Geige und zerschlagenen Hoffnungen heim. Sie notierte einen Satz ohne Trost:
«Ich habe Schuld –»
Elly Ney hatte sich vor Semesterschluss von ihrer Helferin getrennt. Karl Klingler löste sein Quartett auf, um den Cellisten nicht zu entlassen. Die Musikhochschule entzog ihm seine Professur, Ernst Silberstein emigrierte nach Amerika.
Abstrich, Aufstrich, ab und auf bis die Bogenwechsel geschmeidig gingen. In der Familie Zietzschmann spielte der Sohn Klavier, die Tochter Geige. Zum Trio fehlte das Cello. Sie nahm Unterricht aus Verliebtheit, aber was trennte, das sprach sie nicht aus.
Er war im besten Heiratsalter von 28 Jahren und seit kurzem Mitarbeiter an der Eidgenössischen Technischen Hochschule. Vat und Mutt sahen ihm die aufgelöste Verlobung in Hannover nach und stimmten seinen Plänen zu.
«Vat erfährt von Lor. Er ist ganz wunderbar lieb zu mir und sagt: ‹Ja.›»
«Ich sage der Mutt, dass ich die Lor heiraten will. Oh Du liebe Mutt bist einverstanden. Weißt Du, dass das unendlich viel bedeutet, mein Mutting?»
Die Zukünftige war jung, 22 Jahre, und hatte auch einem anderen Briefe geschrieben. Dieser andere notierte in sein Tagebuch, bevor sie nach Berlin ging:
«Einige Male in der letzten Zeit war mir erlaubt worden, in den Fluss zu steigen. Beschäftigung mit L.W. und ein anfängerisches träumerisches Briefe-Wechseln (gestern schrieb ich vier Maschinenseiten an sie).»
Armin Kesser war ein Jahr älter als Ernst Zietzschmann, wie er ein Deutscher und aufgewachsen in der Schweiz. Als junger Mann zog er nach Berlin, stieg zum beachteten Kritiker und Essayisten auf, brillant, auf der Höhe der Zeit, umworben von Bert Brecht, Alfred Döblin, Klaus Mann und Bernard von Brentano, bis Hitler Reichskanzler wurde. In Zürich war er Emigrant ohne einen Boden unter den Füßen, der für ihn fruchtbar gewesen wäre. An der Universität suchte er ein intellektuelles Milieu, vielleicht auch eine Frau, und begegnete Lor.
Aus Berlin erhielt er von ihr einen Brief, den er vernichtete wie alle ihre anderen. Ins Tagebuch notierte er:
«Brief von L.W., die erwartete schwarze Mitteilung.»
Bald darauf kam sie überraschend auf Besuch, sie war auf der Durchreise.
«Ich habe mich gefreut, aber zugleich war ich über das Formlose irritiert. Der Briefwechsel schien mir viel wirklicher u. eigentlicher als ihre Gegenwart. Enttäuschung? Ich kann es nicht sagen, denn L. schien mir zerstreut, durchgeschüttelt, unklar.»
Sie war jung, und er gab ihr einen Rat, den sie nicht hören wollte und den er ihr vielleicht nicht ganz uneigennützig gab. «
Sie möchte heiraten, und ich habe den Verdacht, dass es ein Loskauf von zu Hause ist. Ich empfahl ihr, eine Zeitlang selbständig zu leben. Ich war nicht ganz ohne Absichten gegen sie, aber es schien ihr zu gefallen.»
Aus der Warte von Vater Wyss war sie kein Kind mehr, aber immer noch eine Tochter, die es, mangels Einsicht und Reife, zu lenken galt. Er verlangte von ihr zuerst den Studienabschluss, das Patent als Fachlehrer auf der Sekundarstufe in den Fächern Französisch und Deutsch, bevor das Heiraten zu wollen sei.
KOCHEN I
Mama und Mutt nahmen die Ausbildung an die Hand. Zum einen galt es, die Grundlagen für das Gelingen einer Ehe zu legen. Zum andern musste der familiäre Anspruch und die heimatliche Eigenart gesichert werden bei einer Verbindung, die über Landesgrenzen hinweggehen sollte.
«Koch Rezepte» stand auf dem Leinenumschlag des Buches, das lauter weiße Seiten besaß und ein Register, das von «Suppen» über «Pudding» bis zu «Getränke» und «Verschiedenes» reichte. Auf der Schmutztitelseite hatte die Mutter mit Tinte ihren Wahlspruch hingeschrieben, den die Tochter sehen konnte, wenn sie ihr Buch aufschlug.
«‹Sei froh, wenn Du kochen kannst für jemand›, sagt die Mutter.»
Der Satz war hintergründig. Er mag als generelle Ermunterung gemeint gewesen sein, aber auch eine heimliche Spitze enthalten haben gegen die Tochter, die der Vater gefördert hatte, die nicht nur das Gymnasium, sondern auch die Universität besuchen durfte, viel mehr als einst sie, die Mutter. Diese Tochter war ihr entglitten, doch nun, und darin lag ein mütterlicher Triumph, wollte sie ihrem Beispiel folgen.
Mama unterwies die Heiratswillige im Einmachen und im Sterilisieren. Nicht zu viel Wasser! Und Achtung: kleine Flamme! Sie führte die Tochter in die Zubereitung des Sauren Bratens ein, ließ sie Schweinefleisch klopfen und mit Rüben, Zwiebeln, Lorbeer und Gewürznelken in Essig und Wasser einlegen. 4 Tage stehen lassen (Winter 8 Tage). Und nicht vergessen: immer wenden. Dasselbe Prozedere mit Rindfleisch für den Sauren Mocken nach Berner Art, dann folgten Kotelet, Schnitzel und Kalbsvoressen. Die Mutter hütete die Rezepte ihrer Desserts, für die sie berühmt war, Orangenspeise, Zitronencrème Sabayon und für den heimischen Stolz die Ungekochte Schokoladen Crème, für die nur eine «Lindt» verwendet werden durfte. Denn unter den Schweizer Schokoladen besaß ihrer Meinung nach einzig «Chocolat Lindt» die nötige Sämigkeit, und dass sie aus Bern kam, erhöhte ihren Wert.
Hilde, die Schwester, unterstützte das Bestreben der Mutter und wusste, wie Truites au bleu, Croûtes aux champignons und Diplomate zuzubereiten waren und notierte die Anleitungen in Lorlis Buch.
Mutt brachte ihrer zukünftigen Schwiegertochter die Herstellung von Kochbutter bei und die Zubereitung von Schmalz als Brotaufstrich, für den reines Schweinefett mit 1 Zwiebel, 1 Lorbeerblatt, Pfefferkörnern u. 1 geschälten Apfel kurz gekocht wurde. Weiter führte sie die Schweizerin zu den Speisen hin, mit denen ihr Sohn groß geworden war. Kartoffelbällchen, Königsberger Klopse und Kaiserschmarren. Bei den Klößen, den Vogtländischen, fügte die Heiratswillige hinzu: nur für Sachsen! u. Thüringen! Die deutschen Länder waren ihr so wenig vertraut wie die Speise, sie schrieb: Klose.
Die Autorität von Mama und Mutt galt nicht uneingeschränkt. Mit der Ernsthaftigkeit, mit der sie die Anleitungen der Mütter aufschrieb, trug sie auch Rezepte von Freundinnen ein und fügte in Klammern ihre Namen hinzu. Die Rezepte taugten nicht für die Ernährung einer Familie, Zuckermandeln und Salzmandeln, Tomatenküchlein, Griesköpfli und Schokoladentorte waren die Speisen, die sich die Studentinnen auftischten, wenn sie einander einluden.
Die Gerichte ihres Zukünftigen notierte sie ebenfalls, billige und nahrhafte Junggesellenverpflegung: Risotto mit Emmentaler oder Käshaber, ein Grieskuchen aus Milch, Eiern und Käse, serviert mit Salat.
Im Rezeptbuch stand auf der Schmutztitelseite über dem Wahlspruch der Mutter mit Bleistift hingeschrieben ein weiterer Satz:
«‹Kü-Ko›, sagt der Vater.»
Aus Sicht des Vaters könnte die Mutter ein «Kü-Ko» gewesen sein, ein Küchen-Kommandant, der sein Regiment aus Dienstmädchen und Töchtern entschlossen anführte, weil es außer Haus für Frauen nichts zu kommandieren gab. Wer der wahre Regent im Hause sein muss, das sagte der Vater seiner studierten Tochter auf dem Standesamt und beim Bankett. Dem deutschen Schwiegervater Otto Zietzschmann fielen die Ermahnungen auf, und er schrieb in sein Tagebuch zum 6. Februar 1937:
«[...] Kurz nach 6h sind wir alle ‹im Staat› und gehen hinunter, wo sich alles im Empfangsraum versammelt und wir dann den Erwartungsvollen vorgestellt werden. Es ist eine sehr nette Gesellschaft echter Bärner, mit denen man sehr bald nahe kommt! Zum Schlusse erscheint das jg. Paar: Ernscht in seiner ruhigen Freundlichkeit, von allen Fam.-Mitgliedern frdl. empfangen. Und Lor in ihrer Jugendfrische strahlend im hellen duftigen Blau. Mit viel Herzlichkeit und ohne Versteifung plaudert man zusammen. Dann geht’s zum reizend gedeckten Tische. [...]
Herr Wyss leitete mit einer herzlich gehaltenen Rede an das Brautpaar, vor allem aber an die Gäste, ein, indem er noch einmal auf die Stellen aus den 3 Paragraphen der Schw. Bundesversammlung* hinwies: das Haupt der Familie sei der Mann, im Hause herrsche die Frau.»
Vater Wyss schickte seine Tochter mit schweizerischen Grundsätzen nach Schweden, wo das Paar die Ehe beginnen wollte. Die Vorliebe der jungen Hausfrau galt, gemessen an der Anzahl beschriebener Seiten im Rezeptbuch, dem süßen Beiwerk, nicht der alltäglichen Kost.
STOCKHOLMER WEGE
Die Sprache, die sie lernte, war ihr so unvertraut wie die Rolle, in die sie mit dem festen Willen schlüpfte, es richtig zu machen. «Hustru» lautete auf Schwedisch die Anrede, die sie für sich in Anspruch nehmen konnte, sie war eine verheiratete Frau, född Wyss, eine geborene Wyss, boende på Lappkärrsvägen 44, wohnhaft an einer Straße in Stockholm, deren Namen ins Deutsche übertragen so viel bedeutete wie Sumpfweg oder feiner, als Moorfleckenweg übersetzt werden konnte. Für die Formulare der «Zentralen Sozialbehörde» lernte sie auf die Frage «Syftet med vistelsen» zu antworten: Vistelse hos maken, Grund meines Aufenthalts ist mein Mann.
Nach den ersten gemeinsamen Wochen in Stockholm schrieben Ernst und Lor Zietzschmann dem angesehenen Zürcher Theologen Emil Brunner einen Brief. Er hatte sie in der Kirche von Greifensee getraut, ihnen zuvor das Pflichtbewusstsein geschürt und Ehrfurcht vor der Aufgabe eingepflanzt.
«6.4.1937
Lieber Herr Professor!
Zwei Monate sind ins Land gegangen, seitdem ich mein Bündel schnürte, um vom hohen Norden gen Süden zu reisen und mir meine Frau zu holen. Es war eine richtige große und beschwerliche Reise, vierzig Stunden lang, auf der ich Musse und Ruhe hatte, mich von Herzen zu freuen und dankbar zu sein, dass ich mir diese Frau aus dem hoch über dem Schweizer Land liegenden Leubringen erwählen durfte und erkämpft hatte. Es war ein rechter Kampf gewesen mit dem höchsten Einsatz, dem eines vollwertigen, höchst liebens-würdigen Menschen.
Sie, lieber Herr Professor, gaben uns am 9. Februar das Recht vor Gott und der Welt, nun zusammen zu sein und einander zu gehören. [...] Hoch-Zeit, genommen als absolut einmaliger Begriff, wurde es erst draußen in Greifensee. Erst in dem Augenblick, als Sie dort standen und zu uns beiden Ihre freundschaftlich-persönlichen Worte über Sinn + Bedeutung dessen, was wir da miteinander beschlossen hatten, sagten. [...]
Wir merkten als glücklichsten Besitz, dass außer uns Dreien ein Viertes im Bunde war, dessen Beauftragter Sie waren und dessen Wort und Willen Sie uns eindeutig und kompromisslos mitgaben. Dass es kompromisslos sei, musste ich wieder hören. Es war gut so, dies klar und deutlich zu vernehmen. [...]
Wir sind zwei Monate beieinander. Wir haben gemeinsam die äußeren Bedingungen geschaffen, in Wohnung und Arbeitsplan. Die Arbeit beansprucht etwas zu viel. Viele Sonntage. Viele Nächte. Das darf nicht so bleiben. Es ist Unordnung, Widersinn. Es kann nichts Gutes aus diesem Gehetze entstehen.»
Sie schrieb:
Lieber Herr Professor,
es plagt mich sehr, dass Sie so lange keine Nachricht von uns bekommen haben. Sicher warfen Sie uns – und mit Recht – Undank vor, und es ist doch genau das Gegenteil der Fall. Es vergeht kein Tag, so darf ich wohl sagen, an dem ich nicht durch irgend etwas an das erinnert werde, was Sie uns am 9. Februar sagten. Wir wollten Ihnen schon lange lange danken, aber Ernst sitzt tatsächlich fast Tag und Nacht am Zeichentisch, und für private Angelegenheiten bleibt überhaupt keine Zeit. Und ich wollte nicht allein schreiben. [...] Sie haben uns klar und deutlich gesagt, was Ehe ist und wodurch allein sie möglich ist. Sie sagten auch, Ehe sei eine Stiftung Gottes. Und so ist man also vom Augenblick an, da der Bund geschlossen ist, beteiligt an einer Institution Gottes. Das weiß ich nun ganz fest seit dem Tag in Greifensee, und es hat Wesentliches bei mir geändert. Die frohe Gewissheit dieser Tatsache hat mir den größten Teil einer frühern Unsicherheit genommen (am einzelnen Individuum liegt ja nicht so viel, dachte ich). Ich gehe seitdem mit der größten Fröhlichkeit u. viel Mut ans Werk, trotzdem u. gerade weil ich die Pflichten und strengen Forderungen kenne.
Emil Brunner wird der Braut und dem Bräutigam gesagt haben, dass sich die Ehe einzig auf ein Bündnis zweier Menschen mit Gott dauerhaft gründen lasse. Dass erst das Gelöbnis der Treue vor Gott und im Bund mit Gott der Ehe den notwendigen Halt gebe. Er wird ihnen weiter gesagt haben, dass die Ehe aus Liebe entstehe und das Geschlechtliche nicht bloß als Mittel zur Zeugung diene, sondern auch ein Ausdruck der Zuneigung sei. Dass jedoch eine Ehe, die nur auf Liebesgefühle und auf das Geschlechtliche baue, rettungslos verloren sei. Dort, wo der Glaube eines jeden echt und lebendig sei, seien Eheprobleme zu überwinden, während dort, wo der rechte Glaube fehle, die Ehen häufig an den Schwierigkeiten zerbrächen. So ungefähr könnte er ihnen die Tragweite der Ehe erläutert haben, wie er die Ehegemeinschaft 1932 in seiner wegweisenden Ethik «Das Gebot und die Ordnungen» dargelegt hatte.
Ernst Zietzschmann wäre kaum aus eigenem Antrieb nach Schweden gezogen, nachdem er endlich eingebürgert worden war. Doch in der Schweiz gab es wenig Arbeit und zu viele Architekten. Die Auftragslage war derart schlecht, dass ihm die Stelle an der Eidgenössischen Technischen Hochschule gekündigt wurde.
Er und Lor verlobten sich, bevor er mit einer Empfehlung in der Tasche nach Stockholm fuhr und wagte, was die Abenteuerlustigen unter den arbeitslosen Jungarchitekten aus der Schweiz und anderen Ländern auch versuchten. Wie Wanderarbeiter zogen sie von einem schwedischen Architekturbüro zum nächsten, stellten sich überall dort vor, wo gerade ein Großprojekt geplant wurde und sie hoffen konnten, dass der Chef sie mit offenen Armen empfing. Erhielten sie eine Anstellung, zeichneten, radierten sie ohne Unterlass, änderten, passten an und bangten alle sechs Monate um die Verlängerung der Arbeitserlaubnis.
Ernst Zietzschmann verdingte sich bei Sven Ivar Lind, der den schwedischen Pavillon für die bevorstehende Weltausstellung 1937 in Paris baute und am Stadtrand von Stockholm das nationale Fußballstadion «Råsunda» plante. In Zürich schloss Lor Wyss ihr Studium ab. Ihm bereiteten die zukünftigen Ausgaben nach der Heirat Kummer.
«Für die Fertigstellung der Zeichnungen + die 3. Ausschreibung (Råsunda) sind 4 Tage Nachtdienst nötig. Am Ende gibt es 2 Tage bis ’n [nach] 3h. Lind ist unermüdlich + schließt mit einem ganz durchgearbeiteten Nachtpensum. [...] Meine finanzielle Lage ist nur bei vieler Nachtarbeit einigermaßen gut. Das muss anders werden, wenn ich heiraten will. Die Einrichtung + Anschaffung vieler Dinge wird das Ersparte auffressen.»
Ruhelos wie vor der Heirat saß er nach der Heirat am Reißbrett, tagsüber im Architekturbüro, abends und an den Wochenenden zu Hause, führte aus, setzte um, was sein Arbeitgeber von ihm wollte.
Emil Brunner las die Briefe, die er aus Schweden erhielt, genau, und er unterstrich die Stellen, die ihm wichtig erschienen, er las mit dem Blick des Seelsorgers, der die Vorgeschichte dieser Eheschließung kannte und der darin geübt war, kleinste Anzeichen einer Unstimmigkeit zu diagnostizieren.
Im Brief von Ernst unterstrich er die Worte «dankbar zu sein» und «diese Frau». Im Brief von Lor markierte er Tag und Nacht am Zeichentisch. Die Bemerkung der jungen Ehefrau missfiel ihm.
Damit eine Ehe gedeihen könne, und dies wird er dem Brautpaar deutlich gesagt haben, sei ein «wirkliches Zusammenleben» von Mann und Frau unabdingbar. In seiner Ethik warnte er vor schädlichen Folgen, wenn neben der Arbeit gerade noch ein halbes Wochenende für die Lebensgemeinschaft übrig bleibe. Er urteilte als gut besoldeter Theologe, der in gesicherten Verhältnissen lehrte und schrieb und das Privileg freier Abendstunden und eines Wochenendes einfordern konnte, wohl wissend, dass Arbeitslosigkeit, Hungerlöhne und Schichtarbeit vielen Erwerbstätigen keine freie Zeit ließen.
Der Braut wird er gesagt haben, dass nach der göttlichen Ordnung ihr natürlicher Wirkungsbereich zunächst die Familie sei. Aber er gab ihr womöglich noch etwas anderes mit auf den Weg. Als «ein Zeichen unglaublicher Weltfremdheit» brandmarkte er in seiner Ethik die weitverbreitete Ansicht, die Frau gehöre ins Haus. Der Frau von heute könne nicht verboten werden, so schrieb er, nach einer Kompensation außer Haus zu suchen, wenn die Hausarbeit ein Frauenleben nicht mehr ausfülle. Der Maßstab waren für ihn wiederum bürgerliche Verhältnisse, in denen der Ehemann genug verdiente für den Lebensunterhalt von Frau und Kinder. Doch er rechtfertigte die Berufstätigkeit, die zur individuellen Entfaltung einer Frau beitrug, die für den Unterhalt der Familie aber nicht notwendig war. Dem Bräutigam wird er ins Gewissen geredet haben, in dieser Frage den Willen seiner Frau zu respektieren.
Emil Brunner strebte nach einer im Alltag anwendbaren theologischen Ethik und berücksichtigte in seinen Überlegungen auch wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen, setzte sich mit Psychologie und Naturwissenschaften auseinander. Mit mancher seiner Ansichten zur Ehe ging er weit über das hinaus, was theologisch anerkannt war. Die «moderne Freiheitsbewegung der Frau» beurteilte er als «notwendig und segensvoll». Er trat für die Einführung des Frauenstimmrechts und Frauenwahlrechts ein und befürwortete die Empfängnisverhütung. Er wagte in seiner Ethik «Das Gebot und die Ordnungen» die Feststellung:
«Die Frau von heute will nicht ein Kind bekommen, weil und wann es sich so gibt, sondern dann, wenn und weil sie dazu bereit ist.»
Doch bei aller Anerkennung der Emanzipation stieß Emil Brunner deswegen die althergebrachte hierarchische Ordnung der Geschlechter nicht um.
Er trat für die «Selbständigkeit und persönliche Gleichberechtigung» der Frau mit dem Mann ein und hielt am theologischen Lehrsatz fest, dass dem Manne das Führungsrecht in der Familie zufalle. In seiner Ethik verteidigte er idealistisch die Haltung, dass der Mann in einer ebenbürtigen Ehe die Eigenständigkeit der Frau weder missachten wolle noch könne. Die Frau nehme seine gerechte Führung gerne hin und wisse sich mit Sachverstand durchzusetzen, wenn er ungerecht handle.
Emil Brunner bezog Stellung gegen die politischen Entwicklungen in Italien und Deutschland und stand der Bekennenden Kirche nahe. Seine Ethik wurde im Deutschen Reich verboten, und der Verlag in Tübingen musste die unverkauften Exemplare der zweiten Auflage 1938 einstampfen.
In Zürich lehrte er an der Universität systematische und praktische Theologie und lud, was für einen Professor außergewöhnlich war, die Studenten zu «offenen Abenden» zu sich nach Hause ein, er hörte zu, beantwortete Fragen, alle diskutierten, manchmal wurde Karten gespielt, manchmal gesungen und musiziert. An der Universität wirkte er als Seelsorger, er hielt «Morgenpredigten für Studenten», gab Abende für Pfadfinder und Bibelstunden für Berufstätige. Der Weg zu Glauben und Bekehrung führte für ihn nicht über die Predigt, sondern über persönliche Gespräche und Unterstützung bei Lebensproblemen. Ernst Zietzschmann hatte sich im Auf und Ab seiner Gefühle an Emil Brunner gewandt, sein provisorisches Leben, die widersprüchlichen Signale aus Berlin, nichts, was ihm eine Perspektive gegeben hätte. Er hatte um eine Sprechstunde gebeten.
«Ich komme zu Ihnen, verehrter Professor, in der Not, im Willen, endlich einmal Halt zu bekommen.»
Nach dem Gespräch hatte er in seinen Taschenkalender notiert:
«Er sagt mir ganz schlichte große Dinge um Gott und das Leben in ihm. ‹Sie sind ein diffuser Aesthet.› In großem Glück heimlaufen.»
Emil Brunner bekannte sich zur Oxfordgruppenbewegung des Amerikaners und lutherischen Theologen Frank Buchman, der predigend und bekehrend von Land zu Land zog. Seine Bewegung besaß in den Dreißigerjahren in der Schweiz, in den Niederlanden und in Skandinavien große Anziehungskraft. Die reformierte Kirche war Emil Brunner zu lebensfern, in der Oxfordbewegung sah er dagegen sein Ideal einer regen Laiengemeinschaft verwirklicht. In einer Notiz hielt er fest:
«Eines der Hauptübel unserer Kirche ist dies, dass sie ihren Gliedern nichts zu tun gibt, dass sie nichts von ihnen verlangt. Die Oxford-Gruppe verlangt von ihren Leuten, dass sie sich hinfort als aktive Christuskämpfer wissen. Und betätigen.»
Missionarisch erstellte er Namenslisten nach Stadtquartier, Geschlecht und Verwendbarkeit des Einzelnen für die Bewegung. Er unterschied zwischen «Helfern», «Bereiten» und Personen, die er zum «offenen Abend» oder zur gemeinsamen Bibellektüre einladen wollte.
Den Namen Ernst Zietzschmann setzte er bald auf die Liste «Akademiker, Studenten, Junge Männer, die zum Helfen in Gruppen eingeladen werden könnten». Jedem «Helfer» wies er einen Neuling zu, den er betreuen und mit dem er über gemeinsame Interessen, über Alltagsprobleme und über den Glauben reden sollte.
Den Namen Hanni Zietzschmann trug Emil Brunner in der Liste der «Studentengruppe – Anf. November 1935» als «Aktive» ein. Nach dem Aufenthalt in Berlin hatte sie in ihre Taschenagenda notiert:
«Überall Schwierigkeiten, in mir selbst, in meiner Umgebung. Nirgends ein fester Punkt. Keine Ruhe.»
Der Name Lor Wyss stand auf keiner seiner Listen. Sie hatte zusammen mit Hanni an einem Einführungswochenende auf dem Bürgenstock teilgenommen, aber zu einer «Aktiven» in einer Studentengruppe wurde sie nicht. Vielleicht suchte sie in der Zürcher Gruppe einen Bezug zum Erlebnis in Berlin, als sie im Menschengedränge Martin Niemöller zugehört hatte. Auch verband sie der Besuch der Vorlesungen und Predigten von Emil Brunner mit ihrer Freundin und ihrem Geliebten.
Ernst Zietzschmann sah in Emil Brunner einen «väterlichen Freund». Sie unterschrieb ein halbes Jahr vor der Heirat einen Brief im Namen der beiden Kinder: Lor. Beide fühlten sich in der Pflicht, die Erwartungen und Anforderungen zu erfüllen, um sich dem verehrten Mentor würdig zu erweisen.
«[...] Sie haben in jedem Sinne Recht behalten, Herr Professor, damals in Greifensee, auch mit der ausgesprochenen Erwartung, dass wir zunächst einmal nur Zeit haben für uns. Es gilt ja vieles: Es gilt alles. Es gilt ein Leben einzurichten. Das ist schön, festlich, einmalig, schwer oft. Noch nicht allzu oft. Aber wir freuen uns aller Aufgaben. Gegenüber der Zeit und der beruflichen Entwicklung habe ich oft Mühe, Geduld zu haben. Meine Frau hat umso mehr Zutrauen + Ruhe. So ist alles gut.
Ich freue mich, an einem ganz frühen Morgen nun endlich Zeit gefunden zu haben zu diesen Zeilen, mit denen ich Ihnen nochmals danke, mit denen ich Sie bitte um Grüße an Ihre Frau Gemahlin und Ihre Söhne. Ihr Ernst Zietzschmannn»
Sie schrieb:
[...] Es ist ja erst ein kleiner Anfang, diese zwei Monate. Aber wir merkten doch schon, wo die wahre Freude und der richtige Weg zu finden sind. [...] Es ist mir auch klar geworden, wie sehr wir uns Ihnen als Seelsorger verpflichtet haben, seitdem Sie uns getraut haben. Ich werde wohl oft eine Mahnung hören, wenn ich an Sie denke, und nicht immer eine angenehme. Aber es ist doch mein größter Wunsch, dass es dabei bleibt, dass wir von Zeit zu Zeit zu Ihnen kommen dürfen.
Hier in Schweden hat das Leben mit großem Schuss angefangen. Zwar war ich bis jetzt mit Wohnungeinrichten u. Schwedisch lernen beschäftigt u. habe noch keine andere Arbeit aufgenommen. Ernsts strenge Arbeit wird bald zu Ende sein, und was wird, ist noch unsicher. Die Unsicherheit sagt mir im Grunde sehr zu, u. ich möchte nicht, dass es anders wäre. [...]
Mit herzlichen Grüßen auch an Frau Professor bin ich Ihre dankbare Lor Zietzschmann.
Die Unsicherheit des Wanderarbeiters setzte Ernst zu, mehr noch, dass er die Ideen eines anderen ausführen musste und seine Arbeit unsichtbar blieb. Er hätte gerne ein eigenes Architekturbüro eröffnet und unter seinem Namen gebaut.
«Wie sieht wohl meine Zukunft aus? Werde ich jemals in Zürich Aufgaben finden? Gibt es in der Schweiz überhaupt noch Aufgaben? War es beruflich gesehen richtig, Schweizer zu werden? Ja. Denn in Deutschland ist kein innerliches Leben meiner Art möglich. So lass dich nicht immer wieder durch die Bauaufgaben betören. [...] Gibt es wohl einmal wieder Zeiten wie [...] 1920 in Deutschland? Wohl nicht. Wir müssen anderweitig Raum + Aufgaben finden. Deutschland ist verschlossen, alle anderen Länder umso mehr.»