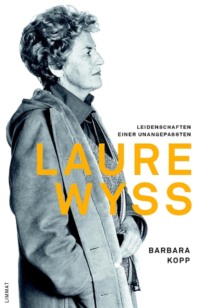Kitabı oku: «Laure Wyss», sayfa 4
Ernst Zietzschmann orientierte sich am Neuen Bauen, am sachlichen Stil, wie ihn in Deutschland Bruno Taut und Mies van der Rohe vertreten hatten, bevor die Nationalsozialisten den monumentalen neoklassizistischen Stil durchsetzten. Das Neue Bauen erreichte Schweden mit einer Verzögerung, und als Ernst Zietzschmann nach Stockholm zog, standen die ersten Verwaltungsgebäude und Wohnsiedlungen im funktionalen Baustil.
«Herrliche Wohnungen sehe ich draußen in Ekhagen [...], wo es mir außerordentlich gut gefällt. In großen Bäumen stehen sehr anständig gebaute helle dreistöckige Häuser (Lift ist bei drei Stockwerken entbehrlich). Ein See in der Nähe. [...] So werde ichs auch mal haben. Eine Frau in einer Wohnung, meine Frau. Die für mich da ist, für die ich da sein darf.»
Die Häuser, die seine architektonischen Ansprüche befriedigten, waren streng, schmucklos, besaßen Fenster in allen Größen und standen zu den Nachbarhäusern und zur Straße so, dass jede Wohnung in den langen Wintern und kurzen Sommern möglichst viel Licht erhielt. Fachleute, Neugierige und Delegationen fuhren zu Studienzwecken zu dieser Vorzeigesiedlung hinaus. «Ekhagen», Eichenforst, wie das Stadtgebiet hieß, verwandelte sich erst allmählich in Stadt, und hier ließ sich die obere Mittelschicht nieder. Der Wunsch ging in Erfüllung, Ernst Zietzschmann erhielt am Sumpf- und Moorfleckenweg «Lappkärrsvägen», eine dieser viel bewunderten Wohnungen.
Sein Traum von einer Frau in seiner Wohnung, seiner Frau, entsprach nicht dem, was er auf den Straßen und bei der Arbeit beobachtete.
«Die selbständige schwedische Frau hat einen eigenartigen Charme.»
Er führte nicht weiter aus, was ihm am Wesen der Schwedinnen merkwürdig vorkam. Ihre Eigenständigkeit musste im Widerspruch gestanden haben zu seinen inneren Bildern von einer Frau. Seine zukünftige Frau hatte für ihn bereit zu sein, während er für sie da sein konnte, wann er wollte. Ihre Hingabe verstand er als ihre Pflicht ihm gegenüber, seine Anteilnahme ihr gegenüber betrachtete er als Freiwilligkeit.
Ende April, als der Pavillon von Sven Ivar Lind auf dem Ausstellungsgelände in Paris errichtet wurde und auch die Baupläne für das Fußballstadion ausgereift waren, ging das junge Paar auf Hochzeitsreise.
«Gestern früh hat Lor bis fünf Minuten vor acht Uhr genau und gut und fröhlich eingepackt. Wir ließen ein Paar Schuhe ungeputzt stehen, um den Anschluss nachher wieder zu finden. Die Arbeit ist vom Zeichenbrett weggenommen, und Lor hat beim Plätten der Hosen das Unterlagspapier wieder völlig zerstört. Wir wollen Ferien haben.»
Mit dem Zug reisten sie nach Göteborg, wo sie den angebrochenen Tag verbrachten, bis am Abend ihr Schiff fuhr.
«Beim Aufwachen ist England in Sicht. Im Süden schiebt sich eine breite Landzunge vor. Kohlenkrähne: schwarze Dampfer zeigen den großen Hafen an. Kleine runde Segelboote. Die Spannung steigt. Wir fahren i. d. Themsemündung ein. Schiff an Schiff überholen wir. Schwarze Segel. Grün schimmert das Land durch den Nebel. Unfasslich grün.»
In London führte Lor Zietzschmann ihren Ehemann in die weitere Verwandtschaft ein. Ein Cousin der Mutter hatte sich hier als Kaufmann niedergelassen. Die Stadt wirkte auf Ernst abstoßend. Bis auf die Gemäldeausstellungen und die englischen Gärten fand er in London nichts, das seine Augen befriedigte.
«Die Oxfordstreet ist voller Automobile, daneben kein einziges Fahrzeug. Bondstreet, die vornehme Geschäftsstraße, ist mit weißen Coronationfahnen* geschmückt. Die einzige geschmackvolle Dekoration. Gesandten- + Politikerviertel. Mayfair. In der City alles leer. Und wie mit einem Schlag kommt man in Inderviertel, in eine wimmelnde stinkende widerliche Welt. Kilometerweit dehnt sich dies furchtbare Viertel aus. Inder, Christen, Juden, Kinder, Kinder, Kinder.»
Nächstes Ziel war Paris, wo er auf dem Bauplatz der Weltausstellung, die drei Wochen später eröffnet werden würde, die Wirkung des schwedischen Pavillons überprüfen wollte.
«Er [schwedischer Pavillon] wirkt ein wenig steif + gerade. Schweizer Pavillon ist fröhlich + ausstellungsmäßig. [...] Auf dem Bau zuerst niemand. Der Eindruck des Steifen verdichtet sich. Es ist sehr viel zu tun übrig. Trotzdem sind wir nicht allzu sehr im Rückstand. Engld. + Amerika haben noch Monate zu tun. Die Großstaaten sind im A. [Ausstellungsbau] fast fertig.
Die Antithese Russland – Deutschld. wirkt krass + lächerlich. Russld. stürmt mit zwei verrückt überdimensionierten Gestalten auf Dtschld los, das in einem Säulen – trostlos – Turm den Adler mit Hakenkreuz in die Höhe reckt. Die Ornamentik ist peinlich. Noch mehr, wenn man denkt, dass es sich um Ausstellungsbauten handelt. Am Schluss sehe ich Lind + werde von ihm behandelt wie ein völlig Unbekannter. Es ist eine grenzenlose Schweinerei.»
Die Aufmerksamkeit für seine Ehefrau beschränkte sich in seiner Beschreibung der Hochzeitsreise auf wenige Sätze. «Lor schwelgt. Ihre Studentenzeit ist rings hier herum», schrieb er, als sie in Paris ankamen und in der Nähe des Boulevard Saint-Michel ein Hotelzimmer bezogen.
«Lor sieht aus wie eine Pariserin.»
Und als er aufgewühlt war, weil ihn Sven Ivar Lind wie einen Wanderarbeiter behandelt hatte, notierte er:
«Lor ist geduldig + elend lieb. Ich brauche sie so sehr.»
IN GRAUEN STUNDEN I
Die Seiten im Gästebuch füllten sich mit Heiterem und Harmlosem, «tack ska du ha», vielen Dank. «Leider blieben sämtliche Geistesblitze weg» und Datum, «besten Dank für eure Küche», «tack». Darunter folgte ein Reigen aus Namen: Zucker, Freund, Meyer, Taesler, Bächtold, Schlachter und wieder Meyer, nicht identisch, Taesler, Zucker, Bächtold und Bengtsson, Klaglund, Fröhlicher, Schlachter und Niemeier. Lustige Gesellschaften hinterließen Darstellungen von Fondue-Essen und Karikaturen, die den Gastgeber zum Zampano aufbliesen mit hochgekrempelten Hemdsärmeln und erhobener Faust oder ihn zum Ernstli schrumpfen ließen, der eine Lola mit Schmollmund an sich drückte. Tack, tack. An manchen Abenden wurde musiziert, Ernst am Klavier, der eine oder andere Besucher brachte seine Geige, sein Cello oder die Gitarre mit. Die gespielten Werke trug der Gastgeber im Gästebuch ein: viel Beethoven, etwas Haydn und Mozart, immer wieder Bach, Vater und Söhne.
Ein feiner Riss zog sich durch die heile Welt im Gästebuch. Dieser Riss war in Wirklichkeit eine Kluft, die nach Nation, Herkommen und Religion trennte. Im Gästebuch ließ sich der Riss ablesen an der Art, wie jemand dankte.
«Ohne große Worte: Ihr habt uns hier alles mit Euch teilen lassen, und wir haben oft gesagt: ‹Wie hätte es nur gehen sollen ohne ...› Dieses dumme Kind wäre mir jedenfalls verzweifelt ohne Eure Rückendeckung: Und das können wir mit den Maßstäben des Gästebuchs nicht vergelten.
Ob’s Euch etwas bedeutet, wenn wir sagen: Ihr beide steht in unserem jetzt beginnenden gemeinsamen Leben ganz vorne an –
Allen unseren Dank»
Im Frühjahr 1938, als der Dankende für seinen Eintrag nach passenden Worten suchte, gab es für ihn und seine Familie nur noch ein Neubeginnen und Vorwärtsschauen. Das vergangene Leben war ein verlorenes. Noch rechtzeitig hatte er mit seiner Familie Schweden erreicht, bevor das Land Juden an der Grenze zurückwies, wenn sie keine Einladung oder keine Einreisevisa in andere Länder vorweisen konnten.
Ein anderer Gast klebte einen Zettel ein, auf dem er eine Strophe des Lieds «An die Musik» von Franz von Schober notiert hatte:
«Du holde Kunst, in wieviel grauen Stunden, Wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt, Hast Du mein Herz zu warmer Lieb’ entzunden, Hast mich in eine bessre Welt entrückt, in eine bessre Welt entrückt.»
Dazu schrieb der Gast in schönster Schnörkelschrift:
«Allem voran der Dank an die junge Hausfrau für eine Crème, so wundersam und fein wie die lieblichste Musik. Dass Sie mir Gelegenheit geben, die ‹holde Kunst› mit Ihnen auszuüben, dafür danken wir Ihnen herzlich.»
An diesem Abend saß der Dankende mit Ernst Zietzschmann am Klavier, und sie spielten vierhändig Schubert und Mozart. Wer unter den Gästen hastig Jena, Leipzig und Berlin hinter sich gelassen, wer sich von Russland über Finnland nach Schweden durchgeschlagen hatte, der hatte sich auf seinem Fluchtweg nicht mit einem Instrumentenkoffer beladen. Geige und Cello spielten die Gäste, die beruflich nach Stockholm umgezogen waren und wohlgeordnet einen kleinen Haushalt mitgebracht hatten.
Diejenigen unter den Besuchern, die nicht erfahren hatten, wie leicht eine Existenz beschnitten und zerstört werden konnte, dankten mit treuherzigen Worten. Wer an sichere und beständige Verhältnisse glaubte, der schrieb mit der Einfalt der Unversehrten ins Gästebuch.
«Alles Gute in Schweden!
Ist’s auch nicht ein Eden,
so wartet doch Euer,
in Zukunft, wenn nicht heuer,
die vielgeliebte Schweiz
Stockholm, 13.–25. August 1938
die Schwester u. Schwägerin, Hildi.»
Hilde Wyss kam gerade von Berlin, wo sie für den Schweizerischen Evangelischen Pressedienst führende Pfarrer der Bekennenden Kirche interviewt hatte. Martin Niemöller war ins Konzentrationslager Sachsenhausen deportiert worden. Hilde machte nach dem Augenschein in Berlin Ferien in Schweden.
Bei Zietzschmanns saßen im Wohnzimmer Juden und Christen, Deutsche und Schweizer, Kommunisten, Sozialdemokraten und Liberale. Die Ehepaare ohne Kinder waren häufig politische Flüchtlinge und meist so alt wie die Gastgeber. Die eine und andere Ehe zerbrach, andere gründeten Familien. Die Zuckers hatten die Sowjetunion verlassen, als die stalinistischen Verfolgungen begannen. Er hatte als Einrichtungsarchitekt in Berlin gearbeitet, sich auf Beleuchtung spezialisiert und war dem berühmten Architekten Bruno Taut als Assistent nach Moskau gefolgt. Unter den ausgewanderten Deutschen hatte er seine Frau, eine Laborgehilfin, kennengelernt. Die Taeslers waren mit der Erfahrung sibirischer Kälte nach Schweden geflohen, er stammte aus der Mark Brandenburg, hatte bei Bruno Taut Architektur studiert, sie war Dolmetscherin und kam aus der deutschen Gemeinde von Odessa. Wie Ernst Zietzschmann waren Helmuth Zucker und Werner Taesler geprägt von den Ideen des Neuen Bauens.
Die Familien unter den Gästen waren jüdisch, die alleinstehenden Männer meist auch, mit freien akademischen Berufen und politischer Vergangenheit. Dieser und jener schrieb für schwedische Zeitungen und trat für ein besseres, demokratisches Deutschland ein.
Es war die Musik, die den Gastgeber und die Gäste miteinander verband, und es war Einsamkeit. Jeder kämpfte mit seiner Art des Alleinseins. Ernst Zietzschmann machte die Kontaktlosigkeit des Ausländers zu schaffen, der keinen Bezug zu den Ansässigen fand. Mehr als einmal beklagte er sich in seinen Briefen an Emil Brunner über die Zurückhaltung der Schweden:
«Ich meine auch nun mit meiner Frau, dass es kein Land sei hier für Menschen mit kulturellen Ansprüchen und dem Anspruch einer gewissen wissenschaftlichen Einstellung des Nebenmenschen. Amerikanismus auf Schritt + Tritt. [...] Sie lassen sich überhaupt nicht ein in irgendwelche Bindungen.»
Er war ein enthusiastischer Gastgeber, der die Männer für sich einzunehmen wusste und den Frauen charmierte, die eine und andere umgarnte. Er teilte seine Freude am Musizieren aus dem Stegreif, wie es zu Hause bei seinen Eltern Brauch war, «Gemütsabende» nannte Vater Zietzschmann solches Beisammensein. An Emil Brunner schrieb Ernst:
«Wohl sind Stunden der tiefsten Weihe, draußen in der Natur, bei Bachs Kantaten + Passionen [...]. Und doch bleibt es nur ein Rausch, der das Persönliche aufhebt, [...] der mich mich selbst vergessen macht.»
Lor stand in der Küche, wandte an, was ihr Mama und Mutt mitgegeben hatten, entzückte mit Desserts aus Biel, bis in Schweden Zucker, dann Eier, Butter und alles andere rationiert wurden. Die ersten Lebensmittelkarten, die nach Kriegsbeginn in Umlauf kamen, waren für Kaffee und Tee. In ihr Kochbuch notierte sie die Anleitungen, wie in Schweden Preiselbeeren eingemacht und Grahambrot gebacken wurde. Ihre Käsecrème rührte sie aus eineinhalb Litern Milch, aus zwei bis drei Eiern und nicht mehr als zweihundert Gramm Käse an, die Mischung, so ihre Notiz im Rezeptbuch, reichte für 8–10 Pers., zusammen mit Kartoffeln oder Reis oder auch geröstetem Brot.
Im Gästebuch ist nicht nachzulesen, dass Lor jemals an einem der Abende Cello gespielt hatte.
Die «Gemütsabende» waren für die Gäste, die wie der Gastgeber irgendwann zurückkehren und ihr früheres Leben fortführen wollten, eine willkommene Abwechslung und halfen über das vorübergehende Alleinsein hinweg. Die Einsamkeit der Flüchtlinge war Verlorenheit. Irene Taesler, die deutschstämmige Russin aus Odessa, fasste die Unordnung und Verwirrung im Flüchtlingsleben mit einem Satz zusammen:
«Der Kamm liegt bei der Butter.»
Die meisten Flüchtlinge kämpften mit der Angst, jederzeit aus Schweden ausgewiesen werden zu können. Die schwedischen Behörden erteilten für drei, höchstens sechs Monate Aufenthaltsgenehmigungen. Die Polizei verfolgte einen antikommunistischen Kurs und zog Erkundigungen über die Tätigkeit der politischen Emigranten ein. Werner Taesler, der in Sibirien im Kusbass Industrieanlagen mitgebaut hatte, stand unter Beobachtung von allen Seiten, nicht nur von der schwedischen Polizei. Die Botschaft des Deutschen Reiches hätte ihm wieder einen gültigen Pass ausgestellt, wäre er ihren Einladungen zu nationalsozialistischen Veranstaltungen gefolgt. Seine Weigerung wertete die Botschaft als kommunistisches Bekenntnis, das Existenzrecht als deutscher Bürger wurde ihm abgesprochen, man setzte einen Spitzel auf ihn an. Unter den geflüchteten Genossen galt er ebenso als Verräter, weil er sich vom Kommunismus losgesagt und sich der SoPaDe, der Sozialdemokratischen Partei der deutschen Emigranten, angenähert hatte. Wer wollte, konnte ihn jederzeit bei der schwedischen Geheimpolizei als sowjetischen Agenten oder als deutschen Spion denunzieren. In seinen biografischen Notizen schrieb Werner Taesler Jahrzehnte später:
«Da wir in einer recht gewissenlosen Zeit leben, hängt sich auch zwischen mein Gewissen und meine Äußerungen ein fast undurchdringlicher Vorhang. Nicht nur die nackte Angst vor Überraschungen der Polizei des Gastlandes; viel schlimmer: Das Misstrauen gegen die ‹großen› Bewegungen unserer Zeit wird zuweilen zu einem Misstrauen gegen die Bewegungen in uns selbst. [...] Weil ich mich nicht dem geistigen Schematismus der totalitären Diktaturen fügen will, auch nicht den alten ‹Bewegungen› folgen kann, besinne ich mich auf mich selbst.»
Für die Emigranten war es nicht dasselbe, ob sie zu Zietzschmanns auf Besuch gingen oder an einen der Orte in der Stadt, wo sich die Vertriebenen und Gestrandeten trafen. In der Gemeinschaft der Flüchtlinge teilten sie ihr Schicksal, mit dem Misstrauen war jeder allein. Bei Zietzschmanns herrschte eine kultivierte bürgerliche Ordnung. Die Musikabende vermittelten für ein paar Stunden den Schein greifbarer Normalität. Der Kamm lag nicht bei der Butter. Womöglich spielte auch eine Rolle, dass die Gastgeberin eine Schweizerin war, der Gastgeber zwar deutscher Herkunft, aber in der Schweiz aufgewachsen und eingebürgert.
Im Hochsommer 1939 besuchten Otto und Elisabeth Zietzschmann ihren Sohn und die Schwiegertochter. Schnappschüsse von sonnigen Tagen entstanden. Darunter ein Foto auf fahrendem Motorboot, die Schwiegertochter in kecken Shorts, die Schwiegereltern lachend und zwischen sich eine große, halboffene Papierrolle, vielleicht eine Karte der Schären. Otto Zietzschmann schrieb auf die Bildrückseite: «Der Kriegsplan. Aug. 39». Im Gästebuch wünschte er sich ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Doch der Krieg begann am 1. September mit dem Überfall der Wehrmacht auf Polen.
Ernst schrieb wie gewohnt das Musikprogramm ins Gästebuch, die Namen jedoch, die darunter eingetragen wurden, waren andere. Unter den Emigranten wuchs die Beklemmung mit jedem Land, das besetzt wurde. Die Fluchtwege waren abgeschnitten, als die Wehrmacht im April 1940 auch Norwegen und Dänemark eroberte. Die Glücklichen konnten Schweden noch vor dem Krieg mit irgendeinem Visum verlassen. Die Verarmten verschwanden in einen Vorort von Stockholm oder ließen sich auf dem Land nieder. Wie viele Emigranten verlor Werner Taesler bei Kriegsbeginn seine Stelle. Er zog mit Irene und dem Baby westwärts nach Guldsmedshyttan, im Gepäck die Erfahrung, wie in ärmlichen Verhältnissen bei sibirischen Temperaturen zu überleben war. Denkbar, dass sich manche unter dem Eindruck der Kriegsereignisse abkapselten, andere den Musikabenden fernblieben, weil neue Gäste dazugestoßen waren. Wer kam, hatte eine Arbeit und eine Aufenthaltserlaubnis oder besaß einen schwedischen Pass. Oft spielte Gerhard Wahl Violine, ein routinierter Kammermusiker aus Karlsruhe, der wie sein Vater schon Geigen baute. Im Musikladen seiner Frau, einer Schwedin, reparierte er Instrumente. Er war wie Ernst Anfang dreißig und ein Gefreiter der deutschen Armee. Einen Befehl zum Kriegsdienst erhielt er jedoch nie.
Bei der Geheimpolizei und der Ausländerkommission war Gerhard Wahl registriert als Mitglied der NSDAP und reger Teilnehmer beim Deutschen Kulturbund. Nach dem Krieg konnte ihm nachgewiesen werden, dass er für die Partei ein Amt ausgeübt hatte und ab 1941 als «Kassawart» die Finanzen der Auslandsorganisation in Schweden verwaltet hatte.
PROFIL EINES VERDÄCHTIGTEN
Am 15. Oktober 1940 wurde der Schweizer Bürger Zietzschmann, Otto Richard Ernst, wohnhaft an Lappkärrsvägen 44, erster Stock, in einem Raum der Stockholmer Kriminalpolizei vernommen. Der Beamte fragte nach dem Grund der Auswanderung, ließ sich sämtliche Arbeitgeber und Bauprojekte aufzählen, überprüfte, ob die Steuern ordnungsgemäß einbezahlt wurden, und verlangte den Vertrag des laufenden Arbeitsverhältnisses. Der Verhörte gab zu Protokoll, dass er die Stelle beim Bauunternehmen des Südkrankenhauses zwei Wochen vor Kriegsbeginn angetreten habe. Er zeichnete Ansichten und Aufrisse des zukünftigen städtischen Krankenhauses, das alle Hospitale Skandinaviens in den Schatten stellen sollte. Der Chefarchitekt Hjalmar Cederström ließ Behandlungsräume, Patientenzimmer, selbst die Teeküche, als Modell in Originalgröße bauen und vollständig einrichten, um die Zweckmäßigkeit mit Ärzten und Krankenschwestern zu testen, bevor er die Pläne für gut befand. Der Verhörte gab zu Protokoll, dass er gleich nach seiner Ankunft in Schweden beim Chefarchitekten vorgesprochen habe, aber damals keine Aussicht auf eine Anstellung bestanden habe.
Der Anlass für die Befragung war die Verlängerung der Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis um weitere sechs Monate. Der Polizist eröffnete das Vernehmungsprotokoll mit dem Satz:
«Er wurde ehelich von arischen Eltern geboren und wuchs im Elternhaus in Zürich auf.»
Wessen Worte wurden hier zu Papier gebracht? Enthält die Aussage das Selbstverständnis des Verhörten oder die Sichtweise des Protokoll führenden Beamten?
Verwendete Ernst Zietzschmann diese Worte, dann strich er hervor, was er angesichts der Weltlage für vorteilhaft hielt. Arisch und schweizerisch zu sein erschien nach dem ersten Kriegsjahr wie eine doppelte Garantie. Er zählte auf das Land seiner Eltern, das sich als der große Sieger erwies und Dänemark, Norwegen, Niederlande, Belgien und Luxemburg und nun auch Frankreich unterworfen hatte. Und er zählte auf die Eidgenossenschaft und ihr Abseitsstehen. Er wiegte sich in Sicherheit, er hatte Arbeit, Geld und Privilegien, verglichen mit den Flüchtlingen unter seinen Freunden. Den Wortlaut des Protokolls bestätigte er mit seiner Unterschrift.
Aus Sicht des Polizisten war zwar erwiesen, dass der Verhörte ein Schweizer Bürger mit gültigem Pass war, aber darüber hinaus konnte ihm vieles fragwürdig erscheinen. Dieser erste Satz im Vernehmungsprotokoll könnte ebenso seine Formulierung gewesen sein, eine Demonstration, worin er als schwedischer Beamter und Bürger eine Gefahr vermutete. Polizeilich war nicht auszuschließen, dass einer mit deutscher Herkunft und gewechselter Staatsbürgerschaft für das Deutsche Reich spionierte oder allenfalls auch als kommunistischer Agent unterwegs war. Schweden war umklammert von der Wehrmacht, die Sowjetunion hatte Finnland überfallen, und Finnland musste dem übermächtigen Nachbarn Gebiet abtreten.
Gegen einen möglichen Verdacht sprach wiederum die Aussage des Verhörten, «nie an einer politischen Tätigkeit irgendwelcher Art teilgenommen» zu haben, «auch nicht Mitglied einer solchen Vereinigung gewesen» zu sein. Außerdem hatte er erklärt, sollte er keine weitere Aufenthaltserlaubnis erhalten, mit seiner Ehefrau in die Schweiz zurückkehren zu wollen.
Möglicherweise beabsichtigte der Beamte jedoch mehr zu erfahren, als für eine Verlängerung des Aufenthalts nötig war. Im Frühjahr hatten zwei Privatpersonen Anzeige erstattet.
«Ingenieur Borell, private Telefonnummer 40 42 17, der am Südkrankenhaus angestellt ist, hat mitgeteilt, dass im selben Büro zwei Ausländer angestellt sind, welche wahrscheinlich Nachrichtentätigkeit im Dienst einer fremden Macht betreiben.
Unter dem Personal im Architekturbüro am Südkrankenhaus hat seit langem eine feindliche Stimmung gegenüber den beiden Ausländern geherrscht, weil diese in Zeiten eine Anstellung erhalten haben, in denen schwedische Architekten arbeitslos sind. Die beiden Ausländer sind darüber hinaus unkundig und haben die Anstellung sichtlich nur erhalten, weil sie politische Flüchtlinge sind. Einem jüngeren schwedischen Architekten ist in den vergangenen Tagen wegen Arbeitsmangels gekündigt worden, und das Personal ist der Meinung, dass es angezeigter wäre, dass Arbeit in erster Linie Schweden angeboten wird.
In der letzten Zeit haben die beiden Ausländer flüsternd Telefongespräche geführt. Beide sind beobachtet worden, wie sie Karten des Schärengartens von Stockholm und von Gotland studiert haben, sowie sind beide Inhaber von teuren Kameras, welche fleißig angewendet werden. Der Anzeigeerstatter meint den tschechischen Staatsbürger Riedel und den schweizerischen Staatsbürger Zietchmann.»
Doktor Hansson, Mitglied der Krankenhausdirektion, berichtete der Polizei, ihm sei zu Ohren gekommen, dass zwei ausländische Architekten mit Landkarten, die sie unter den Konstruktionszeichnungen liegen haben, «heimlich» täten und unter Umständen «illegaler Tätigkeiten irgendeiner Art» verdächtigt werden könnten. Der Zuträger wünschte eine «äußerst konfidentielle» Behandlung seiner Mitteilung und anerbot sich, falls erforderlich, weitere Erkundigungen einzuziehen.
Was das Direktionsmitglied diskret anbahnte, tat der Untergebene unverhohlen. Ingenieur Borell betrieb Arbeitsplatzpolitik. Die Angst vor Arbeitslosigkeit saß vielen im Nacken, und es hieß, die zugezogenen ausländischen Fachkräfte und die Emigranten nähmen den Schweden die Arbeitsplätze weg. Und überall nistete das Misstrauen gegenüber Flüchtlingen. Womöglich versprach sich Ingenieur Borell, seine Karriere mit Herumspionieren und Denunzieren zu befördern, zumindest verschaffte er sich Befriedigung, sollte ihn der Neid auf die Fotokameras angetrieben haben.
Ernst Zietzschmann schaute durch seine Kameralinse mit dem Blick eines Touristen auf der Suche nach schönen Landschaften, die ihn beglückten, weil sie so andersartig waren als die Gegend, in der er aufgewachsen war. Er fotografierte Weite und Leere, Wasser, Himmel und Stein. Mit romantischem Entzücken nahm er Ruderboote, Fischerkähne und dunkelrot gestrichene Holzhäuser auf. Im Tagebuch beschrieb er den Farbenrausch in den Stockholmer Schären.
«Manchmal übermannt mich ein ungeheures Glücksgefühl, dass ich hier oben sein + arbeiten + schauen darf. [...]
Ich habe auf der letzten Strecke der Insel Möja entlang schon lange gesehen, wie sich an einer Stelle das Meer öffnet. Wie dort eine dunkle ungeheuere Farbe über dem Wasser liegt. [...] Unendlich weit liegen sie [die Eilande] im Blau + träumen ihr Inselleben. In den blauesten Ausschnitten, aber nur bei scharfem Zusehen erkenntlich, erscheinen blaue unwirkliche Schatten, nur Lichtschattierungen. Kleine weiche Gebilde. Und in dieser unfasslichen Lichtfülle, im äußersten Paradies, so scheint es, dort gleiten Segelboote.»
Das verstohlene Hantieren mit Landkarten während der Arbeitszeit und in der Pause diente der Vorbereitung für Wochenendausflüge und Ferientage.
Anfang August rief der Landesvorstehende Ljunggren von Drottningholm in Stockholm bei der Geheimpolizei an, und ein Beamter protokollierte:
«[...] dass ein Schweizer Staatsbürger namens Otto Richard Ernst Zietzschmann, geboren am 8.5.1907, diesen Sommer von Zahntechniker Ekstrand eine Villa auf Adelsö [Insel im Mälaren] gemietet habe, wo er sich an Samstagen und Sonntagen aufhielt.
Der Landesvorstehende gab weiter an, dass er von Personen, die im Umkreis wohnen, darauf aufmerksam gemacht wurde, dass Zietzschmann ganze Nächte draußen auf dem See zu sein pflegte, ohne dass er dabei fischte. Keiner hatte jedoch beobachtet, womit er sich auf dem See beschäftigte. In den umliegenden Orten Adelsö und Björkö gab es keine irgendwelchen militärischen Geheimnisse. Es könnte denkbar sein, dass sich Z. mit der Auslotung der Wassertiefe beschäftigte, was jedoch der Landesvorstehende nicht für wahrscheinlich hielt. Der Landesvorstehende wies jedoch darauf hin, dass der Södertälje-Kanal genau in diese Gegend mündet.»
Die Personenakte von Ernst Zietzschmann füllte sich mit Meldungen, verursacht durch ein Verhalten, das in Kriegszeiten provozierte. Einmal ruderten er und Lor mit einem anderen Paar um die Insel Björkö, gingen an Land und hatten Feldstecher bei sich, ein Ausflug, wie er jedem Urlauber einfallen kann. Ein Adjutant der Flugmeldedienstkompanie erstattete Anzeige, weil er die Erkundungsfahrt der vier Personen «mit Rücksicht auf die dortigen militärischen Anlagen nicht als angebracht» hielt. Die Silvesternacht 1939 feierte das Paar mit befreundeten Schweizern im bewachten Gebiet der Festung Vaxholm, ohne vorher die Aufenthaltsgenehmigung einzuholen, die seit Kriegsbeginn notwendig war.
Lor Zietzschmann, geborene Wyss, war für die Geheimpolizei die Frau in seiner Gesellschaft, die Sozia, die bei den Unternehmungen mitmachte, aber für die Observation ohne Bedeutung war. Sie beantragte keine Arbeitserlaubnis, Anzeigen lagen nicht vor.
Bei der Polizei trafen keine Meldungen von Hausnachbarn ein, dass an Lappkärrsvägen 44, im ersten Stock, Emigranten, ehemalige Kommunisten, ein- und ausgingen, und dass nach Kriegsbeginn ein Parteigänger der NSDAP jede zweite Woche mit seiner Geige erschien. Auch wurde keine Meldung erstattet, dass Ernst Zietzschmann auf der deutschen Botschaft in Stockholm ein Konzert gab.
Die Kriminalpolizei hatte für einige Wochen eine Post- und Telefonkontrolle angeordnet, aber sie erbrachte keinen Beweis für eine verdeckte Agententätigkeit. Das Profil des Verdächtigten verdichtete sich in keine Richtung. Die gesammelten Meldungen und Anzeigen zeigten nur das verschwommene Bild eines Bedenkenlosen.
PROFIL EINER WIDERSTÄNDISCHEN
Der Spruch «Sei froh, wenn Du kochen kannst für jemand», kam ihr immer entgegen, wenn sie ihr Rezeptbuch öffnete, die Schutzseite umblätterte und beim Register weiter aufschlug. Die Seite riss vom vielen Gebrauch ein, aber Mutters Wahlspruch und Vaters «Kü-Ko» hatten Bestand. Zu Kriegszeiten konnte der Spruch durchaus anders gelesen werden, als ihn die Mutter zu Friedenszeiten beabsichtigt hatte.
Sei froh, wenn Du kochen kannst, während andere nicht wissen, wovon sie sich ernähren sollen.
Sei froh, wenn Du kochen kannst für jemand, und es ist Krieg.
Aber war zu Kriegszeiten fraglos für jeden Gast zu kochen?
Was wusste und ahnte Lor Zietzschmann vom Geigenbauer aus Karlsruhe, der manchmal in Begleitung seiner schwedischen Frau zu den Musikabenden kam und vielleicht auch mit dem kleinen Kind?
Die Zwangslage, in die Lor Zietzschmann geriet, war unausweichlich. In Berlin hatte sie Cello gelernt aus Protest. In Stockholm empfing sie als Ehefrau die Gäste ihres Mannes, der keinen Unterschied machte zwischen Verfolgten und solchen, die versteckt oder offen mit den Nationalsozialisten sympathisierten. Ihr Ehemann sah nichts Fragwürdiges darin, auf der deutschen Botschaft zu musizieren.
Sie verschloss sich nicht, beobachtete, hörte hin, ließ sich erzählen, stellte Fragen. Sie orientierte sich an christlichen, humanistischen Werten wie ihre Schwester. Hilde hatte sich dem Christlichen Studentenverein angeschlossen und vor Lor Vorlesungen bei Emil Brunner besucht. Als sie ein Jahr nach Lor für einige Tage in Berlin weilte, besuchte sie, vielleicht auf Empfehlung von Lor, Versammlungen der Bekennenden Kirche und hörte Martin Niemöller predigen. In ihrem Lebensbericht schrieb sie fünfzig Jahre später:
«Nach den Erlebnissen in Deutschland mit Nationalsozialismus und Bekennender Kirche stand für mich fest, dass ich eine Arbeit auf kirchlichem Gebiet suchen wollte.»
Sie las von Arthur Frey, dem Leiter des Schweizerischen Evangelischen Pressedienstes, ein Buch über den Kirchenkampf in Deutschland und fragte ihn an, ob er für sie Arbeit habe, sie erhielt eine Anstellung als Redaktorin.
Lor fand im fünfzehn Jahre älteren Berthold Josephy einen Förderer. Er kam als Vertriebener nach Stockholm, entlassen an der Universität Jena, wo er Allgemeine Wirtschaftslehre, Finanz- und Versicherungswissenschaften gelehrt hatte. Er war ein konservativer Liberaler, vielleicht mehr ein liberaler Konservativer. Die Kriminalpolizei hielt in den Akten ungenau fest:
«Vor der nationalsozialistischen Revolution hatte er der Deutschnationalen Partei angehört.»
Damit war vermutlich die Deutschnationale Volkspartei gemeint, die sich gegen Ende der Weimarer Republik der NSDAP angenähert hatte. Berthold Josephy pflegte Umgang mit Mächtigen aus Finanz und Industrie. Er lebte von Artikeln für die antinationalsozialistische Zeitschrift des schwedischen Arbeitgeberverbandes. Seine Zeit verwendete er für das entstehende Buchmanuskript «Recht und Macht in der Gesellschaft. Liberalismus und Sozialismus».