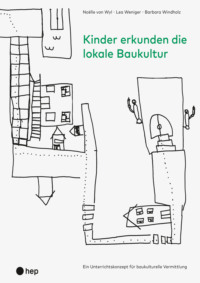Kitabı oku: «Kinder erkunden die lokale Baukultur (E-Book)», sayfa 2
1.2 Bewusstseinsbildung für die Umweltgestaltung
Baukultur umgibt uns und entsteht jeden Tag neu; sie umschliesst «die Summe der menschlichen Tätigkeiten, welche die gebaute Umwelt verändern», so die Erklärung von Davos (FDHA/FOC, 2018, S. 3). Mit dieser Definition von Baukultur wird ein weites Feld eröffnet und das Verhältnis des Menschen zur Umwelt beschrieben. Als Ausgangspunkt jeder Definition hat, «darüber besteht heute wohl fachlicher Konsens, die Differenz von System und Umwelt zu dienen» (Luhmann, 2015a, S. 35). Umwelt und soziales System beschreiben eine «Differenz», so der Soziologe Luhmann; es handelt sich sozusagen um zwei Seiten derselben Medaille. Menschen sind «strukturell an ihrer Umwelt orientiert und könnten ohne Umwelt nicht bestehen» (ebd.). Gleichzeitig stellt sich die Welt für sie als «Gesamtheit der Eigenwerte» dar, die sie durch ihre Existenz bewusst oder unbewusst verändern beziehungsweise gestalten. «Das Gehirn unterdrückt, wenn man so sagen darf, seine Eigenleistung, um die Welt als Welt erscheinen zu lassen» (Luhmann, 2015b, S. 15). Die Umwelt ist somit eine Voraussetzung, die eine Bildung des Bewusstseins über Differenzierungen erfordert. Das Bundesamt für Kultur beschreibt das Verhältnis Mensch–Umwelt in seinem Konzept für Baukultur auf folgende Weise: «Sei es als Bewohner[/-innen] oder als Architekt[/-innen] – alle Menschen prägen ihren Lebensraum. Dieser formt gleichzeitig das Zusammenleben jedes und jeder Einzelnen» (BAK, o. J.). Auch hier wird klargestellt, dass alle Menschen zur Gestaltung der Umwelt beitragen. Die Bildung des Umweltbewusstseins und der Gestaltungsfähigkeit des Menschen sind auch im schweizerischen Lehrplan verankert. Die Autorinnen dieser Publikation beziehen den Begriff Umwelt auf die Perspektiven der Fachbereiche Natur, Mensch, Gesellschaft (NMG). Konkret orientieren sie sich an den Bildungszielen für nachhaltige Entwicklung (BNE), fokussieren auf die «Wechselwirkungen zwischen Menschen und ihrer Um- und Mitwelt» (NMG) und verbinden diese Inhalte mit den Kompetenzzielen der Fachbereiche Gestaltung (BG, TTG) (D-EDK, 2016b S. 17; 2016c, S. 5; 2016a, S. 3). Natürliche, kulturelle, wirtschaftliche, soziale und historische Phänomene werden mit den Schülerinnen und Schülern über interdisziplinäre Zugangsweisen erschlossen. Ausgehend von diesen Grundlagen ist das vorliegende Konzept für baukulturellen Unterricht entwickelt worden.
Baukulturelle Bildung als Allgemeinbildung erfordert eine Erklärung der Begriffe und den Aufbau eines fächerübergreifenden Verständnisses. Es erstaunt nicht, dass selbst der Begriff «Baukultur» für Lehrpersonen wenig fassbar ist, wie das Projektteam während der Durchführung feststellte. Auch Elisabeth Gaus-Hegner und ihr Team hielten in ihrer Studie 2019 zu Bestand und Bedarf der Baukulturellen Bildung an Schweizer Schulen fest: «Baukultur wird von Lehrpersonen und Dozierenden als wenig geläufiger und dehnbarer Begriff wahrgenommen» (Archijeunes, 2019, Vorwort). Es handelt sich um einen Ausdruck, der in unserem Sprachraum ausser in Fachkreisen der Architektur selten verwendet wird. Kinder verstehen ihn, wenn ihnen Baukultur als zusammengesetztes Wort von Bauen und Kultur erklärt wird. Wie der Begriff «Baukultur» in der Architektur definiert wird, zeigt die Erklärung von Davos: «Baukultur umfasst den gesamten Baubestand, einschliesslich Denkmälern und anderer Elemente des Kulturerbes, sowie die Planung und Gestaltung von zeitgenössischen Gebäuden, Infrastrukturen, vom öffentlichen Raum und von Landschaften» (BAK, 2018, S. 17). Der Begriff umfasst somit nahezu alle Bereiche der gebauten Umwelt.
Baukultur reicht also über die Wirkungsfelder von Architektur und Denkmalschutz hinaus, zielt auf öffentliche und private Bauten, Räume und Landschaften und auf baukulturelle Prozesse. Darüber hinaus strebt das Manifest für eine «hohe Baukultur» die Mitwirkung aller am jeweiligen Ort lebenden Menschen an. Das Qualitätskonzept, das im Nachgang zur Erklärung von Davos vom Bundesamt für Kultur verfasst wurde, präzisiert: «Ein spezifischer Genius Loci entsteht durch das soziale Gefüge, die Geschichte, Erinnerungen, Farben und Gerüche eines Ortes, die seine Identität und die Verbundenheit der Menschen mit ihm bestimmen» (BAK, 2021, S. 4). Die Authentizität eines Ortes entsteht also nicht nur durch die Bauten, sondern auch durch die Menschen, die eine gebaute Umwelt beleben und damit täglich verändern. Die Einladung für ein baukulturelles Engagement richtet sich damit nicht nur an Baufachleute; vielmehr braucht es dazu alle Bürgerinnen und Bürger, wie es bereits die damalige Bundeskanzlerin Annemarie Huber-Hotz (2007) anlässlich einer Eröffnungsansprache für einen Jugendwettbewerb formulierte. «Lebensraumgestaltung fängt im Kleinen an», sagte sie und führte aus: «[…] im Haus, in dem wir wohnen und arbeiten; in der Strasse vor dem Haus; auf dem Weg zur Schule, den wir mit dem Velo oder dem Bus zurücklegen; im Dorf oder im städtischen Quartierzentrum, wo wir uns einen Platz zum Begegnen wünschen».[5]
Baukulturelle Bildung bereichert die Fächer des Bildnerischen und Technischen Gestaltens mit dem Aspekt der Umweltgestaltung. Die Thematik schafft neue Möglichkeiten für schulische Projekte, fördert die Partizipation in der eigenen Wohngemeinde und befähigt Schüler und Schülerinnen zur Teilhabe an Veränderungsprozessen. Doch ein Interesse für die gebaute Umwelt ist keine Selbstverständlichkeit. Es nimmt seinen Anfang im Kindesalter mit der Wahrnehmung und Aneignung des unmittelbar vorhandenen Lebensraums. Raumeindrücke werden erfahren und Räume erkundet, befragt und verglichen. Kinder entwickeln Vorstellungen und Assoziationen und bewerten Räume emotional (vgl. Buether, 2010, S. 47). Sie entwickeln eine «räumlich visuelle Kompetenz» und setzen diese «im Gestaltungs- und Kommunikationsprozess» ein, sei es im Innen- oder Aussenraum (ebd., S. 261). Kinder und Jugendliche entwickeln Fähigkeiten, um gemeinschaftliche Raumprojekte zu initiieren; ihr Interesse für das Bauen reicht von der Herstellung von Laub- und Baumhütten[6] bis hin zur Teilhabe an städtischen Entwicklungsprojekten. Diese Interessen werden in Schulen, Freizeit und Ferienangeboten seit jeher berücksichtigt. Pädagogische Hochschulen im In- und Ausland haben in den vergangenen Jahren damit begonnen, baukulturelle Bildung in ihr Lehrangebot aufzunehmen. Auch im Architekturstudium setzen sich Studierende vermehrt mit den ethischen Dimensionen ihres Fachbereichs auseinander. Die Technische Universität München TU beispielsweise zeigte der Öffentlichkeit in der Architekturausstellung Experience in Action! (2020) eine Auswahl an Partizipationsprojekten. Wie Hilde Strobl in der Projektdokumentation titelt: «Architektur ist zu wichtig, um sie den Architekten und Architektinnen zu überlassen» (Strobl in Bader & Lepik, 2020, S. 31). Eine umfassende baukulturelle Bildung für alle setzt somit eine sich kontinuierlich aufbauende Auseinandersetzung mit Raumeigenschaften, -beschaffenheiten und -wirkungen auf allen Ausbildungsstufen voraus.
1.3 Problematik und Ziele
Bis anhin haben sich vor allem ausserschulische Organisationen für die baukulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen engagiert. Sie haben das Potenzial und die Notwendigkeit erkannt und bieten unterschiedliche Kurse an, wie zum Beispiel das LABforKids – Labor für Baukultur[7] im schweizerischen Zug. Da eine solche Förderung im informellen, das heisst im ausserschulischen Bereich nicht allen Kindern und Jugendlichen zukommt, setzt sich Archijeunes für eine baukulturelle Bildung an öffentlichen Schulen ein. Der Verein formuliert dieses Anliegen so: «Obwohl die gebaute Umwelt für die Gesellschaft anerkanntermassen von grosser Relevanz ist, wird dieser Bereich an schweizerischen Schulen ausser Acht gelassen. Es fehlt inner- und ausserschulisch an Partizipationsmöglichkeiten. Dieses Manko betrifft nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern ebenso deren Lehrpersonen. Unter diesen Umständen kann die gesellschaftliche Verantwortung für Baukultur, für soziale Interaktion und Kohäsion, für Kreativität und Identifikation, kaum wahrgenommen werden» (Archijeunes, o. J.). Über die Website können sich Lehrerinnen und Lehrer über Literatur und Vermittlungsangebote informieren. Doch für eine breite baukulturelle Bildung fehlen, wie erwähnte Studie von Archijeunes zeigt, sowohl eine klare Definition kompetenzorientierter Bildungsinhalte als auch Unterrichtsmaterialien.
Elisabeth Gaus-Hegner und ihr Team befragten in dieser Studie Dozierende, Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler zu Bestand und Bedarf bezüglich baukultureller Bildung in der Schweiz. Gegenüber der Idee, «neue Elemente in den Lehrplan zu integrieren» beziehungsweise neue Inhalte vermitteln zu müssen, äusserten Lehrerinnen und Lehrer insgesamt eher Bedenken (Archijeunes, 2019, S. 16). Als Begründung hielten sie fest, es seien nicht ausreichend Anknüpfungspunkte vorhanden und es würden geeignete Lehrmittel fehlen, um eine Verknüpfung zwischen Zielen und Inhalten baukultureller Bildung, dem Lehrplan 21 und dem schulischen Alltag herstellen zu können (ebd., S. 9). Die Lehrpersonen seien mit den Themen nicht vertraut und wünschten sich eine stufenbezogene Begriffs- und Inhaltsklärung. Einige teilten mit, dass die Kompetenzbereiche des Bildnerischen Gestaltens (BG) und Textilen und Technischen Gestaltens (TTG) sowie von Natur, Mensch, Gesellschaft (NMG) Übereinstimmungen mit baukulturellen Lernzielen aufweisen könnten. Auch im Bereich der überfachlichen Kompetenzen und Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) werden Anknüpfungspunkte zum Lehrplan 21 verortet. Es könnten Problemlösungsfähigkeit, freie Meinungsbildung, eine differenzierte Sprache und die Teilhabe an der Gestaltung der Lebenswelt gefördert werden, so die Befragten (ebd., S. 46).
Doch überwiegend waren die Lehrpersonen der Meinung, dass die Umsetzung solcher Themen stark von den Präferenzen der jeweiligen Akteure und Akteurinnen abhingen (ebd., S. 21). Lehrerinnen und Lehrer aller Stufen, vom Kindergarten bis zur Sekundarschule, bejahen dennoch mehrheitlich ihr Interesse an der Integration baukultureller Themen in den regulären Unterricht. Die Komplexität des wenig bekannten Themas, die Dichte des bestehenden Unterrichts und die fehlenden Lehrmittel verhindern ganz offensichtlich, diese Themen aufzugreifen. Ein kontinuierlicher Wissensaufbau kann bis heute nicht stattfinden, da baukulturelle Inhalte für den Unterricht bis jetzt nicht kompetenzorientiert aufbereitet worden sind, und das trotz aller Bekundungen der Kinder und Jugendlichen, dass «Baukultur für sie ein spannendes Lernfeld darstellt» (ebd., S. 17). Ziel des beschriebenen Projekts war es deshalb, ein fächerübergreifendes Unterrichtskonzept mit einem Kompetenzstrukturmodell zu entwickeln, dass Lehrerinnen und Lehrer für baukulturelle Vermittlung motiviert.

Abb. 1.1: Schematische Darstellung der Wissens- und Handlungsgebiete und ihre Beziehungen untereinander
1.4 Baukulturelle Bildung – Intention und Lerngegenstand
Baukultur betrifft den Menschen auf vielfältige Art und Weise, denn menschliches Handeln findet grundsätzlich in Innen- oder Aussenräumen statt. Diese werden meist nicht aufmerksam wahrgenommen, sondern eher beiläufig, unbewusst. So wird die gebaute Umgebung in einer Gleichzeitigkeit mit den sich darin aufhaltenden Menschen sowie den Raumqualitäten wie Wetter, Wärme, Geruch und Geräusche erlebt. Solche räumlichen Gesamteindrücke bezeichnet der Psychologe Rainer Schönhammer als «Milieu» oder allgemeinverständlicher als «Atmosphären» (Schönhammer, 2013, S. 293). Nicht nur Gebäude, sondern Personen, Pflanzen und alles, was die Umgebung formt, ist dabei miteinbezogen: «Man spürt sich und das Leben am Ort» (ebd., S. 296). Die vom Menschen geformte Umgebung erfüllt nicht nur funktionale Zwecke, sondern hinterlässt auch emotionale Eindrücke. «Wir geben ihr Form und sie formt uns» (UIA, 2008, zit. in Tschavgova & Feller, 2008, S. 2). Damit ist klar: Baukulturelle Bildung beinhaltet Funktion und Ästhetik. Ein Verständnis dafür, wie sich bestimmte Formen der gebauten Umwelt in ihrer Gestaltung über ihren Bezug zur Nachbarschaft, durch ihre Repräsentationsfunktion und Weiteres bedingen, und die Auseinandersetzung mit diesen Zusammenhängen bilden den Menschen in seinen Wahrnehmungs-, Gestaltungs- und Kommunikationsfähigkeiten.
Den Bezug zur Ästhetik stellt auch Roland Reichenbach (2021) in seiner bildungstheoretischen Annäherung an die baukulturelle Allgemeinbildung her. «Baukulturelle Erfahrungen sind auch ästhetische Erfahrungen. ‹Ästhetische Erfahrungen› ermöglichen ‹einen Zugang zum Wirklichen› (…), hierbei spielen nicht nur die sinnlichen Wahrnehmungen, sondern auch die sinnlichen Vorstellungen die zentrale Rolle» (Reichenbach, 2021, S. 65). Baukulturelle Bildung ermöglicht eine Auseinandersetzung mit den Erscheinungen der gebauten Umwelt, indem der Anblick von Architektur die eigenen ästhetischen Vorstellungen bestätigt oder auch dazu führt, Dinge in einem anderen Licht zu sehen. Architektur, besonders zeitgenössisches Bauen, ist für Kinder, Jugendliche und selbst für Erwachsene meist nicht auf Anhieb verständlich und wird wohl auch deshalb oft abgelehnt. Gebäude die Architekten und Konstrukteurinnen für bedeutungsvoll halten, sind für Schülerinnen und Schüler – und nicht nur für sie – manchmal erklärungsbedürftig.
Ungewohnte Sichtweisen erfordern eine unvoreingenommene Wahrnehmung und basale Kenntnisse formaler Prinzipien und Gestaltungsgrundlagen. Dazu gehören beispielsweise Formkonzepte und Farbtheorien, Statik und Konstruktion oder Licht und Schattenwirkung, wie sie in diesem Buch praxisnah thematisiert werden. Mithilfe dieses Wissens wird es eher möglich sein, auch ungewohnte Bauwerke und Anlagen zu betrachten, einzuordnen und zu beschreiben.
Betrachtungs- und Gestaltungsfähigkeit setzen eine ästhetische Bildung im Sinne einer sinnlich vermittelten Wahrnehmung kulturell und historisch bedingter Erscheinungen voraus. Dabei ist eine Balance zwischen Theorie und Praxis in der Vermittlung der Grundlagen bedeutsam. Kinder und Jugendliche müssen diese Fähigkeiten in handelnder und verstehender Ganzheit und Gegenseitigkeit erlernen, um die sinnliche Wirkung von Oberflächen, Materialien, Farben und Formen begreifen zu können. Architektur, Kunst und Design sind weder als reine Praxis noch als reine Theorie vermittelbar. Wenn sich Kinder und Jugendliche in Baukultur bilden, bedeutet das daher sowohl intellektuelles Erkennen, emotionales Empfinden als auch gestalterisches Handeln.
Diese Bildungsperspektiven finden sich auch in den Lernzielen, die im Rahmen von Forschungsprojekten der Wüstenrotstiftung[8] für Deutschland definiert wurden. Im Zentrum der baukulturellen Bildung steht dabei die Förderung der Begriffs- und Kommunikationsfähigkeit sowie der Wahrnehmungs- und Gestaltungsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern. Das Ziel ist, ein breites und zielstufenspezifisches Verständnis für baukulturelle Belange zu etablieren. Die im Folgenden aufgeführten Lernziele der baukulturellen Bildung beziehen sich auf die Zielformulierung des Union International Education Network UIA sowie die Projekte der Wüstenrotstiftung (Million et al., 2019). Die Autorinnen dieser Publikation formulieren diese wie folgt:
•ein sinnliches Bewusstsein für private und öffentliche Räume entwickeln;
•Sensibilität, Fantasie und eigene ästhetische Vorstellungen bilden;
•gestalterische Fähigkeiten und Fertigkeiten erlernen und anwenden;
•Problemlösungsverfahren kennen und Prozesse erfahren;
•Techniken und Materialien kennen und damit experimentieren;
•Bau- und Handwerksinteresse entwickeln und Handlungen nachvollziehen;
•Ideen und Optionen erforschen, darstellen und umsetzen;
•im Team arbeiten und kreative Lösungswege finden;
•Präsentations- und Argumentationsfähigkeiten entwickeln;
•traditionelles und zeitgenössisches Bauen kennen und schätzen;
•Zusammenhänge zwischen gebauter und natürlicher Umwelt verstehen;
•das Vokabular kennen, um über Baukultur diskutieren zu können;
•Rollen, Rechte und Verantwortlichkeiten von Bauleuten und Öffentlichkeit kennen;
•Baukultur als Aufgabe von Forschung und Entwicklung anerkennen.
Die Vielfalt der Lernziele zeigt es: Die gebaute Umwelt ist nicht nur ein Lebensort, sondern auch ein bedeutender Lernort mit Förderungspotenzial. Kinder und Jugendliche wachsen in städtischen oder ländlichen Umgebungen auf, die aufgrund des demografischen Wandels sowie der technologischen und digitalen Entwicklung in Veränderung begriffen sind. Historisch gewachsene Strukturen und Orte erfahren Umstrukturierungen. Vertraute Treffpunkte, wie Plätze und öffentliche Räume, werden erneuert; Desorientierung unter Jugendlichen und auch Erwachsenen kann die Folge sein. Auch präventive Aspekte im Hinblick auf die Zugehörigkeit zu einem bestimmten sozialen und räumlichen Gefüge sprechen dafür, Kinder und Jugendliche für Umweltveränderungen und Umweltgestaltungen zu sensibilisieren und sie, wo immer möglich, auch daran zu beteiligen. Die Qualitätskriterien des Bundesamts für Kultur unterstützen diese Bildungsbestrebungen, denn eine «hohe Baukultur (…) fördert die Verbundenheit mit dem Ort», stärkt die «Identität und Unverwechselbarkeit» und berücksichtigt «das Bedürfnis nach positiver ästhetischer Wertschätzung und einer erfüllenden Beziehung zwischen Menschen und Ort» (BAK, 2021, S. 23). Baukulturelle Bildung fördert somit die Sozialkompetenz im Sinne der Fähigkeit, sich in der Gesellschaft aktiv einzubringen (D-EDK, 2016b, S. 3).
1.5 Untersuchungen zur baukulturellen Bildung
Baukulturelle Bildung als bildungspolitische Aufgabe hat in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Seit der Jahrtausendwende wurden in europäischen Ländern wie England, Frankreich, Deutschland und Österreich Studien zur Förderung dieses Bildungsbereichs durchgeführt. Dennoch wird baukulturelle Bildung im Forschungszusammenhang zu wenig diskutiert (Million, Heinrich & Coelen, 2016). Angela Million und ihr Team kamen im Rahmen einer Untersuchung von mehreren baukulturellen Projekten im städtischen Umfeld und Interviews mit Kindern und Jugendlichen von acht bis 18 Jahren zum Schluss, dass die Diskussion über eine allgemeinbildende Baukultur notwendig sei, um junge Menschen für Stadtplanungsprozesse interessieren zu können. Die Forderung mündet in Umsetzungsvorschlägen wie «vielfältige Settings baukultureller Bildung kultivieren», «baukulturelle Bildung in der Schule verankern», den «gesamten (Stadt-)Raum als Bildungsraum nutzen», «familiäres Lernen berücksichtigen», «Zugänge über Materialien und Werkzeuge eröffnen», «digitale Lernwelten erschliessen», «baukulturelle Bildung mit Beteiligung verbinden», «Anleiterinnen weiterqualifizieren» (d. h. Weiterbildungsangebote für Lehrpersonen und weitere Interessierte) oder «baukulturelle Bildungsangebote politisch fördern» (Million et al., 2019, S. 209 ff.). Insgesamt definiert die Studie vielseitige Handlungsfelder, die auch für andere Länder von Bedeutung sind.
Mit ihrer an der Natur orientierten Architektur und organischen Formensprache haben die Architekten Eliel Sarinnen (1873–1950) und Alvar Aalto (1898–1976) wesentlich zur finnischen Identität und dem damit verbundenen hohen Stellenwert der baukulturellen Qualität beigetragen. «Der Schlüssel zum Architekturverständnis», so zitiert Turit Fröbe aus dem architekturpolitischen Programm, «liegt vorrangig bei der Kunsterziehung sowie bei den umweltbezogenen Fächern, die die Belange der gebauten Umwelt einbeziehen» (ebd., S. 45). Die Architekturhistorikerin untersuchte 2018 im Rahmen einer Feldstudie an der Universität der Künste in Berlin die Auswirkungen der architekturpolitischen Massnahmen von 1998 in finnischen Bildungsinstitutionen beziehungsweise inwiefern diese Form der «Architecture Education» für andere Länder wegweisend sein könnte. Fröbe stellte fest, dass baukulturelle Bildung – nach einer anfänglichen Euphorie vor gut 20 Jahren – heute in den öffentlichen Schulen nicht mehr gelehrt wird als anderswo in Europa. Obgleich es in Finnland diese Programme gab, wurde offensichtlich zu wenig in die Koordination der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen investiert. Ein Problem besteht auch in der «Streichung des obligatorischen Architekturkurses», der im Rahmen des Kunstunterrichts in der Klassenstufe 1–7 stattgefunden hat (ebd., S. 65). Fröbe hält fest, «dass der Architekturunterricht an den Schulen auch aufgrund des Mangels an Lehrmitteln unzureichend sei» und kommt zum Schluss, schulische Projekte bedürften in der Vermittlung «einer gewissen Sinnlichkeit […], damit sie nicht abschreckend wirken» (ebd., S. 45). Deshalb empfiehlt sie baukulturelle Bildung für die Lehrenden «einfach» zu machen, weil Lehrpersonen sonst baukulturelle Inhalte nicht unterrichten würden (ebd., S. 156). Auf strategischer Ebene sollen darüber hinaus, «baukulturelle Leitlinien» entwickelt werden, die als «zentrale Bestandteile von Kunst und Kultur» gelten (ebd., S. 177). Es müsse ein Netzwerk aufgebaut werden beziehungsweise «es bedarf Akteurinnen und Akteure nach dem Vorbild des finnischen Special Advisors for Architecture im National Council for Architecture, welche die architekturpolitischen Massnahmen kommunizieren und als Ansprechpartnerinnen und -partner sowie Beraterinnen und Berater fungieren» (ebd., S. 67). Eine Implementierung der Vermittlung von Baukultur in den Schulen brauche zudem – etwa alle drei oder vier Jahre – einen Evaluationsprozess, um die Leitlinien einer regelmässigen Revision zu unterziehen (ebd., S. 178).
Der Verein Archijeunes fördert und koordiniert die baukulturelle Bildung in der Schweiz. Wie anfangs erwähnt hat er eine Analyse zum Bestand und Bedarf der baukulturellen Bildung in der Schweiz in Auftrag gegeben, um den Stand und die Bedürfnislage von Lehrerinnen und Lehrern an Schweizer Schulen zu ermitteln (Archijeunes, 2019). Insgesamt wurden 59 Dozierende an pädagogischen Hochschulen, 21 Lehrpersonen und 100 Schülerinnen und Schüler interviewt. Obwohl Baukultur nicht explizit unterrichtet wird, erkennen die Befragten bezüglich der Lerninhalte in bestimmten Fachbereichen Übereinstimmungen mit baukulturellen Inhalten. Diese betreffen insbesondere die Fähigkeiten zur Raumwahrnehmung, die Vorstellungsbildung, die Vermittlung von Strategien zur Entwicklung von Ideen, Entwurfstechniken und Ablauf von Gestaltungsprozessen (BG) sowie Fragen der Raumnutzung und Raumveränderung, Kartografie, menschliche Lebensräume und Lebensweisen, Kultur- und Siedlungsgeschichte (NMG), Konstruktion, Statik, Bauen und Wohnen sowie Handwerk und Verfahrenstechniken (TTG) (ebd., S. 45ff.). Ergebnis der Studie sind Empfehlungen zu folgenden Handlungsfeldern:
1Sensibilisierung für baukulturelle Bildung
2systemische Verankerung an Schweizer Schulen
3Kommunikation
4Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen
5Forschung und Entwicklung
6Entwicklung von Unterrichtsmaterialien und Lehrmitteln
7Schulraum und Partizipation
8Rahmenbedingungen (ebd., S. 23ff.)
Zusammenfassend lassen die erwähnten Studien den Schluss zu, dass bis heute, zumindest in den genannten Ländern, geeignete, an die bildungspolitischen Gegebenheiten anschlussfähige Unterrichtskonzepte fehlen.