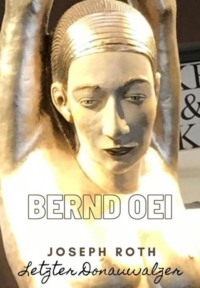Kitabı oku: «Joseph Roth - Letzter Donauwalzer», sayfa 3
Vielmehr gewinnt Roth für den aufmerksamen Leser Konturen, in der Zweifel und Hoffnung, Empörung und Resignation alternieren. Es gibt keine Sicherheit, weshalb sollte ein intelligenter Mensch darum an einem Versprechen, gleich welcher Art, festhalten? Er führt das Leben eines Entwurzelten von Anfang an. Seine letzte Erzählung Die Legende vom Heiligen Trinker manifestiert neben biografischen Bezügen, dass selbst innerer Wandel und sichtbar äußeres Verhalten nicht kongruent verlaufen müssen. Andreas ändert sich und bleibt sich dennoch treu; er bewahrt sich seine Menschlichkeit, indem er sich konsequent permanent betrinkt.
Roth ist nicht nur ein präziser Beobachter, der im Detail einen Ausdruck für das Ganze sieht, sondern lebenslang auch ein mitfühlender Moralist und humorvoller Humanist. Ein Anwalt der Menschlichkeit implizit ihrer Verfehlungen, Schwächen und Sünden, diesbezüglich Dostojewski seelenverwandt. Daher kann er auch gleichzeitig ein überzeugter Sozialist, Katholik und Jude sein fern unvereinbarer Ideologien. Auch das ist Zeichen eines Grenzgängers.
Ganz für eine Seite lässt er sich nicht gewinnen, weder den Marxismus bzw. Kommunismus, noch für die Sozialdemokratie. Er heiligt weder die Festtage noch hält er den Sabbat des Talmud, ist strikter Gegner des Zionismus. Sein Herz schlägt milde gegenüber Andersdenkenden und verträgt sich nicht mit Dogmen. Er ist kein Theoretiker, immer geht es um das Konkrete und das rechte Maß, darin erinnert er an Montaigne. Seine Arbeit legt Zeugnis ab für die „sinnlichste Wahrnehmung, die ein deutschsprachiger Dichter jemals hatte."43
Die religiöse Gesinnung auf der Basis eigener Erfahrung und Erlebnisse zwingt ihn notorisch zum Kampf gegen erstarrte orthodoxe Konfessionen, die er im Roman Der stumme Prophet" nachvollziehbar illustriert. Wie schon ansatzweise in Die Flucht ohne Ende stellt Roth hier die Verfehlung des Sozialismus und Russland dar und schafft sich dort Feinde. Beide Schriften gelten in ihrer Kritik an der Linken der Abrechnung mit der nationalsozialistischen Ideologie in Das Spinnennetz oder in Rechts und Links.
Aufgrund seiner Menschenverachtung das kommunistische Regime in Russland an den Pranger. Als Pazifist lehnt er es ab, Menschen für eine Idee zu töten, selbst wenn es die richtige ist und dieses Verbrechen als notwendiges Opfer zu legitimieren. Ob er deshalb nicht die Liquidation des Antichristen gebilligt hätte, ist keinesfalls auszuschließen.
Alle Entwicklungen aus der Revolution heraus enttäuschen Roth; daher rührt sein Misstrauen sie als Alternative zur gestürzten Monarchie anzunehmen. Der Vormarsch des Stalinismus und Faschismus wird in der Demokratie keineswegs aufgehalten, sondern gefördert. Ohne religiöses Surrogat ist es offenbar unmöglich ist, die Basis für ein gesellschaftliches Miteinander zu schaffen, Vorurteile und ökonomische Interessenskonflikte zu überwinden. Aus Pragmatismus vereint er jüdische und katholische Konfessionen in seiner Mystik. Roths soziale Kritik manifestiert sich besonders in den frühen Romanen Das Spinnennetz, Hotel Savoy, Die Rebellion, die allesamt zeitgenössische Romane der Weimarer Republik sind und deren Schwächen, u. a. den Bürokratismus enthüllen. Er steht immer auf der Seite der Opfer Verlierer und der Entwurzelten (meist Kriegsheimkehrer), wie Hermann Hesse pointiert bemerkt. Schon in seinen ersten Jahren als Autor macht Roth deutlich, dass der Verzicht auf Spiritualität vereinsamt. Andreas Pum in Die Rebellion bleibt ohne religiösen Trost haltlos und gerät aus dem Gleichgewicht, weil sein Vertrauen in Recht und Ordnung naiv anmutet. Am Ende erklärt er zornig Gott den Krieg und will lieber in die Hölle, wo er vermutet, dass es gerechter zugehe. Moralisch integre Charaktere wie er zerstören entweder sich selbst oder werden marginalisiert und schikaniert.
Ein klares Glaubensbekenntnis, das über den Humanismus (Rousseaus Mitgefühl) hinausreicht, bleibt der Autor schuldig. Er deckt auf, ohne anzuklagen und er verteidigt Werte ohne Plädoyer. Leitmotiv bis Hiob (1930) bleibt der Menschen in der Fremde ohne Halt und ohne Zukunft. Der Theorie von Isaac Berlin nach, der Künstler in Igel mit einer großen Idee und in Fuchs mit viele kleinen Ideen unterscheidet, ist Roth klar ein Igel des Zusammenbruchs.
Eine tragende Bedeutung nehmen Topografie und Heterotropie in Roths Werk ein. Die in Wien oder Berlin lokalisierten Romane folgen drei Werke, die ihren Schwerpunkt in Russland besitzen. Der Auseinandersetzung mit dem rechten Terror folgt eine Absage an den Linksradikalismus.
Heinrich Mann und Lion Feuchtwanger gehören zu jenen sozialistisch engagierten Autoren, denen Roth Aufrichtigkeit und Menschlichkeit nicht abspricht. Näher stehen ihn jedoch die Kollegen Werfel, Toller, Weiß oder Schickele, die in ihrer Zeit nicht nur die Mängel diagnostizieren, sondern dem offensichtlichen Werteverlust mit Güte und spiritueller Kraft begegnen.
Spätwerk (1930-1939)
In allen literarischen Werken findet seit seiner Reportage Juden auf Wanderschaft, spätestens aber mit Hiob Roths eine religiöse Reflexion statt, welche die politische etwas in den Hintergrund rückt. Weniger die sozialen Nöte, mehr der Verlust von Heimat bewirken Haltlosigkeit und Krisenbewusstsein. Das Schicksal seiner Figuren erlaubt Rückschlüsse auf den Mensch Roth; Leben und Werk bedingen sich in seinem Fall wechselseitig. Am deutlichsten sind die religiösen Zweifel im Roman Hiob; zugleich vollzieht Roth durch die glaubhaft geschilderte Krise seine eigene Hinwendung an die jüdische Mystik. Immer deutlicher kristallisiert sich Sehnsucht nach Erlösung und Gerechtigkeit heraus, die in der irdischen Immanenz nicht fehlt.
In Hiob und Tarabas entwirft Roth positive Gegenbilder zu den pessimistischen Gesellschaftsanalysen seines Frühwerks. Mendel Singer, insbesondere sein Sohn Menuchim, empfangen den späten Lohn des Gerechten für ein Leben, das Gott länger die Treue hält, als es Gläubigen gewöhnlich gelingt. Auch der raue Soldat Tarabas erfährt am Ende Vergebung und Seelenfrieden. Wenngleich die Melancholie nicht verschwindet, so treten Empörung und Rebellion bzw. Resignation zurück zugunsten einer Sanftmut und Lebensweisheit.
Der biblische Hiob dient Roth als Vorbild für den rechten Umgang mit Leid und lässt den Erzähler trotz offensichtlicher religiöser Skepsis angesichts des Bösen, das auf der Erde geschieht, am Ende zu der Einsicht gelangen, dass es das Göttliche und Gute gibt und ewig geben wird. Nicht zufällig endet Mendels Leben im Aufzug eines Hochhauses irgendwo zwischen Erde und Himmel.
Oberst Tarabas vollzieht eine echte Bekehrung vom gewalttätigen Autokraten zum reuigen Sünder und stirbt friedlich als Mönch, der strenge Beamte Eibschütz gewinnt durch späte Liebe verlorene Menschlichkeit zurück.
Roth verdeutlicht seinen veränderten Standpunkt im Essay Der Antichrist (1934), der eine Schlüsselfunktion besitzt. Moralische Überzeugungen genügen nicht für die härtesten Prüfungen; seine Anklage des Antisemitismus, Migrationsdruck, Assimilationszwang und Duldungspolitik treten in den Hintergrund. Roth sucht liebevoll im Individuum nach Verständnis für das kollektive Scheitern. Geschichte dient als Prüfstein und Anstoß zur Läuterung. Der Antichrist weist humanitären Katastrophen einen klaren biblischen Bezug der Katharsis zu. Roth sucht nach falsch verlaufenen Revolutionen Trost und Hoffnung im religiös irrationalen Bekenntnis zur Monarchie. „Ist das noch Heimat? War ich nicht nur deshalb heimisch in diesem Ort, weil er einem Herrn gehörte, dem ebensoviele unzählige andersartige Örter gehörten, die ich liebte? Kein Zweifel! Die unnatürliche Laune der Weltgeschichte hat auch meine private Freude an dem, was ich Heimat nannte, zerstört. Jetzt sprechen sie ringsum und allerorten vom neuen Vaterland. In ihren Augen bin ich ein sogenannter Vaterlandsloser. Ich bin es immer gewesen. Ach!“ Es gab einmal ein Vaterland, ein echtes, nämlich für die Vaterlandlosen, das einzig mögliche Vaterland. Das war die alte Monarchie. Nun bin ich ein Heimatloser, der die wahre Heimat der ewigen Wanderer verloren hat.“44
Roth glaubt nicht an Gottes Allmacht, seine Gerechtigkeit und eschatologisches Heil. Er hält es jetzt für eine dienliche Notwendigkeit, an das Gute im Menschen und auch in sich selbst zu glauben. Daran, dass es für alle eine Heimat geben muss, wenn nicht auf der Erde, so doch im Herzen, das er einen blinden Spiegel heißt. Was seinen Spätwerk in zunehmenden Maße anhaftet, ist die Aufarbeitung der Habsburger Monarchie durch Fatalismus und Dekadenz. Untrennbar von Roths religiösem Bekenntnis sehen viele Kritiker sein nostalgisches Heimweh zur untergegangenen Dynastie als Flucht in die Mystik.
Über sein berühmtestes Werk sagt der Autor: „Ich habe die merkwürdige Familie der Trottas, von denen ich in meinem Buch Radetzkymarsch berichten will, gekannt und geliebt, die Spartaner unter den Österreichern. An ihrem Aufstieg, an ihrem Untergang glaube ich den Willen jener unheimlichen Macht erkennen zu dürfen, die am Schicksal eines Geschlechts dasjenige einer historischen Gewalt deutet."
Der Roman enthält mystische Momente wie den Duft von Reseda, doch er liefert eine klare Bestandsanalyse und ohne Theorie auch Gründe für den Untergang. Er bewegt sich zwischen Mechanismen einer Chronik und Beteiligung eines Betroffenen. In dem Scheitern Trottas liegt auch Unfähigkeit zu einem neuem Leben außerhalb dem Vielvölkerreich Österreich-Ungarn.
Die folgenden Romane Das falsche Gewicht, Die Kapuzinergruft, Die Geschichte von der 1002. Nacht zeigen unmissverständlich auf, warum die charmante, aber morbide Habsburger Monarchie untergehen musste: Sie war zersetzt von Doppelmoral und Scheinheiligkeit, einer Lähmung und Paralyse, die charakteristisch für jede Form von kultureller Agonie ist.
Roth stilisiert den traditionsbeewussten Chronisten, der retardiv, nostalgisch und restaurierend die Schönheit des Verblassens und den Charme der Dekadenz besingt. Wiener Impressionismus, das sind Sittengemälde durch pointierte Beobachtung, Bonmots und Anekdoten. Das ist Caféhausliteratur, ein wenig Märchen, Rauch und Fantasie, ohne im Klischee zu erstarren. Die Trottas dieser Welt, tragen sie auch andere Namen, stehen wie ausgehöhlt und brüchig vor und an den Gräbern. Das religiöse Fundament der Habsburger Gesellschaft ist mit dem Kaiser, den alle kannten und wertschätzen, erloschen, die Auflösung beschlossene Sache. Auf die Erosion folgt: Nichts.
Folgerichtig lässt Roth seine Anti-Helden Trotta, Eibenschütz und Taittinger sehenden Auges willentlich untergehen wie das System, aus dem sie stammen und von dem sie sich niemals lösen können. Neben der süßlich - morbiden Dekadenz, die tanzend und singend zugrunde gehen muss, bergen die k .u. k. Romane den unerfüllbaren Wunsch, die versunkene Heimat als heile Idealwelt mittels literarischer Erinnerung zurück zu erlangen, wie der eingangs zitierte Satz dokumentiert: „Es war eine kalte Sonne, aber es war (m)eine Sonne.“
Neue Sachlichkeit
Die Werke Roths einer bestimmten Richtung oder Gruppierung der zeitgenössischen Literatur wie dem Existentialismus oder Symbolismus zuzuordnen, fällt schwer. Am ehesten noch verbindet man ihn mit der Richtung Realismus der Neuen Sachlichkeit, und diese Zuordnung mag vor allem für seine frühen Romane auch zutreffend sein. So trägt Flucht ohne Ende nicht nur den Untertitel Ein Bericht, im Vorwort versichert der Autor auch: „Ich habe nichts erfunden, nichts komponiert.“ Fakten, Auswertung und das Objektive an die Stelle subjektiver Empfindung zu setzen, charakterisieren diesen Stil.
Allerdings auch Schnörkellosigkeit, bewusster Verzicht des Dekorativen und dies kann einem Poeten nur prosaisch anmuten. So distanziert sich Roth 1930 in seinem Essay „Schluß mit der „Neuen Sachlichkeit“ (erstmals publiziert in der Literarischen Welt); unmissverständlich erteilt er dieser kühlen literarischen Richtung eine Absage. Kalt an sich muss nicht literarisch sein, wie Flaubert paradigmatisch exemplifiziert. Auch schließt Beobachtung Sentimentalität nicht aus.
Roth kritisiert von einem journalistischen Standpunkt aus die Unförmigkeit einer Literatur, die sich auf nackte Tatsachen beschränken will, indem er der Zeugenaussage den (geformten) Bericht gegenüberstellt: „Das Faktum und das Detail sind der Inhalt der Zeugenaussage. Sie sind das Rohmaterial des Berichts. Das Ereignis „wiederzugeben“, vermag erst der geformte, also künstlerische Ausdruck, in dem das Rohmaterial enthalten ist wie Erz im Stahl, wie Quecksilber im Spiegel.“45
Roth wirft den Autoren der Neuen Sachlichkeit vor, die Erwartung des naiven Lesers zu ignorieren: „Der primitive Leser will entweder ganz in der Wirklichkeit bleiben oder ganz aus ihr fliehen“. Damit rechtfertigt er seine Vorliebe für das subjektiv Authentische des Augenzeugen. Nackte Zahlen lernt man aus dem Geschichtsbuch, Mitgefühl nur aus dem Erleben. Der Journalist weiß um die Problematik der Objektivität, die Arbeit, aus Einzelaussagen einen neutralen Bericht zu formen: „Erst das „Kunstwerk ist echt wie das Leben … Der Erzähler ist ein Beobachter und ein Sachverständiger. Sein Werk ist niemals von der Realität gelöst, sondern in Wahrheit (durch das Mittel der Sprache) umgewandelte Realität.“
2. Erzählungen
Die frühesten Erzählungen bzw. Novellen Roths entstehen unmittelbar vor dem Krieg, Der Vorzugsschüler (November1916 im Wiener Blatt erstmals publiziert) oder danach Barbara (April 1918 im Wiener Blatt). Sie enden jeweils mit dem Tod ihres angepassten Protagonisten, der im Leben dem Glück hinterherläuft und durch eine Lebenslüge sich selbst verleugnet. Auch die dritte Erzählung April. Die Geschichte einer Liebe (1925, Berlin, Dietz Verlag), in der sich ein Dichter um eine mögliche Liebe bringt, finden hier keine Berücksichtigung.
2. 1. Der blinde Spiegel
2. 1. 1. Entstehung, Inhalt
Der blinde Spiegel, in 19 Kapitel unterteilt, erscheint 1925 in Berlin bei Johann Heinrich Wilhelm Dietz in Berlin, der nach dem Tod des Herausgebers gerade mit der Zeitschrift Vorwärts fusioniert. Der etablierte Verlag publiziert sozialistische Autoren wie Mehring, Marx/Engels, Lassalle und Kautsky. Roth schiebt seine Prosa zwischen journalistische Reiseberichte (sein Broterwerb) ein. Nach Barbara wählt Roth in Fini eine weibliche Hauptfigur zur wehrlosen Protagonistin seiner Auseinandersetzung mit einer bedrohlichen und gewalttätigen Gesellschaft. Sprachlich vollzieht sich das auf der Basis von neoromantischer Prosalyrik, deren Zärtlichkeit des Tonfalls mit trostlose desillusionierendem Inhalt kontrastiert.
Das Wiener Madl Fini, um 1900 geboren, ist 18 Jahre alt, als ihr Vater traumatisiert aus dem Krieg heimkehrt. Dem schüchternen Mädchen schenkt niemand viel Aufmerksamkeit. Sie arbeitet als Stenotypistin und verliebt sich in den Geiger Ludwig, obschon sie weiß, dass dieser bereits ihre ältere Schwester verführt, zur Abtreibung gezwungen und danach verlassen hat. Auf Dauer vermag sie seinem sexuellen Drängen und seinen „dunkelvioletten Tönen“ nicht zu widerstehen und gleicht einem Mantel, der irgendwann doch von der Garderobe genommen werden muss. Als sie die Schwäche des vermeintlichen Raubtiers im Mann durchschaut, etwa den Geiz einer Petroleumlampe, wendet sie sich von ihm ab, kann aber nach Verlust ihrer Unschuld nicht mehr viel erwarten. Auf den Musiker folgt eine Beziehung zu dem politischen Redner Rabold, die gleichfalls enttäuschend verläuft. Am Ende geht Fini, weil sie in den Himmel will, in die Donau, dem Wiener Pendant zum mythischen Fluss Lethe.
2. 1. 2. Zwischen Fatalismus und Defätismus
„Die kleine Fini saß auf einer Bank im Prater und hüllte sich gut in die gute bergende Wärme des Apriltages“46 Der Anfang ist typisch, weil er einen Ort und eine Zeit nennt. Meist beginnen Roths Geschichten im Frühling, die Welt ist zu diesem Zeitpunkt noch in Ordnung und verspricht noch besser zu werden.
Fini ist nicht nur physisch klein, sondern auch psychisch. So verliert sie sich ängstlich in den Straßen der großen Stadt. Roth beschreibt eine Reihe von Besonderheiten seiner Zeit, die zudem von symbolischer Bedeutung sind wie das Laternenentzünden mit langer Stange, dem auch im selben Jahr Kurt Tucholsky mit einem poesievollen Artikel würdigt.47
Grundlegend bietet die Erzählung mit dem vorhersehbaren Ende drei Lesevarianten, die sich nicht exkludieren: Fatalismus, Defätismus und Sozialismus. Fatalismus beinhaltet den Glauben an das Wirken einer höheren Macht, meist in göttlicher Form vorgestellt, dem das Individuum ausgeliefert bleibt. Fini vermag sich nicht zu wehren und ist daher zum Opfer bestimmt. Von Anfang an empfindet sie das Morgen und Übermorgen als ein Grauen, als Bedrohung und schwarze Schatten. Sie verkörpert Ohnmacht und Angst; Rettung scheint ihr nur in Begleitung und schützender Umarmung eines Mannes, eines Liebhabers, möglich. Im Unterschied zum Determinismus, der von selbst verschuldeten Ursachen und Wirkungen ausgeht und sich meist auf die Vergangenheit bezieht, wohingegen der Fatalist nur die Zukunft im Blick hat, scheint Fini schuldlos in diese Welt hineingefallen und gleich einem Insekt nicht mehr den Weg aus der Flasche zu finden. Roth liefert keine Hinweise, die auf einen sozialen Determinismus schließen lassen; seine Formulierung lautet „zwischen dem Unglück und seinen schrecklichen Folgen.“
Defätismus beinhaltet Resignation, die entweder erfahrungsbedingt oder selbstkonditioniert ist. Vor allem Frauen haben um die Jahrhundertwende weniger Selbstbewusstsein als Männer, sehen sich im Patriarchat als unterlegen an und können sich meist nur in ihr Schicksal fügen; dazu zählen Zwangsehe, kein Recht auf Arbeit und moralische Vorverurteilung bei Verlust der Jungfräulichkeit. Soldaten, die im Krieg Skepsis am Sieg äußerten, galten als Defätisten.
Finis Minderwertigkeit kommt an mehreren Stellen zum Ausdruck, etwa beim Stenographieren „Es war, als hatte man ein verrücktes, wirbelndes Rad zu stenographieren; große, bunte Rader kreisten, wuchsen violett und rot gerändert aus dem Papier.“48
Die Furcht einen der begehrten Arbeitsstellen zu verlieren ist im Wien der Nachkriegszeit groß. Dass Fini überhaupt arbeiten darf, verdankt sie dem Umstand, dass ihr Vater Kriegsinvalide ist und die Rente nicht ausreicht. Die unterlegene Rolle der Frau im Rollenverständnis des Mannes kommt deutlich zum Tragen. Fini vollzieht nur schwer die Entwicklung zur heranwachsenden Frau bis. Das pubertierende Mädchen fixiert immer nur die Erwartungshaltung ihrer nächsten Umgebung. Sie fürchtet sich vor ihrem Chef und fremden Straßen, vor ihrer erwachenden Sexualität. Männer sind für sie gefährliche Raubtiere, denen die Frau willenlos erliegen muss, zumal sie das Schicksal der verführten und verlassenen, durch eine Abtreibung beinahe ums Leben kommenden Schwester erlebt. Schließlich aber lässt sie sich vom selben Geiger verführen, weil sie seinem Begehren „der dunkelvioletten Töne“ nicht widersteht.
Die Frau ist devotes Opfer, zum Verzicht (erst dem Vater, später dem kranken und erblindeten Gatten gegenüber und zuletzt einem politisch Verfolgten) bereit oder zu absoluter Hingabe gegenüber dem Mann verpflichtet. Immer ordnet sie sich seinen Interessen, seinem Willen unter analog Nietzsche: „Das Glück des Mannes heißt: Ich will. Das Glück des Weibes heißt: Er will.“49
Bei Roth heißt es: „Die Männer sind aus einer ganz anderen Welt als wir kleinen Mädchen, sie sind klug, stark und stolz, sie lernen viel und wissen viel, sie suchen die Gefahren, und durch die Straßen gehen sie herrschend, und ihrer ist, was sie sich wünschen, die Hauser, die Bahnen, die Frauen und die ganze Stadt.“50
Ehelos ist für die Frau ein Synonym zu mit ehrlos, besonders im Patriarchat.
Roths Stil unterscheidet sich in von dem Zweigs, doch es finden sich zeittypische und daher vergleichbare Phänomene: Untergangsstimmung, Dominanz der männlichen Sexualität, weibliche Furcht und Schamgefühl, Abhängigkeit bis hin zur Hörigkeit der Frau vor dem Mann, seinem Beruf, seiner Rolle als Ernährer und seinem sozialen Stellenwert.
Roth schildert die animalische Brutalität, die junge keusche Frauen bei der körperlichen Annäherung der Männer empfinden. Fini erscheint traumatisiert und hypnotisiert, nicht vorbereitet auf die Rolle einer Frau. Wie die meisten Kinder ihrer Zeit wird sie nicht aufgeklärt un wächst in einer Atmosphäre der Angst heran. Eine vergleichbare Erzählung liefert Stefan Zweig in Die Liebe der Erika Ewald (1904), in der eine junge enttäuschte Frau vor dem Suizid durch einen Zufall gerettet wird. Veränderung im Innenleben weiblicher Seelen, die zur Lebensunfähigkeit, in Roths Fall in den Suizid führt, sind nahezu identisch. Viele junge Frauen, sehen sich unterdrückt und stehen dieser Form der Gewalt sprachlos gegenüber. Ihre Machtfantasien übertragen sie meist auf selbstbewusste Männer; Fini stellt dabei keine Ausnahme dar.
Die ontische Problematik, das eigene Sein durch Armut, Tugend und Redlichkeit zu bewahren, dominiert. Zwar ist Fini auch Opfer ihrer existentiellen Armut, ausgelöst durch Österreichs Niederlage im Ersten Weltkrieg, doch die Konzentration liegt auf ihrer Infantilität. Die Kluft zwischen männlichem und weiblichem Eros scheint unüberbrückbar; die Verletzlichkeit und Sensibilität der werdenden Frau wird nicht nur bedroht, sie wird zerstört. Die zentrale Frage lautet: welche Veränderung ist in einem rigiden Rollenverständnis möglich?
Der Historiker Philipp Blom, der die Weltuntergangsstimmung vor dem Ersten Weltkrieg analysiert, antwortet: „Anstatt draußen ... hatte sich diese Veränderung im Inneren vollzogen, in den Häusern und Köpfen.“51
Roths Erzählung widerspiegelt die Verunsicherung, in welche Richtung die Veränderung laufen soll; sie sind „durchzuckt von ungeordneten und unverdauten Informationen ... ein Schrei, der von der Bühne geschleudert wurde.“
Fatalistisch heißt in diesem frühen Stadium Roths nicht religiös, sondern mythisch imprägniert. Fini gleicht mythologisch dem Epimetheus52, der alles zu spät bedenkt und nur in der traulichen Lage des Nachfühlens gefangen bleibt. Der Kern der Lehre, zumindest bei Platon, besteht darin, dass Epimetheus den Menschen schwächt, weil er ihn nackt und wehrlos lässt (damit er den Göttern nicht gefährlich werde) und sein Bruder Prometheus daher das Feuer raubt, ein Privileg, das den Göttern vorbehalten bleiben solle. Wenn Prometheus zum Sinnbild der Hybris und des homo technicus Verwendung findet, dann allegorisiert Epimetheus Verzagen und Dulden bzw. verzögertes Nachdenkenden.
Fini erscheint zu wenig reflektiert, um sich behaupten zu können und erinnert das österreichisch-deutsche Kollektivschicksal, das zum Untergang bestimmt bleibt, weil es all seine Hoffnung auf ein Ereignis setzt, das unmöglich eintreten kann. Für den Fatalismus spricht die Wendung „beschlossen war ihr Schicksal“. An ihrem neunzehnten Geburtstag verlässt sie ihn weinend.
2. 1. 3. Gewalt der Musik und der Sexualität
Vergleichbar mit Zweigs Die Liebe der Erika Ewald ist auch die verführerische, nahezu magische Kraft der Musik, die sich bereits in Konzertbesuchen der heranwachsenden Frau in Begleitung des Malers Ernst ankündigen. „»Die Musik«, sagte Ernst, »enthält alle Geräusche der menschlichen Welt, eingefangen in gesetzmäßige Bindung und gesteigert ins Übermenschliche.«53
Der Einfluss Schopenhauers, der Musik als die metaphysische Inkarnation des absoluten Willens bezeichnet, liegt nahe. „Weil die Musik nicht, gleich allen andern Künsten, die Ideen, oder Stufen der Objektivation des Willens, sondern unmittelbar den Willen selbst darstellt; so ist hieraus auch erklärlich, daß sie auf den Willen, d.i. die Gefühle, Leidenschaften und Affekte des Hörers, unmittelbar einwirkt, so daß sie dieselben schnell erhöht, oder auch umstimmt.“54
Nietzsche spricht von übermenschlicher Kraft der dionysischen Musik, Emotionen zu erzeugen. Als Finis Schwester Tilly beinahe nach dem Eingriff einer Engelmacherin stirbt, entdeckt sie Fini das Geheimnis: „Ein Tier ist der Mann, wenn er zu uns kommt und wenn er uns verläßt. Wenn wir dem eisernen Druck seiner Schenkel nachgeben und wenn er aufsteht, müde und mit nachlässigen Fingern uns das Kleid zuhakt.“55
Beide aufeinanderfolgenden Erlebnisse haben mit dem Rausch der Gewalt affektgesteuerten Trieblebens zu tun, der sich die Frau wehrlos ausgesetzt sieht. Folglich koinzidiert beides in der Person des Geigers Ludwig; er erscheint ihr wie eine Naturmacht (Raubtier), ein Gast in ihr und zugleich ein neues zu Hause. „An uns vorbei schreiten die jungen Mädchen, noch nicht gezeichnet vom bitteren Geschmack, vor ihnen die kommenden Tage, leuchtend und frisch wie niemals betretene Rasen.“
Ihre Desillusionierung ist der Anfang vom Ende. Sie lernt den Sozialisten Rabold kennen, auf die Musik folgt die Rede, mythisch auf die alte die neue Klage, auf die dionysische Lyra die apollinische in Flöte. Musik bleibt das Grundmotiv: der durch Kanonendonner schwerhörige Vater kann wie durch ein Wunder wieder hören, noch einmal atmet Fini Glück: „Der Ton einer abendlichen Flöte kam, im Ufergras zirpten die Grillen.“
Glück der Zweisamkeit gibt es bei Roth nie. Rabold verschwindet spurlos und kommt nicht zurück. Allein und verlassen, gleitet Fini auf Wolken aus, fällt in den Fluss, ertrinkt, weil niemand mehr da ist, um sie zu retten. In Finis Gang zur Donau zeichnet sich allegorisch bereits das Ende der Donaumonarchie ab. Mit ihr stirbt das junge Leben, alle Hoffnung scheidet aus der Zukunft.