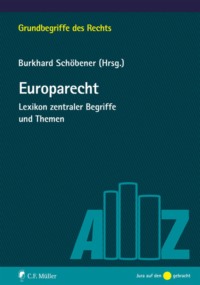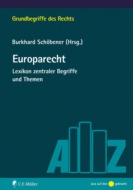Kitabı oku: «Europarecht», sayfa 37
1. Ziel des EGKS-Vertrags
888
Das Ziel des EGKS-Vertrags lag im Wesentlichen darin, durch die Integration der Grundstoff- oder auch Schlüsselindustrien künftige kriegerische Auseinandersetzungen speziell zwischen Deutschland und Frankreich technisch unmöglich zu machen. Vor dem Hintergrund des sich anbahnenden und verschärfenden Kalten Krieges zwischen den USA und der UdSSR sollte Westdeutschland eng an die Staaten Westeuropas gebunden werden. Zugleich sollte Deutschland die Kontrolle über seine – damals kriegswichtige – Kohle- und Stahlindustrie entzogen werden, ohne dafür weiter auf als diskriminierend empfundene Kontrollen zurückgreifen zu müssen, die einer „Westbindung“ auch der Köpfe und Herzen der Deutschen wohl entgegengestanden hätten.
889
Obwohl es auch nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland am 23.5.1949 (eben bis zum Beginn der Montanunion) bei der Kontrolle der Kohle- und Stahlproduktion durch die Internationale Ruhrbehörde (International Authority for the Ruhr, IAR) in Gemäßheit des Ruhrstatuts vom 18.4.1949 blieb, regten sich in Frankreich bald Ängste vor einem schnellen Aufstieg der deutschen Wirtschaftsmacht infolge der anwachsenden deutschen Stahlproduktion. Auch hierauf reagierte der Schuman-Plan. Dass auch Konrad Adenauer die Initiative zur Gründung der EGKS lebhaft begrüßte, lag freilich an der von ihm gesehenen Möglichkeit, nach dem Elend der unmittelbaren Nachkriegszeit und den im Ruhrgebiet noch bis 1949/50 teilweise erfolgten Demontagen (zur Erbringung von Reparationsleistungen) wieder Wirtschaftswachstum zu ermöglichen, wozu insbesondere Absatzmärkte für deutschen Stahl im europäischen Ausland eröffnet werden mussten. Das Denken Konrad Adenauers kreiste stets um die Wiedergewinnung der vollen staatlichen Souveränität Deutschlands – diese war allerdings unter den gegebenen Umständen nur langsam und schrittweise und nur in stetem Einvernehmen mit den Westmächten und den europäischen Nachbarn zu erreichen.
890
Früher ordneten manche Historiker die Geschichte der Montanunion noch dahingehend ein, dass sie keine wesentliche Neuerung gewesen sei. Denn sie habe lediglich die zentraleuropäischen Stahlkartelle der Zwischenkriegszeit fortgesetzt, die der Selbstbehauptung deutscher, französischer, belgischer und luxemburgischer und später auch anderer mitteleuropäischer Stahlproduzenten gegenüber den britischen und US-amerikanischen Produzenten und der Abwehr von Preisdumping hatten dienen sollen (z.B. die Internationale Rohstahlgemeinschaft von 1926). Dies wird von der neueren Forschung ganz überwiegend zurückgewiesen. Denn bei diesen Produktions- und Exportkartellen der Zwischenkriegszeit handelte es sich nicht um zwischenstaatliche, sondern um rein privatrechtsförmige Einrichtungen, die allein für die beteiligten Wirtschaftsunternehmen vorteilhaft sein sollten und keinerlei idealistische oder überhaupt politische Zielsetzung verfolgten.
2. Monnet-Plan und Schuman-Plan
891
Jean Monnet war 1946-50 Leiter des französischen Planungsamtes, danach Vorsitzender der Pariser Konferenz, die die Pariser Verträge aushandelte und dann 1952-55 Präsident der Hohen Behörde der EGKS. Der Plan Monnet hatte einen massiven Ausbau der französischen Stahlindustrie vorgesehen, die der britischen gleichziehen und – nicht zuletzt mit Hilfe einer Millionen deutscher Kriegsgefangener, also Zwangsarbeiter – im Jahr 1953 etwa 15 Millionen Tonnen Rohstahl produzieren sollte. Da dies die Inlandsnachfrage weit übersteigen würde, war der Export von mindestens 3 Millionen Tonnen Stahl nach Deutschland vorgesehen, dessen Stahlproduktion zugleich auf 7,5 Millionen Tonnen beschränkt werden sollte; schon von daher war ein gemeinsamer Stahlmarkt erforderlich. Die französischen Pläne, das Ruhrgebiet (wie bereits das Saarland mit seinen Kohlevorkommen bis 1957) am besten zu annektieren bzw. in ein französisches Protektorat zu verwandeln, scheiterten jedoch bereits, als die Briten in ihrer Besatzungszone 1946 das Bundesland Nordrhein-Westfalen gründeten, denn seither war das Ruhrgebiet eben im Prinzip wieder deutsch und trotz der internationalen Kontrolle der Kohle- und Strahlproduktion nicht als solches internationalisiert (wie es die Sowjetunion verlangt hatte) und erst recht nicht französisch.
892
Robert Schuman (französischer Außenminister 1948-52) hat den Schuman-Plan zur Gründung der EGKS in einer Rede 1950 als die Fortsetzung des Monnet-Plans, um den französischen Stahlexport zu erleichtern, bezeichnet. Daran ist richtig (die Rede wurde auf einer Gewerkschaftstagung in Metz gehalten und diente der Mobilisierung französischer Zustimmung zur europäischen Integration), dass der Schuman-Plan an die Stelle des ursprünglichen Monnet-Planes treten musste, nachdem dieser durch den Wegfall seiner wesentlichen Prämissen gescheitert war. Die faktische und politische (wenn auch freilich nicht völkerrechtliche) Zerschlagung des Deutschen Reiches im Zweiten Weltkrieg hatte nicht zu einem Wiederaufstieg Frankreichs als der wesentlichen Zentralmacht Europas geführt. Frankreich, das mit dem raschen Wiederaufbau der deutschen Stahlindustrie nicht gerechnet hatte, bedurfte zu seinem eigenen Wiederaufbau deutscher Rohstoffe; und angesichts der Eskalation des Kalten Krieges und der sich bereits abzeichnenden deutschen Wiederbewaffnung schon vor dem Hintergrund des Korea-Krieges (seit Juni 1950) konnte die Schwächung Westdeutschlands nicht mehr wesentliches Ziel der europäischen Nachkriegspolitik bleiben. Als Konstante blieb jedoch der französische Wunsch, jedenfalls Großbritannien aus Kontinentaleuropa herauszuhalten; an die Stelle des Großmachtstrebens Frankreichs trat nun das Ziel der Gewinnung von Sicherheit vor und mit Deutschland kraft Internationaler Organisationen.
893
Hinzu kam noch, dass sich die Bundesrepublik Deutschland 1950 in Aufnahmeverhandlungen zum Europarat befand, wobei Frankreich v.a. darauf drängte, dass insofern gleichzeitig zwei neue Mitglieder – nämlich die Bundesrepublik und das autonom gedachte Saarland, das ein französisches Protektorat war – beitreten sollten. Mit seiner Zustimmung zum Schuman-Plan tauschte Adenauer gewissermaßen das Saarland (einstweilen) gegen die Aufhebung wirtschaftlicher Beschränkungen für die westdeutsche Schwerindustrie und die Wiedererlangung von Exportmärkten. Dabei dürfte auch die Erwägung einer Rolle gespielt haben: „[D]a Bonn über nationale Souveränität noch nicht verfügte, bedeutete Supranationalität an sich keinen Verzicht“ (Ludolf Herbst). Aus französischer Sicht war die Montanunion „Supranationalität ohne Großbritannien“ (Wilfried Loth). Supranationalität sollte die eigentliche Methode sein, um zu verhindern, dass Deutschland i.R.d. nun anzustrebenden westeuropäischen Einigung seine Großmacht- und Hegemonialpolitik wieder aufnehmen oder sich am Ende gar zwecks Erlangung der deutschen Einheit mit der Sowjetunion verbrüdern würde.
3. Weitere Entwicklung der Montanunion
894
In ihrer Anfangsphase führte die EGKS faktisch zu einer vorwiegenden Zuständigkeit der europäischen Ebene für die Energiepolitik, da zunächst 90 % der Energieversorgung aus dem integrierten Kohlebereich bestritten wurden. Erst die später eintretende, erhebliche Steigerung des Energieverbrauchs und die damit einhergehende maßgebliche Erhöhung des Erdölanteils am Gesamtverbrauch marginalisierten die energiepolitische Steuerungsfähigkeit der Gemeinschaftsebene dann wieder. So hatte im Jahr 1955 die Kohle noch 80 % des westdeutschen Energiebedarfs gedeckt, 1965 hingegen waren es nur noch 42 %; 41 % entfielen schon auf Erdöl. 1967 ging die Hohe Behörde der EGKS (s.u. Rn. 895–901) in der EG-Kommission auf, nachdem infolge des EG-Fusionsvertrages von 1965 (vorbereitet bereits durch das Fusionsabkommen von 1957) die Organe der EGKS, der EWG (→ Europäische Union: Geschichte) und der → Europäische Atomgemeinschaft (EAG) vereinheitlicht und diese Gemeinschaften mithin zu den Europäischen Gemeinschaften verschmolzen worden waren (→ Europäische Union: Geschichte). Durch das Auslaufen der EGKS am 23.7.2002 ist auch das spezielle Kartellrecht des EGKS-Vertrages (das von Rechtshistorikern übrigens seinerzeitigen US-amerikanischen Einflüssen zugeschrieben wird) weggefallen. Daher unterfiel die Kohle- und Stahlproduktion seither den allgemeinen Kartell-, Wettbewerbs- und Subventionsregeln des EGV/EUV und seit 2009 dem AEUV.
E › Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) (Ulrich Vosgerau) › III. System und Arbeitsweise der EGKS
III. System und Arbeitsweise der EGKS
895
Der 5. Erwägungsgrund in der Präambel des EGKS-Vertrages lautet: „[Die Vertragsparteien sind] Entschlossen, an die Stelle der jahrhundertealten Rivalitäten einen Zusammenschluss ihrer wesentlichen Interessen zu setzen, durch die Errichtung einer wirtschaftlichen Gemeinschaft den ersten Grundstein für eine weitere und vertiefte Gemeinschaft unter Völkern zu legen, die lange Zeit durch blutige Auseinandersetzungen entzweit waren, und die institutionellen Grundlagen zu schaffen, die einem nunmehr allen gemeinsamen Schicksal die Richtung weisen können.“ Aber wie genau sollten die „institutionellen Grundlagen“ beschaffen sein, die den „Zusammenschluss der Interessen“ bewirken? Diese Frage hat das weitere Unionsrecht seither geprägt, und sie ist letztlich bis heute nicht wirklich entschieden.
1. Integrationsmethode und Unionsmethode
896
Für die Montanunion jedoch war die Entscheidung klar: Ein neues politisches Gemeinwesen sollte schrittweise über die Vergemeinschaftung zunächst konkreter und beschränkter, anfänglich eben nur wirtschaftlich-sektorieller Aufgaben errichtet werden (→ Europäische Union: Geschichte). Die Vergemeinschaftung erfolgte dabei nach der Mèthode Monnet – diese Bezeichnung mag präziser sein als die hergebrachte Bezeichnung Integrationsmethode, denn um Integration geht es ja auch der konkurrierenden Unionsmethode, die auf institutionalisierter Zusammenarbeit der Regierungen beruht –, d.h. durch Errichtung einer zentralen Oberbehörde mit sektoriell umfassender Kompetenz zur Exekutivrechtsetzung. Um Unabhängigkeit dieser nur den Unionsinteressen, nicht aber den Interessen einzelner Mitgliedstaaten verpflichteten Behörde sicherzustellen, verfügte die EGKS (anders als die EAG und die EWG) bereits über ein besonderes System der autonomen Mittelbeschaffung in Gestalt der (seit 1998 dann abgeschafften) EGKS-Umlage, d.h. faktisch einer Steuer für Kohle- und Stahlunternehmen, die unmittelbar der Hohen Behörde zukam, und war insofern von der fortlaufenden Mittelzuweisung durch die Mitgliedstaaten bereits unabhängig.
897
Nach der Schaffung der EGKS mitsamt ihrer Hohen Behörde (Haute Autorité; High Authority) unter der Leitung Jean Monnets erschraken die europäischen Regierungschefs allerdings bald über die Eigenständigkeit dieser Montanunion, die den Einfluss der nationalen Regierungen im Energiesektor vorübergehend effektiv ausschaltete. In der Konsequenz wurden EWG und EAG anders konstruiert als die Montanunion, nämlich nach der sog. Unionsmethode: Hier nimmt dann ein Ministerrat die zentrale Stellung des Gesetzgebungsorgans ein, die Kommission (und nicht mehr Hohe Behörde) wird zur nachgeordneten Verwaltungsbehörde mit Organisations- und Vorbereitungsaufgaben. Freilich ist dabei auch zu berücksichtigen, dass der EGKS-Vertrag in erster Linie ein traité de règles (Gesetzesvertrag) war, den es v.a. auszuführen galt, wohingegen der EWG-Vertrag als traité cadre (Rahmenvertrag) viel stärker eine ihn erst ausfüllende Sekundärgesetzgebung nach sich ziehen sollte. Die EGKS war primär Verwaltungsgemeinschaft, die EWG eher Gesetzgebungsgemeinschaft.
2. Organe der Montanunion
898
Die Organe der Gemeinschaft waren gem. Art. 7 EGKSV die Hohe Behörde (Art. 8–19 EGKSV; seit dem Fusionsvertrag dann die EG-Kommission), der Beratende Ausschuss (später der → Wirtschafts- und Sozialausschuss), die Gemeinsame Versammlung (später das → Europäische Parlament), der → Rat (Ministerrat), der EGKS-Gerichtshof (später der Gerichtshof der EU, → Gerichtssystem der EU, Rn. 1504 ff.) und der Rechnungshof. Die Hohe Behörde nahm unter diesen Institutionen eine herausragende Stellung ein und bestand aus neun Mitgliedern, von denen acht, einschließlich des Präsidenten, von den Mitgliedstaaten „im gemeinsamen Einvernehmen“ ernannt und eines von diesen Mitgliedern mit einfacher Mehrheit hinzuoptiert wurde; sie waren unabhängig von Weisungen. Die parlamentarische Verantwortlichkeit gegenüber der Gemeinsamen Versammlung aus Delegierten der nationalen Parlamente war marginal. Ein umfassendes Stellungnahme- und Anhörungsrecht kam jedoch dem Beratenden Ausschuss zu, der aus bis zu 51 Vertretern jeweils gleicher Anzahl der Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Verbraucher/Händler bestand; wegen der Möglichkeit der Mitwirkung im Beratenden Ausschuss hatte der DGB die Position der SPD, die die Montanunion ablehnte, aufgegeben und bei der Pariser Vertragskonferenz 1950/51 schließlich für die Montanunion optiert.
899
Wichtigstes Beratungs- und Kooperationsorgan der Hohen Behörde war aber der Rat mit Anhörungsrecht und Initiativfunktion (die Hohe Behörde musste seine Vorschläge freilich nur „prüfen“, im Allgemeinen aber nicht zwangsläufig umsetzen). Bei Entscheidungen der Hohen Behörde, die sich über den Montansektor hinaus unmittelbar auf die Handels-, Wirtschafts- und Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten auswirkten, bedurfte sie der Zustimmung des Rates, die aber in der Regel mit einfacher Mehrheit erfolgte. Eine Zweidrittelmehrheit im Rat erforderte die Verhängung von Repressalien der Hohen Behörde gegen einen pflichtwidrig handelnden Mitgliedstaat. Anders als später in der EWG waren Klagen der Hohen Behörde gegen einen Staat noch nicht vorgesehen.
3. Aufgaben und Tätigkeit der Montanunion
900
Die Montanunion war ein eigenständiges Völkerrechtssubjekt und hatte in ihren Mitgliedstaaten als juristische Person volle Rechts- und Geschäftsfähigkeit. Durch die EGKS wurden alle Binnenzölle aufgehoben und Maßnahmen gleicher Wirkung untersagt. Ungleichbehandlungen im Hinblick auf Preise und Lieferbedingungen wurden verboten, jedem Käufer musste in der Gemeinschaft freier und gleicher Warenzugang gewährleistet werden.
901
Die EGKS war jedoch noch keine Zollunion; innerhalb von Mindest- und Höchstgrenzen konnten die Mitgliedstaaten Zolltarife gegenüber Dritten nach wie vor selbst festsetzen. Nichtsdestotrotz wurden bis 1958 faktisch gleiche Außenzolltarife erreicht. Auch sah die EGKS bereits Arbeitnehmerfreizügigkeit im Montanwesen vor. Zur Kontrolle und Aufrechterhaltung des freien Wettbewerbs sollte die Hohe Behörde (und später die Kommission), die ohnehin Märkte und Preise ständig beobachtete, nach den Umständen des Einzelfalles in den Markt und die Erzeugungsbedingungen eingreifen. Weitere Aufgaben der Hohen Behörde waren die Investitionsförderung durch günstige Kredite sowie eine umlagefinanzierte Sozialpolitik, um Veränderungen infolge des montanen Strukturwandels sozial abzufedern. Weiterhin förderte die Hohe Behörde (und später die Kommission) die technische und wissenschaftliche Forschung im Montanwesen. In Krisensituationen gehörte auch die Festlegung etwa von Höchst- oder Mindestpreisen und Produktionsquoten sowie die Bewilligung von Ausgleichszahlungen an Unternehmen, die wegen hoher Kosten durch relativ geringe Höchstpreise in eine Schieflage geraten würden, zu den Aufgaben der Hohen Behörde.
E › Europäischer Gerichtshof (EuGH) (Nico S. Schmidt)
Europäischer Gerichtshof (EuGH) (Nico S. Schmidt)
I.Historische Entwicklung903
II.Zusammensetzung und Organisation904 – 930
1.Richter905 – 912
a)Ernennungsvoraussetzungen906 – 908
b)Ernennungsverfahren909, 910
c)Amtsdauer911, 912
2.Generalanwälte913
3.Besondere Ämter914 – 922
a)Präsident und Vizepräsident915, 916
b)Berichterstatter917, 918
c)Kanzler919 – 922
4.Generalversammlung923
5.Spruchkörper924 – 930
a)Kammern mit drei oder fünf Richtern925
b)Große Kammer926 – 928
c)Plenum929
d)Wirksamkeit der Spruchkörperentscheidungen930
III.Aufgaben und Zuständigkeiten931
Lit.:
A. Arnull, The European Court of Justice after Lisbon, 2012; L. Bauer, Der Europäische Gerichtshof als Verfassungsgericht?, 2008; G. Hirsch, Der Europäische Gerichtshof – Eine Ansicht von innen, MDR 53 (1999), 1; U. Klinke, Der Gerichtshof der EU – Ein Portrait, ZEuP 3 (1995), 783; A. P. Müller, Der europäische Gerichtshof im Spannungsfeld von Subsidiarität und Integration, 1996; D. Siebert, Die Auswahl der Richter am Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften: zu der erforderlichen Reform des Art. 167 EGV, 1997.
902
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) ist die oberste rechtsprechende Institution der EU. Die Rechtsmaterien seiner Rechtsprechung sind sehr unterschiedlich. Er weist insofern sowohl Merkmale eines obersten Zivil-, Straf-, Verwaltungs-, Arbeits-, Sozial- oder Finanzgerichts als auch eines Verfassungsgerichts auf. In seiner rechtsprechenden Tätigkeit wird der EuGH durch das → Gericht der EU (EuG) und mögliche → Fachgerichte unterstützt. In den Vertragstexten wird der EuGH ausschließlich als Gerichtshof bezeichnet. Terminologisch darf er daher keinesfalls mit dem Rechtsprechungsorgan Gerichtshof der EU verwechselt werden (→ Gerichtssystem der EU).
E › Europäischer Gerichtshof (EuGH) (Nico S. Schmidt) › I. Historische Entwicklung
I. Historische Entwicklung
903
Die Errichtung eines europäischen Gerichtshofs wurde erstmalig durch die Unterzeichnung des Vertrages über die Gründung der → Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS-Vertrag) am 18.4.1951 beschlossen. Als eines der vier Organe nahm der EGKS-Gerichtshof im Jahre 1952 seine Arbeit auf und ist als Vorgänger des heutigen EuGH zu sehen. Die Aufgaben und Kompetenzen des EuGH waren dabei einem stetigen Angleichungsprozess an neue Vertragstexte und beitretende Mitgliedstaaten unterworfen (→ Europäische Union: Geschichte), so dass der EuGH heute nur noch einen Teil des Organs Gerichtshof der EU darstellt.
E › Europäischer Gerichtshof (EuGH) (Nico S. Schmidt) › II. Zusammensetzung und Organisation
II. Zusammensetzung und Organisation
904
Die grundsätzliche Zusammensetzung und Organisation des EuGH ist in Art. 19 Abs. 2 EUV und Art. 251–253, 255 AEUV geregelt. Details ergeben sich zum einen aus der EuGH-Satzung und zum anderen aus der EuGH-VerfO.
1. Richter
905
Gem. Art. 19 Abs. 2 UAbs. 1 EUV besteht der EuGH aus genau einem Richter je Mitgliedstaat. Indem jeder Mitgliedstaat an der Zusammensetzung des EuGH beteiligt ist, kann sichergestellt werden, dass die Besonderheiten aller mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen in ausreichendem Maße berücksichtigt werden. Dies soll die Akzeptanz der Urteile des EuGH unter den EU-Bürgern stärken.
a) Ernennungsvoraussetzungen
906
Die Ernennungsvoraussetzungen eines Richters am EuGH ergeben sich aus Art. 253 AEUV. Sie sind mit denen eines → Generalanwaltes identisch. Um ernannt werden zu können, müssen die Richter sowohl persönliche als auch fachliche Anforderungen erfüllen. Nach Art. 253 UAbs. 1 AEUV wird erwartet, dass die Richter in persönlicher Hinsicht jede Gewähr für ihre Unabhängigkeit bieten. In fachlicher Hinsicht ist nur geeignet, wer in seinem Mitgliedstaat entweder die für die höchsten richterlichen Ämter erforderlichen Voraussetzungen erfüllt oder Jurist von anerkannt hervorragender Befähigung ist.
907
Gelten für die Besetzung der höchsten richterlichen Ämter eines Mitgliedstaates unterschiedliche Voraussetzungen, müssen für die Ernennung zum EuGH-Richter nur die niedrigsten dieser Kriterien erfüllt werden. Deutsche Bewerber haben daher nicht die Voraussetzungen des BVerfG, sondern diejenigen der Obersten Gerichtshöfe des Bundes zu erfüllen. Diese sind nach § 5 DRiG i.V.m. § 125 Abs. 2 GVG (BGH), § 42 Abs. 2 ArbGG (BAG), § 15 Abs. 3 VwGO (BVerwG), § 14 Abs. 2 FGO (BFH) und § 38 Abs. 2 SGG (BSG) ein bestandenes erstes und zweites Staatsexamen sowie die Vollendung des 35. Lebensjahres.
908
Um als Jurist von anerkannt hervorragender Befähigung eingeschätzt zu werden, bedarf es neben überdurchschnittlichen wissenschaftlichen Leistungen oder Prüfungsergebnissen v.a. einer gewissen Reputation. Daher wird es sich in aller Regel um Hochschullehrer im Bereich des Europarechts handeln, die möglichst auch über eine gewisse praktische Gerichtserfahrung verfügen sollten.