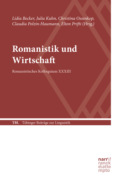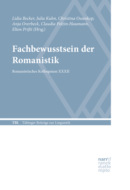Kitabı oku: «Wikipedia und der Wandel der Enzyklopädiesprache», sayfa 4
2.6 Gegenwart und Digitalisierung
Im Verlauf des 20. Jahrhunderts diente die Encyclopædia Britannica zwar immer noch als Modell, der nationale Fokus weitete sich jedoch um eine europäische und internationale Perspektive. Die Gegenwart enzyklopädischer Werke ist durch ein Nebeneinander vielfacher Traditionen geprägt. So entstand von 1970 bis 1978 La Grande Encyclopédie Larousse, eine alphabetische Enzyklopädie, deren Inhalte nicht mehr aktualisiert werden. Bekannt ist das Haus Larousse vor allem für seine enzyklopädischen Wörterbücherenzyklopädisches Wörterbuch. Zu nennen wären hier ältere Werke wie das Grand dictionnaire encyclopédique Larousse (1982–1985) oder der Nouveau Larousse encyclopédique (1998). Ungebrochen ist der Erfolg des Petit Larousse illustré (seit 1905), der einen sprachlichen und einen enzyklopädischen Teil beinhaltet und durch seine reichhaltige Illustrierung einen hohen Unterhaltungswert bietet. Ebenso beliebt sind die enzyklopädischen Wörterbücherenzyklopädisches Wörterbuch des Hauses Hachette wie das Dictionnaire Hachette: langue, encyclopédie, noms propres. Eine reine Enzyklopädie im Stil der Encyclopædia Britannica ist die Encyclopaedia Universalis (ab 1990), die eine gezielte Auswahl von LemmataLemma in handbuchartigen Abhandlungen enthält. Die Artikel stammen von ausgewiesenen Experten, die stellenweise ihre Meinung äußern (cf. Rey 2007: 221). Neben den alphabetischenEnzyklopädie– alphabetische Enzyklopädien erscheinen in Frankreich thematischeEnzyklopädie– thematische Bände, die in einem weiteren Sinne als Enzyklopädien bezeichnet werden können, wie beispielsweise der Quid (1963–2007) oder die Encyclopédie Alpha (1969–1974).
Auch in Italien wurde die Tradition der Enzyklopädien nach der Schaffung nationaler Werke fortgesetzt. Unter anderem wurden Referenzwerke in denjenigen Verlagshäusern produziert, die im 19. Jahrhundert gegründet worden waren, wie beispielsweise die Enciclopedia Hoepli (1955–1968). In den 1970er Jahren entstand die Enciclopedia europea des Hauses Garzanti ebenso wie die experimentelle Enciclopedia Einaudi (1977–1984). Letztere enthält eine sehr selektive Auswahl von Stichwörtern, zu denen philosophische Abhandlungen von Experten gegeben werden (cf. Carnazzi/Fedriga 2002: 71). Ein relativ junges Werk ist Nova. L’enciclopedia UTET aus dem Jahre 2001, die kürzere Einträge und hochwertige Abbildungen beinhaltet. Neben den Enzyklopädien wird in Italien ebenso wie in Frankreich die Tradition der enzyklopädischen Wörterbücherenzyklopädisches Wörterbuch fortgeführt. Die bekanntesten hierunter sind die Werke des Istituto dell’Enciclopedia Italiana und die Enciclopedia Zanichelli: dizionario enciclopedico di arti, scienze, tecniche, lettere (2003).
Die weitere Entwicklung der Enzyklopädien ist eng mit der Entwicklung der Computertechnologie und des World Wide WebWorld Wide Web verbunden. Diese unterzogen den Markt für Enzyklopädien einem tiefgreifenden Wandel, der bis heute andauert. Im Jahre 1985 fand mit Windows 1.0 die erste grafische Benutzeroberfläche für das Betriebssystem MS-DOS Verbreitung und machte somit auch für Laien die Arbeit mit dem Computer attraktiv. Für dieses System sind auch die meisten Enzyklopädien auf CD-ROMEnzyklopädie– auf CD-ROM konzipiert. Als erste Enzyklopädie dieses Typs gilt die Academic American Encyclopedia von Grolier aus dem Jahre 1985, am erfolgreichsten war jedoch Encarta von Microsoft (1993–2009). In der Folge wurden CD-ROM-Ausgaben der etablierten Enzyklopädien erstellt, wie beispielsweise die Encyclopædia Britannica auf CD (1994), die Encyclopaedia Universalis auf CD (1995–2012), die Encyclopédie Multimédia Hachette (1999–2007), die Treccani mit CD, Omnia (bis 2010) und Gedea von de Agostini. Zumeist wurden die CD-Versionen den Printausgaben beigegeben und erweiterten das Angebot um multimediale Inhalte wie Audiodateien, Bilder, Videos und Wörterbücher (cf. Fuertes-Olivera 2013: 1072). Da diese Versionen nach dem Modell der PrintenzyklopädienEnzyklopädie– Print-~ konstruiert wurden, lösen sie keinen Transformationsprozess aus:
encyclopedias on CD-ROM and/or DVD, which have also been called electronic encyclopedias, have not had any real impact on a theory of e-lexicography, as most if not all of them are ‘faster horses’, as Tarp (2011) calls lexicographical works made available on electronic platforms that are constructed by following the theoretical principles developed for elaborating printed reference tools (Fuertes-Olivera 2013: 1070).
Durch die Abschaltung des ARPANets im Jahr 1990 wurde der Weg für das kommerzielle Internet freigegeben. Einer der beliebtesten Dienste ist das World Wide WebWorld Wide Web, das im Frühjahr 1993 entstand und auf Tim Berners-LeeBerners-Lee, Tim zurückgeht. Im Zuge dieser Entwicklung gingen die Verlagshäuser dazu über, Webauftritte für ihre Enzyklopädien zu konzipieren. So sind die Webausgaben der Academic American Encyclopedia ab 1995, der Britannica ab 1995, der Treccani ab 1996 und der Universalis ab 1999 verfügbar, wobei der Zugang häufig über ein Abonnement gekauft werden muss. Die Webausgaben der PrintenzyklopädienEnzyklopädie– Print-~ sind der Web 1.0Web 1.0-Technologie verpflichtet, die noch keinerlei Partizipationsmöglichkeiten beinhaltet. Im Jahre 1995 wurde die Wikitechnologie, eine Web 2.0Web 2.0-Anwendung, erfunden, welche das kollaborativeKollaboration Erstellen und Teilen von Wissensinhalten ermöglicht. Auf dieser Technologie basiert WikipediaWikipedia, die im Jahre 2001 von Jimmy WalesWales, Jimmy und Larry SangerSanger, Larry gegründet wurde und als kollaborative Plattform zur Erstellung einer frei zugänglichen Enzyklopädie konzipiert ist:
Wikipedia is first and foremost an effort to create and distribute a free encyclopedia of the highest possible quality to every single person on the planet in their own language. Asking whether the community comes before or after this goal is really asking the wrong question: the entire purpose of the community is precisely this goal (Wales 2005).
Das nichtkommerzielle Projekt Wikipedia wirkte in der Folge als disruptive Technologie (cf. Flavin 2017: 38), welche die traditionellen PrintenzyklopädienEnzyklopädie– Print-~ aufgrund der Kostenlosigkeit und des einfachen Zugangs fast vollständig aus dem Markt drängte und Standards für digitale EnzyklopädienEnzyklopädie– digitale setzte:
Zehn Jahre nachdem der US-Amerikaner Jimmy Wales den Startschuss zur Online-Enzyklopädie Wikipedia gab, sind die Print-Enzyklopädien weitestgehend aus den Buchhandlungen verschwunden. Was ist geschehen? Die Verlage hinter den etablierten Enzyklopädien haben mit steigender Bedeutung des Internets ihre Werke ins Web gestellt. Sie haben es aber versäumt, die Enzyklopädien dem Internet anzupassen (Stöcklin 2012: 110).
Die Reaktionen der etablierten Verlage auf WikipediaWikipedia fielen unterschiedlich aus. Die gedruckte Ausgabe der Universalis wurde ab 2012 eingestellt ebenso wie die des Brockhaus und der Britannica. Diese Enzyklopädien bieten auf ihrer Internetplattform kostenpflichtige Abonnements an. Einen anderen Weg ging das Haus Larousse, das ab 2008 eine Plattform lancierte, auf der kostenlose Inhalte zur Verfügung gestellt werden. Das ursprüngliche Konzept, einen Teil der Artikel durch CrowdsourcingCrowdsourcing erstellen zu lassen, wurde jedoch zugunsten des Autorenprinzips wieder zurückgenommen. Wiederum einen anderen Weg gingen die italienischen Verlage. De Agostini bietet mit der Seite sapere.it ein kostenloses Wissensportal an, das neben einer Enzyklopädie und Wörterbüchern auch Spiele beinhaltet. Im Gegensatz zu vielen anderen etablierten Verlagen setzt das Istituto dell’Enciclopedia Italiana weiterhin auf die gedruckte Ausgabe der Enciclopedia Treccani, die einen großen Teil des Umsatzes ausmacht. Begleitet wird die Printversion von einem kostenlosen Onlineangebot auf der Seite treccani.it und einer App für die mobile Konsultation. Angesichts der Entwicklungen im Bereich der PrintenzyklopädienEnzyklopädie– Print-~, aber auch im Bereich der Onlineauftritte nationaler Enzyklopädien stellt der Fall der Enciclopedia Treccani eine Ausnahme dar. Die hohe Akzeptanz der Printenzyklopädie in Italien hängt einerseits mit einer verlangsamten Entwicklung und einer schlechteren digitalen Infrastruktur im Land zusammen, andererseits aber auch mit der außergewöhnlichen kulturellen Bedeutung der Enzyklopädie. Denn nicht nur die Printausgabe, sondern auch der Internetauftritt erfreut sich großer Beliebtheit und erreichte im Jahre 2014 10 Millionen Nutzer, was zwar im Vergleich zur italienischen Wikipediaausgabe sehr gering, im Vergleich mit den Auftritten anderer Verlagshäuser jedoch enorm ist.
2.7 Resümee
Insgesamt lässt sich sagen, dass die Bezeichnung enzyklopaedia eine Schöpfung der Humanisten ist (um 1490) und von diesen in der Bedeutung ʻumfassendes pädagogisches Programm, das den Zusammenhang des Wissens betontʼ verwendet wird. Erst mit AlstedAlsted, Johann Heinrich wird der Ausdruck zur Bezeichnung von Nachschlagewerken benutzt und es entsteht ein Enzyklopädiebegriff, in dessen Folge im 19. Jahrhundert die Geschichte der Gattung Enzyklopädie geschrieben werden kann.
In der Antike vermittelten enzyklopädische Werke vor allem Wissen zu den Sieben Freien Künsten, denen einzelne thematische Bücher gewidmet wurden (CatoCato, Marcus Porcius, VarroVarro, Marcus Terentius, PliniusPlinius der Ältere). Im Mittelalter wurde enzyklopädisches Wissen aus einer christlichen Sicht präsentiert und diente der Bildung von Geistlichen (CassiodorCassiodor, Isidor von SevillaIsidor von Sevilla, Vinzenz von BeauvaisVinzenz von Beauvais). Die Werke der Antike und des Mittelalters sind auf Latein abgefasst. Mit LatinisLatini, Brunetto Livres dou trésor begann die volkssprachlichevolkssprachlich Enzyklopädik und in der Renaissance wurde die zunehmende Fokussierung auf wissenschaftliche Inhalte durch Abhandlungen in der VolksspracheVolkssprache begünstigt. Im 17. Jahrhundert begann sich die Form des alphabetischen LexikonsLexikon– alphabetisches durchzusetzen. Als direkte Vorläufer der Enzyklopädien der Aufklärung gelten die Werke von MorériMoréri, Louis, FuretièreFuretière, Antoine und insbesondere das kritische Lexikon von BayleBayle, Pierre. Auf dieses bezog sich auch Vincenzo CoronelliCoronelli, Vincenzo.
Mit ChambersChambers, Ephraim Cyclopaedia setzte die Tradition der aufklärerischen Enzyklopädien ein. Diese systematisierten die Wissensgebiete nach erkenntnistheoretischen Prinzipien und stellten dem Werk häufig einen Baum des Wissens voran. Die bekannteste unter diesen ist die Grande Encyclopédie ou Dictionnaire raisonnée des arts, des sciences et des métiers von DiderotDiderot, Denis und d’Alembertd’Alembert, Jean le Rond, die aufgrund ihrer polemischen Artikel auch häufig als „Bollwerk der Aufklärung“ gilt. In etwa zeitgleich entstand das Dizionario PivatisPivati, Gianfrancesco, das den Verhältnissen in Italien Rechnung trägt und den Primat der katholischen Religion mit aufklärerischen Ideen zu vereinbaren sucht.
Die nachfolgenden Werke im 19. Jahrhundert bezogen sich zwar auf die Grande Encyclopédie, lehnten aber die kritische Vorgehensweise weitestgehend ab. Modellbildend wurden das KonversationslexikonKonversationslexikon, das breiten sozialen Schichten ein gesichertes Wissen vermitteln wollte, und das enzyklopädische Wörterbuchenzyklopädisches Wörterbuch von Larousse. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden Enzyklopädien als nationale Projekte. Als Modell wirkte die Encyclopædia Britannica. Die bekannteste Enzyklopädie dieses Zeitalters ist jedoch die Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti, die dem italienischen Faschismus verpflichtet ist. In der Folge weitete sich der Fokus und es existieren eine Vielzahl von Formaten nebeneinander.
Mit dem Siegeszug digitaler Technologien findet ein MedienwechselMedienwechsel statt. Die etablierten Verlage gehen zunehmend dazu über, Enzyklopädien zunächst auf CD-ROM, später Onlineversionen, kostenpflichtig anzubieten. Eine Zäsur stellte die Entstehung der WikipediaWikipedia im Jahre 2001 dar, die Standards für digitale Enzyklopädien setzt und aufgrund ihrer Kostenlosigkeit und schnellen Erreichbarkeit zum Verschwinden der Printenzyklopädien führt.
Die durch Wikipedia ausgelöste Zäsur wird insbesondere vor dem Hintergrund der Geschichte der Enzyklopädie sichtbar. Lässt sich durch die Geschichte hindurch eine Anpassung der Enzyklopädien an ein verändertes Zielpublikum erkennen, so bleibt doch der Produktionsprozess konstant. In Wikipedia folgt der Produktionsprozess durch CrowdsourcingCrowdsourcing und KollaborationKollaboration hingegen der Logik digitaler Plattform-Industrien.
3 Wikipedia und der Wandel der Diskurstradition Enzyklopädieartikel
In WikipediaWikipedia werden EnzyklopädieartikelEnzyklopädieartikel kollaborativ auf einer WikiplattformWikiplattform erstellt. Dadurch befinden sich die Artikel zum einen in der technischen Umgebung eines WikisWiki, die die Funktionalitäten der Artikel prägt. Zum anderen ermöglicht diese Technologie spezifische kommunikative und soziale Praktiken, die den Erstellungsprozess eines EnzyklopädieartikelsEnzyklopädieartikel grundlegend verändern. Dazu gehören die multiple Autorschaftmultiple Autorschaft durch relativ anonym und dezentral agierende Benutzer, die anhaltenden ModifikationenModifikation der Artikel, die an der VersionsgeschichteVersionsgeschichte nachvollziehbar werden und die intensiven AushandlungsprozesseAushandlungsprozess, die die Erstellung begleiten, und an Kommentaren in der VersionsgeschichteVersionsgeschichte oder auf den Diskussionsseiten der ArtikelDiskussionsseite sowie der NutzerprofileNutzerdiskussion sichtbar werden. In welchem Maße sich nun diese veränderten Bedingungen auswirken, und inwiefern sich WikipediaartikelWikipediaartikel von gedruckten Artikeln unterscheiden, wird in der Forschungsliteratur unterschiedlich eingeschätzt, wobei die Bewertungen von geringfügigen Abweichungen gegenüber PrintartikelnPrintartikel (cf. Fandrych/Thurmair 2011: 104) bis hin zu einer völlig neuen DiskurstraditionDiskurstradition (cf. Herring 2013: 15) reichen.
3.1 Diskurstraditionen
In der vorliegenden Studie werden Veränderungen in WikipediaartikelnWikipediaartikel vor dem Hintergrund des Konzepts der „Diskurstradition“ betrachtet, da sich dieses in besonderem Maße dazu eignet, Veränderungen in Enzyklopädieartikeln nachzugehen.
3.1.1 Konzept
Der Terminus DiskurstraditionDiskurstradition ist mit der Vorstellung verbunden, dass Diskurse nicht nur individuelle Realisierungen von Sprache sind, sondern dass sie durch Mustersprachliche Muster geprägt sind und deswegen Traditionen folgen. Es zeigt sich,
daß in Diskursen nicht nur einzelsprachliche Regeln zur Anwendung gebracht werden, sondern daß Diskurse notwendig ganz bestimmte Textmuster, Textschemata oder Textmodelle realisieren – eben Diskurstraditionen folgen (Oesterreicher 1997: 20).
Dieser Umstand führt dazu, dass Koch die historische Ebene in Coserius Modell des Sprachlichen doppelt, weil dieses den Diskurs lediglich auf der aktuellen Ebene der Realisierung sieht und somit die Traditionalität von Diskursen nicht erklären kann. Diese Traditionalität von Diskursen zeigt sich bei konkreten Texten anhand rekurrenter MerkmaleRekurrenz. Anhand dieser Merkmale wiederum können einzelne Texte einer Diskurstradition zugeordnet werden. Der Terminus Diskurstradition wird in der vorliegenden Studie bevorzugt verwendet, obwohl die Termini GattungGattung, GenreGenre, TextsorteTextsorte oder TexttypTexttyp ebenso zur Klassifizierung von Texten dienen. Jedoch werden bei der Einteilung nach Gattungen oder Genres häufig lediglich geschriebene und literarische Texte berücksichtigt. Der Terminus TextsorteTextsorte stammt aus der germanistischen Linguistik und wurde zunächst zur Erstellung von TexttypologienTexttypologie eingesetzt, die Texte top-downtop-down-Klassifikation nach einem zuvor festgelegten Merkmal klassifizieren. In der weiteren Entwicklung wurde der Terminus auch für Analysen verwendet, die Texte nach in ihnen enthaltenen Merkmalsbündeln klassifizieren und somit korpusbasiertkorpusbasierte Klassifikation vorgehen (cf. Adamzik 2001: 16f.). Bei weiter abstrahierenden Verfahren der Klassifikation wird häufig von Texttyp gesprochen. Während TextsorteTextsorte eher empirisch vorliegende TextmusterTextmuster beschreibt, ist Texttyp eine „theoriebezogene Kategorie zur wissenschaftlichen Klassifikation von Texten“ (Aschenberg 2003: 4). Für die vorliegende Arbeit erscheint das Konzept „Diskurstradition“ am geeignetsten. Im Gegensatz zu den Konzepten „Gattung“ oder „Genre“ werden auch nicht-literarische Gebrauchstexte berücksichtigt. Zudem erfassen die Konzepte „Textsorte“ und „Texttyp“ die einzelnen Texte und die daran ersichtlichen Konventionen eher unter dem Gesichtspunkt eines sprachlichen Produkts, während „Diskurstraditionen einen Wissensbestand unter dem Gesichtspunkt der dynamis fokussieren“ (Schrott 2015: 118), was bedeutet, dass die Dynamik von Konventionen im Vordergrund steht. Durch das Konzept „Diskurstradition“ werden zudem diskurstraditionelle Merkmale eines unterschiedlichen Komplexitätsgrads erfassbar (cf. Koch 1997: 45), die von FormelnFormel über TexttraditionenTexttradition bis hin zu DiskursuniversenDiskursuniversum reichen und somit auch für die korpusbasierte Textanalyse verwendet werden können. Bei der Analyse einzelner Textexemplare ist eine erhebliche Varianz zu erwarten, da Diskurstraditionen häufig komposit sind und mehrere Muster mischenDiskursmustermischung (cf. Oesterreicher 1997: 31). Die Varianz zwischen den einzelnen Textexemplaren ist wiederum Ausgangspunkt für den Wandeldiskurstraditioneller Wandel von Diskurstraditionen, der anhand von Serien historischer Textexemplare nachvollzogen werden kann (cf. Aschenberg 2003: 8; Große 2017: 45; Kabatek 2015: 62; Oesterreicher 1997: 32). Diskurstraditionelle Merkmale können somit aus einzelnen Textexemplaren abstrahiert werden, wobei sich die RegelnDiskursregel, nach denen die Muster gebildet werden, nach kommunikativen BedingungenKommunikationsbedingungen und gesellschaftlich-kulturellen Normenkulturelle Norm richten:
 Abbildung 1:
Abbildung 1:
Modell einer Diskurstradition (eigene Darstellung)
Auf der Ebene der Einzeltexte werden Diskurstraditionen an rekurrenten MerkmalenRekurrenz sichtbar. Wie der Terminus nahelegt, geht es darum, Konventionen von Diskursen zu erfassen. Von Diskursen wird gesprochen, weil hier die diskursiv-kulturelle Geformtheit der Sprachprodukte im Vordergrund steht und keine einzelsprachliche Perspektive auf Texte eingenommen wird, welche häufig Texte als komplexeste Ebene einer Einzelsprache ansieht.1 Es werden sprachübergreifende Gemeinsamkeiten von Diskursen herausgearbeitet. Diese Konventionen müssen sich zudem nicht unbedingt auf die MusterDiskursmuster ganzer Texte beziehen. Diskurstraditionen können von verschiedener Komplexität sein. Sie reichen von FormelnFormel, über Text- oder DiskursgattungenGattung bis hin zu DiskursuniversenDiskursuniversum (cf. Koch 1997: 45). FormelnFormel werden häufig zu Beginn oder am Ende eines Textes verwendet und verweisen auf ganze Text- und DiskursgattungenGattung wie die Formel Es war einmal auf ein Märchen, Gehet hin in Frieden auf eine Predigt oder Im Namen des Volkes auf ein Gerichtsurteil. Text- und Diskursgattungen sind durch ein ganzes Bündel rekurrenter MerkmaleRekurrenz gekennzeichnet. Beispielsweise wird in einem Kochrezept der Name des Gerichts in der Überschrift genannt, woraufhin eine Zutatenliste mit Mengenangaben folgt. In einem Fließtext werden häufig mithilfe von Infinitiven Instruktionen zur Zubereitung eines Gerichts angegeben, die von Zeitangaben begleitet sind. Einen noch höheren Komplexitätsgrad als Text-/Diskurstraditionen weisen DiskursuniversenDiskursuniversum auf, in denen Text- und Diskursgattungen gruppiert werden können. CoseriuCoseriu, Eugenio unterscheidet die DiskursuniversenDiskursuniversum Alltag, Fiktion, Religion und Wissenschaft (cf. Schlieben-Lange 1983: 140; Kabatek 2015: 63), wobei das Verhältnis des sprechenden Subjekts zu den beschriebenen Objekten als Einteilungskriterium dient:
Im Gegensatz zu feinmaschigeren Einteilungen, die etwa Bereiche wie die Jurisprudenz, die Mathematik oder die Philosophie als eigenständige Diskurs- oder Redeuniversen bezeichnen, bezieht sich diese Einteilung auf die grundlegenden semiotischen Verhältnisse, die jedem Sprechen zugrunde liegen, wobei sie das Verhältnis von Subjekt und Objekt als fundamentales Einteilungskriterium heranziehen: Im Universum des Alltags spricht das Subjekt aus subjektiver Perspektive über die Objekte; im Universum der Fiktion spricht das Subjekt über Objekte, die als nicht existent angenommen werden und einer ‚geschaffenen‘ Welt der Phantasie entsprechen; im Universum der Religion (oder des Glaubens) wird über eine ‚andere Welt‘ gesprochen, die nicht überprüfbar ist und dennoch als existent vorausgesetzt wird; und schließlich, im Universum der Wissenschaft, werden die Objekte als Objekte in ‚objektiver‘ Sicht beschrieben (Kabatek 2011: 95f.).
Anhand konkreter Einzeltexte können abstrakte DiskurstraditionenDiskurstradition in allen drei Komplexitätsgraden analysiert werden. Was auf der Textoberfläche als Muster erscheint, wird durch DiskursregelnDiskursregel erzeugt (cf. Lebsanft/Schrott 2015: 40):
Diskurstraditionen oder diskurstraditionelle Kennzeichen sollen hier vorläufig bestimmt werden als normative, die Diskursproduktion und Diskursrezeption steuernde, konventionalisierte Muster der sprachlichen Sinnvermittlung (Oesterreicher 1997: 20).
Die DiskursregelnDiskursregel geben „Anleitungen zum Sprechen in konkreten Situationen“ (Schrott/Völker 2005: 12), sie sind „bereits auf Typen von Situationen bezogen“ (Koch 1987: 34). Sie treten zu den Regeln der historischen Einzelsprachenhistorische Einzelsprache hinzu (cf. Koch 1987: 34). Im Gegensatz zu den SprachregelnSprachregel ist ihr Bewertungsmaßstab nicht die Korrektheit der sprachlichen Formen, sondern die Angemessenheit in der jeweiligen Situation (cf. Coseriu 1994: 58). Diskursregeln bestimmen sowohl das sprachliche als auch das nichtsprachliche Material und determinieren beispielsweise die spezifische Anordnung des Stoffes (dispositio), die Rhythmisierung des Sprachmaterials oder die Bezüge zwischen sprachlichen und anderen semiotischen Codes (cf. Koch 1997: 47; Kabatek 2015: 63). Zudem bewirken die Diskursregeln eine „nicht-deterministische Realisierung der Diskursmuster“ (Oesterreicher 1997: 30), was bedeutet, dass einzelne Texte auch mit Diskursregeln brechen können, wodurch der kommunikative Erfolg nicht unbedingt beeinträchtigt wird und in einigen Fällen sogar besondere Stileffekte erzeugt werden können. Ebenso sind diese Freiheitsgrade bei der Weiterentwicklung von DiskurstraditionenDiskurstradition entscheidend:
Jede konkrete Realisierung eines Einzeldiskurses ist theoretisch immer schon der Ort der Möglichkeit der Fortbildung von Diskursregeln (Oesterreicher 1997: 31).
Das Potential eines einzelnen Textes, DiskursregelnDiskursregel weiterzuentwickeln, wird im Schema mit kleinen Pfeilen symbolisiert, die zeigen, dass die Tendenzen pro Einzeltext in unterschiedliche Richtungen gehen können. Erst die Analyse wiederkehrender Veränderungen in einem Textkorpus kann Aufschluss über die Entwicklung einer Diskurstradition geben.
Dadurch, dass Diskurstraditionen bereits auf konkrete Kommunikationssituationen ausgerichtet sind, stehen sie in enger Verbindung zu den universellen Parametern der Kommunikation, die jeden erdenklichen Kommunikationsakt charakterisieren:
Was Diskurstraditionen angeht, ist damit aber nun behauptet, daß diese in einem präzisen Sinne selbst schon kommunikativ-konzeptionell determiniert sind, daß sie also selber je schon konzeptionelle Zusammenhänge spiegeln, die sich aus unterschiedlichen Konstellationen der skizzierten Kommunikationsbedingungen und Verbalisierungsstrategien ergeben, daß sie sich mithin in einem ganz fundamentalen Sinne auf das Nähe-Distanz-Kontinuum beziehen lassen. Dies bedeutet, daß kommunikativ-konzeptionelle Kriterien immer schon in die Definition von Diskurstraditionen einfließen, den Diskurstraditionen gewissermaßen eine konzeptionelle Grundstruktur einzeichnen (Oesterreicher 1997: 24).
In ihrem Modell setzen Koch/Oesterreicher insgesamt zehn Parameter2 an. Die Mischung der jeweiligen Parameterwerte ergibt das konzeptionelle Profil3 einer Diskurstradition. Die Parameter und ihre Werte charakterisieren „das kommunikative Handeln der Gesprächspartner im Verhältnis zueinander und im Blick auf die sozialen, situativen und kontextuellen Gegebenheiten“ (Koch/Oesterreicher 2007: 350). Parameter (1) unterscheidet, ob der Kommunikationsakt öffentlichÖffentlichkeit oder privat stattfindet. Ein öffentlicher Kommunikationsakt ist für eine Vielzahl von Rezipienten zugänglich, während ein privater Kommunikationsakt einen eingeschränkten Adressatenkreis erreicht. Im Modell von Koch/Oesterreicher korreliert Privatheit mit dem Nähepol, weil davon ausgegangen wird, dass bei steigender Anzahl der Rezipienten die direkte Beteiligung am Kommunikationsakt abnimmt und deswegen die Distanz zunimmt (cf. Koch/Oesterreicher 1985: 20). Parameter (2) unterscheidet, ob sich die Kommunikationspartner kennenVertrautheit und auf ein gemeinsames Wissen und gemeinsame Kommunikationserfahrungen zurückgreifen können, oder ob sich die Kommunikationspartner fremd sind. Ein hoher Grad der VertrautheitVertrautheit wird dem Nähepol zugeordnet, während die Fremdheit der Partner für das Distanzsprechen typisch ist. Parameter (3) beschreibt, in welchem Maße die Kommunikationspartner ihren EmotionenEmotionalität freien Lauf lassen (Nähesprechen), oder ob sie diese kontrollieren (Distanzsprechen). Parameter (4) charakterisiert den Grad der Handlungs- und SituationseinbindungHandlungs- und Situationseinbindung. Dieser Parameter „referiert […] auf die „Nähe“ der Kommunikationspartner zum situativen Kontext“ (Zeman 2016: 268). Beim Nähesprechen befinden sich die Kommunikationspartner in einem gemeinsamen Kommunikationsraum:
In der gesprochenen Sprache befinden sich die Partner in einer face-to-face-Interaktion (physische Nähe und gemeinsames Handeln) und/oder kommunizieren über Elemente des situativen Kontexts oder setzen sie als selbstverständlich voraus (Koch/Oesterreicher 1985: 20).
In Situationen des Distanzsprechens befinden sich Sprecher und Rezipient häufig nicht in einem gemeinsamen Kommunikationsraum und beziehen sich somit nicht auf eine gemeinsame Situation oder simultan erfolgende Handlungen. Parameter (5) beschreibt den Referenzbezug des Kommunikationsakts „bei dem entscheidend ist, wie nahe die bezeichneten Gegenstände und Personen der Sprecher-origo sind“ (Koch/Oesterreicher 2011: 7). Entscheidend ist dabei die „Anwesenheit oder Abwesenheit des Referenzgegenstandes“ (Koch/Oesterreicher 2011: 7). Referenzielle Distanz liegt beispielsweise bei Erzählungen über die Vergangenheit vor, da diese auf raum-zeitlich entfernte Ereignisse und Personen referiert (cf. Koch/Oesterreicher 2008: 207). Parameter (6) beschreibt sowohl die räumliche als auch die zeitliche Nähe der KommunikationspartnerNähe– der Kommunikationspartner, wobei bei einem Face-to-Face-Gespräch sowohl räumliche als auch zeitliche Nähe gegeben sind, während bei einem Telefonanruf zwar die zeitliche, nicht aber die räumliche Nähe gegeben ist, und dieses deswegen ein wenig in Richtung des Distanzpols verweist. Parameter (7) fokussiert den Grad der KooperationKooperation, also die Möglichkeit des Rezipienten, bei der Produktion des Diskurses mitzuwirken:
Kommunikation ist immer auch Kooperation. Hierbei sind allerdings in der gesprochenen Sprache Produktion und Rezeption direkt miteinander verzahnt: Produzent und Rezipient handeln miteinander Fortgang und auch Inhalt der Kommunikation aus; der Rezipient zeigt begleitende sprachliche und nichtsprachliche Reaktionen und kann jederzeit eingreifen, rückfragen (‚Rückkopplung‘). Demgegenüber sind in der geschriebenen Sprache Produktion und Rezeption – auch dort, wo sie gleichzeitig verlaufen (Vortrag) – voneinander ‚abgekoppelt‘; dies bedeutet, daß der Produzent die Belange der Rezeption von vornherein berücksichtigen muß (Koch/Oesterreicher 1985: 20).
Während demnach das Face-to-Face-Gespräch durch intensive Kooperation geprägt ist und durch Rückmeldungen des Kommunikationspartners aufrechterhalten wird, ist dies bei einem schriftlich fixierten Text nicht der Fall. Parameter (8) charakterisiert einen Diskurs als monologisch oder dialogischDialogizität, wobei Dialogizität die Möglichkeit meint, spontan die Rolle des Produzenten zu übernehmen:
Die Rollenverteilung zwischen den Kommunikationspartnern ist in der gesprochenen Sprache offen, und der Rollenwechsel wird ad hoc geregelt (Dialogizität). Demgegenüber zeigt geschriebene Sprache eine feste Rollenverteilung bis hin zur totalen Monologizität (Koch/Oesterreicher 1985: 19).
Parameter (9) beschreibt den Grad der SpontaneitätSpontaneität oder Geplantheit eines Diskurses. Während beim Nähesprechen die Planung der Kommunikationsakte während des Äußerungsaktes selbst erfolgt, ist beim Distanzsprechen eine längere Vorausplanung möglich, aber aufgrund der Situationsferne auch nötig, da auf keinen gemeinsamen Kontext zurückgegriffen werden kann (cf. Koch/Oesterreicher 1985: 20). Parameter (10) bezieht sich auf die Frage, ob das ThemaThemenfixierung sich wie in einem spontanen Gespräch frei entwickeln kann, oder ob dieses vorher festgelegt worden ist, wie dies beispielsweise in moderierten Talkshows der Fall ist. Jede Diskurstradition lässt sich durch eine Mischung von Werten der vorgestellten Parameter charakterisieren, wodurch sie ihr spezifisches konzeptionelles Profilkonzeptionelles Profil erhält.